Kiasmos
Interview — Kiasmos
»Ohne unsere Freundschaft würde es Kiasmos nicht geben«
Gut Ding will Weile haben: Nach fast einer Dekade haben Kiasmos vor Kurzem ihr zweites Album veröffentlicht. Das jüngste Werk des Minimal-Techno-Projekts von Janus Rasmussen und Ólafur Arnalds hat zwar keinen besonderen Namen, dafür aber umso mehr Inhalt: 13 Tracks, zu denen man nicht nur schön träumen kann, sondern auch verdammt gut tanzen. Ein Interview über Freundschaft als Arbeitsgrundlage, Songtitel ohne Hintergedanken, eine mysteriöse Raute und Musik, die einem nicht mehr gehört, sobald man sie veröffentlicht.
10. Oktober 2024 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

Zwei gute Freunde, ein paar Ideen, etwas Zeit – manchmal braucht es nicht viel mehr, um Schönes zu erschaffen. Wie etwa im Fall von Ólafur Arnalds und Janus Rasmussen. Vor ziemlich genau 15 Jahren gründeten sie ihr gemeinsames Projekt Kiasmos, mit dem sie sich musikalisch ganz und gar dem Minimal Techno verschrieben und in die Herzen von Abermillionen Menschen auf der ganzen Welt gespielt haben.
Doch nachdem sie 2014 ihr erstes Album veröffentlicht hatten, ließen sie es eher ruhig angehen. Mal eine kleine EP hier, mal eine Single da, das war’s. Warum auch hetzen? Schließlich haben die beiden Isländer – Ólafur ist dort geboren, Janus stammt ursprünglich von den Faröern – abseits von Kiasmos genug zu tun.
Der eine, Ólafur, zählt als Komponist und Multiinstrumentalist zu den renommiertesten Contemporary-Classic-Künstlern der Welt; mit seinen eingängigen und oft auch ergreifenden Stücken erforscht er seit Jahren vor allem die Stille. Der andere, Janus, ist als Songwriter und Produzent nicht weniger erfolgreich. Im Gegensatz zu Óli, wie er ihn liebevoll nennt, widmet er sich in seinen Solo-Projekten eher der elektronischen und vor allem tanzbaren Musik.
Es dauerte fast eine ganze Dekade, bis die beiden Freunde die Welt mit einem weiteren Kiasmos-Album beschenkten. Die neue Platte hat zwar keinen wirklichen Namen – auf Spotify heißt das Werk schlicht „II“, was wie ein Aktenzeichen wirkt. Doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Die insgesamt 13 Tracks gehen sowohl ins Herz, unter die Haut als auch ins Bein. Energie mit Empathie, sozusagen. Wer das nicht glaubt, muss sich nur mal für ein paar Minuten von einer ihrer Live-Shows einsaugen lassen.
Wenige Stunden vor einem ihrer Konzerte in Berlin haben sich Janus und Ólafur die Zeit für ein entspanntes Interview mit uns genommen.

»Wenn der letzte Album-Release fast zehn Jahre zurückliegt, merkt man langsam, dass es Zeit ist, etwas Neues zu machen.«
MYP Magazine:
Ólafur und Janus, Ihr habt Euer zweites Kiasmos-Album zehn Jahre nach dem ersten und 15 Jahre nach Gründung Eures gemeinsamen Projekts veröffentlicht. Wolltet Ihr Euch damit ein kleines Jubiläumsgeschenk machen?
Ólafur:
Nicht wirklich. Aber wenn der letzte Album-Release fast zehn Jahre zurückliegt, merkt man langsam, dass es Zeit ist, etwas Neues zu machen.
MYP Magazine:
Haben sich Eure Musik und das gemeinsame Arbeiten im Laufe der Jahre in irgendeiner Form verändert?
Janus:
Absolut. Alles andere wäre auch seltsam. Schließlich macht man allein als Mensch in dieser langen Zeit eine ziemliche Entwicklung durch. Und das beeinflusst natürlich die Musik. Davon abgesehen hat in der letzten Dekade auch die Technologie einen großen Schritt nach vorne gemacht, was wiederum die Art und Weise des Produzierens verändert hat.
Ólafur:
Dazu kommt, dass wir bei unserem ersten Album noch sehr viel improvisiert hatten – das war bei dem zweiten anders, zumindest ein Stück weit. Wir hatten zwar auch diesmal keinen konkreten Plan oder so etwas wie ein Konzept. Aber wir haben viel bewusster darüber nachgedacht, was wir machen, wie wir dabei vorgehen, welche Details wir fokussieren und wie viel Zeit wir darauf verwenden.

»Es gibt in dieser Freundschaft unausgesprochene Regeln, die wir schon lange nicht mehr diskutieren müssen.«
MYP Magazine:
Ihr beide seid nicht nur Bandkollegen, sondern auch enge Freunde. Würde Kiasmos anders klingen, wenn ihr Euch in all den Jahren „nur“ auf der beruflichen und nicht auf der freundschaftlichen Ebene begegnet wärt?
Ólafur: (lacht)
Ich würde gar nicht erst mit jemandem Musik machen, mit dem ich nicht auch befreundet wäre.
Janus:
Óli hat recht. Ohne unsere Freundschaft würde es Kiasmos nicht geben. Wir beide sind – auch außerhalb dieses Projekts – in der glücklichen Situation, fast ausschließlich mit Freunden und Bekannten arbeiten zu können. Das ist ein Privileg, das man nicht hoch genug einschätzen kann.
MYP Magazine:
Auch Freunde streiten manchmal. Wie tragt Ihr musikalische Konflikte aus – etwa, wenn Ihr verschiedene Perspektiven darauf habt, wie ein Track klingen soll?
Janus:
Das kommt zum Glück nicht allzu oft vor. Als Musikproduzenten sind wir es gewohnt, miteinander zu arbeiten. Das bedeutet, dass man auch mal eine Idee aufgeben muss, wenn sie für den jeweils anderen nicht funktioniert. Wir kennen uns mittlerweile so gut, dass solche Situationen am Ende nicht eskalieren. Oder anders gesagt: Es gibt in dieser Freundschaft unausgesprochene Regeln, die wir schon lange nicht mehr diskutieren müssen.

»Ich wüsste nicht, wo ich die Grenze ziehen sollte zwischen der Denkweise eines Künstlers, der aus der klassischen Musik kommt, und der von jemandem, der elektronische Musik macht.«
MYP Magazine:
Welche Rolle spielt es dabei, dass Ihr beide Euch außerhalb von Kiasmos in eher unterschiedlichen musikalischen Welten bewegt?
Ólafur:
Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Welten so verschieden sind. Das ist aus meiner Sicht auch gar nicht wichtig. Entscheidend ist nur die Frage, ob unsere individuellen Denk- und Arbeitsweisen miteinander harmonieren oder nicht. Davon abgesehen wüsste ich auch nicht, wo ich die Grenze ziehen sollte zwischen der Denkweise eines Künstlers, der aus der klassischen Musik kommt, und der von jemandem, der elektronische Musik macht.
Janus:
Ich verstehe das Bedürfnis und auch die Notwendigkeit, Musik aus der Genre-Brille zu betrachten. Ohne gewisse Klassifikationen wäre es auch wesentlich schwerer, sich darüber zu unterhalten. Aber aus der Perspektive von uns Musikern wirkt das immer ein bisschen zu einfach und reduziert – denn der kreative Prozess dahinter ist viel umfassender, komplexer und auch genreübergreifender, als man das vielleicht meinen könnte.
Klar, natürlich lassen sich auch bei Óli und mir gewisse Unterschiede ausmachen, aber die beziehen sich hauptsächlich auf die Technik: Zum Beispiel gibt es Software, die sich hauptsächlich an elektronische Musiker richtet, und andere wiederum ist eher für Leute entwickelt, die konventionelle Musik machen.
MYP Magazine:
Wie genau entsteht bei Euch ein Track?
Janus:
Wir haben da kein bestimmtes Muster. Manchmal ist es Óli, der mit dem Keyboard einen ersten Aufschlag macht. Und manchmal bin ich es, der zuerst einen Beat oder Percussion-Loop liefert, den ich irgendwo gefunden habe und zu dem Óli dann eine Akkordfolge hinzufügt – wie etwa bei „Sail“. Dort hatten wir mit meinem Beat und Ólis Akkorden relativ schnell eine gute Ausgangsbasis, zu der wir dann gemeinsam die Melodie komponiert haben.
Ólafur:
Ja, das war eine richtig gute Kombination. Wenn man diesen Punkt erreicht hat, geht es nur noch darum, das Ganze zu arrangieren und zu produzieren.

»Während Janus in seinem Soloprojekt bereits viel tanzbare Musik macht, sitzen bei mir die Leute eher still im Publikum und hören gespannt zu.«
MYP Magazine:
Gibt es aus künstlerischer Sicht etwas, das Ihr im Rahmen von Kiasmos besser oder anders ausdrücken könnt als in Euren jeweiligen Solo-Projekten?
Ólafur:
Grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, in irgendeiner Form beschränkt zu sein, wenn es darum geht, mich musikalisch auszudrücken. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Für mich ist Kiasmos ein wundervolles Spielfeld, das mir die Freiheit gibt, mich mehr auf Loops und Beats zu konzentrieren, ohne den Anspruch zu haben, tiefgründige Kompositionen zu schaffen. Denn während Janus in seinem Soloprojekt bereits viel tanzbare Musik macht, sitzen bei mir die Leute eher still im Publikum und hören gespannt zu.
Außerdem ist die Arbeit mit einem anderen Menschen an sich immer wieder eine spannende Erfahrung. Ich bin sicher, dass ich in vielen Fällen eine andere Melodie geschrieben hätte, wenn ich allein daran gesessen hätte. Aber wenn man mit mehreren Leuten in einem Raum ist, befindet man sich permanent in irgendwelchen Feedback-Schleifen.
Janus:
Für mich ist die Arbeit mit Óli immer eine große Bereicherung. Ich weiß genau, wo seine Talente liegen, und frage ihn nach seiner Meinung, wenn ich eine Idee habe – denn in der Regel fällt ihm immer etwas Geniales ein, woran ich selbst noch nicht gedacht hatte.

»Sobald wir die Musik geschrieben und veröffentlicht haben, gehört sie nicht mehr wirklich uns.«
MYP Magazine:
Euer neues Album vermag etwas ganz Besonderes zu leisten: Hört man es in Momenten, in denen es einem nicht so gut geht, findet man darin eine Halt, Geborgenheit und eine gewisse Empathie. Ist man aber eher optimistisch und positiv gestimmt, hat man das Gefühl, von den Tracks regelrecht energetisiert zu werden. Wie gelingt es Euch, Musik zu schreiben, die Menschen auf so unterschiedlichen Emotionsebenen ansprechen kann?
Ólafur:
Das ist kein bewusster Vorgang. Sobald wir die Musik geschrieben und veröffentlicht haben, gehört sie nicht mehr wirklich uns. Die Menschen machen daraus, was sie gerade fühlen – das entzieht sich absolut unserer Kontrolle.
Janus:
Und da wir rein instrumentale Musik machen, liefern wir den Leuten auch keine Worte, die ihnen sagen könnten, wie sie sich fühlen sollten. Selbst die Titel unserer Tracks haben nicht wirklich eine Bedeutung. Oft entstehen sie erst in den allerletzten Momenten der Fertigstellung eines Stücks.

»Ein Freitagabend in Berlin kann einen völlig anderen Vibe haben als ein Montagabend in Reykjavik.«
MYP Magazine:
Das heißt, Ihr wisst auch nie so richtig, wie das Publikum am Abend einer Show auf Eure Musik reagieren wird?
Janus:
Natürlich wissen wir, dass die Leute zu einem Kiasmos-Konzert kommen, weil sie unsere Musik mögen. Sonst würden sie sich kaum eine Karte kaufen. Aber wir nehmen immer wieder wahr, dass die Stimmung von Show zu Show variiert. Ein Freitagabend in Berlin zum Beispiel kann einen völlig anderen Vibe haben als ein Montagabend in Reykjavik oder ein Mittwochabend in London – allein deshalb, weil die Leute am nächsten Morgen nicht so früh aus dem Bett müssen und dadurch viel ausgelassener feiern.
Ólafur:
Ich finde, eine Show beginnt auch immer schon bei den Menschen zu Hause. Alles zählt an so einem Abend: wie man sich kleidet, welches Parfum man auflegt, mit welchen Freunden man sich verabredet, wie man zur Venue kommt. Und wenn die Show dann endlich losgeht, zählt jede einzelne Person im Raum – und jeder einzelne Geruch, jede einzelne Bewegung. Alles beeinflusst die Atmosphäre.

»Wenn man dem Ganzen nachträglich eine Bedeutung geben wollte, könnte man sagen, dass der Song etwas mit dir als Hörer gemacht hat.«
MYP Magazine:
Janus, Du hast eben das Thema Songtitel angesprochen. Diese bestehen bei Euch seit vielen Jahren nur noch aus einem einzigen Begriff: „Grown“, „Burst“, „Sailed“, „Laced“ oder „Bound“ sind allesamt Verben, die im Präsenzperfekt gehalten ist: einer Tempusform, die ausdrückt, dass das Geschehen vom Standpunkt des Sprechers aus zwar vergangen ist, sich aber doch auf seinen Standpunkt bezieht. Was fasziniert Euch so an diesen Begriffen, mit denen Ihr inhaltlich immer nur in die nähere Vergangenheit, aber nie in die Zukunft blickt?
Ólafur: (grinst)
Wir fanden es einfach witzig, mehr nicht.
Janus:
Naja, so ganz ist es ja auch nicht. Ich persönlich mochte schon immer diese Ein-Wort-Titel, auch in meinem Solo-Projekt. Sie sind leichter zu erfassen, wirken visuell ästhetischer und bieten inhaltlich mehr Raum für Interpretationen, weil sie nicht zu sehr in eine bestimmte Richtung deuten. Das schafft eine gewisse Freiheit, sowohl für uns als auch für die Hörenden.
Ólafur:
Dennoch ist die Idee dazu aus reinem Spaß entstanden. Ich glaube, „Wrecked“ war damals der erste Titel, der nur noch aus einem Wort bestand. Wenn man dem Ganzen nachträglich eine Bedeutung geben wollte, könnte man sagen, dass der Song etwas mit dir als Hörer gemacht hat. Er hat dich zum Beispiel wachsen lassen, zerstört oder verwischt. Aber während ich das so erzähle, merke ich, wie konstruiert sich das anhört. Es gibt einfach kein großes Konzept dahinter.
»Das Album sollte sich so anfühlen, als würde man sich durch etwas hindurchbewegen.«
MYP Magazine:
Die Reihenfolge der elf Songtitel erinnert in gewisser Weise an den natürlichen Zyklus des Lebens. „Grown“ zum Beispiel könnte für die Geburt stehen, „Bound“ für das Festhängen im Korsett alltäglicher Verpflichtungen und „Dazed“ für das langsame Ausscheiden aus dem Leben. Ist diese Dramaturgie ebenfalls aus reinem Spaß und Zufall entstanden?
Ólafur:
Die Reihenfolge der Songs ist sehr bewusst gewählt – allerdings aus rein musikalischer Sicht, nicht aus inhaltlicher. Es gibt keine spezifische Geschichte, die wir mit der Anordnung der Titel erzählen wollen. Es sollte sich nur so anfühlen, als würde man sich durch etwas hindurchbewegen. Und wenn der eine oder andere darin den Zyklus des Lebens liest, freut mich das – denn es zeigt, dass unsere Musik in der Lage ist, persönliche Interpretationsräume zu füllen.
Janus:
Ich finde es ohnehin viel spannender, den Leuten nicht immer alles haarklein vorzugeben. Ich möchte sie eher einladen, ihre ganz eigenen Gedanken und Ideen zu unserer Musik zu entwickeln. Ich kann den Gedanken aber total verstehen: Gerade der Zyklus des Lebens ist eine Assoziation, die einem oft als erstes in den Kopf schießt. Immerhin gehören Geschichten, die von Geburt, Wachstum, Abschied, Tod und Erlösung handeln, zu unserer Kultur. Damit wurden wir sozialisiert.
Auf der anderen Seite ist es so, dass es auf einem Album manchmal gar keinen anderen Ort gibt, an dem man einen Track platzieren könnte. Bei „Grown“ zum Beispiel wussten wir bereits vor vielen Jahren, dass er der allererste Song des neuen Albums sein sollte. So eine Entscheidung beeinflusst die Reihenfolge aller anderen Songs maßgeblich.

»Der Monolith ist nichts anderes als ein Symbol, das für die Offenheit und Durchlässigkeit unserer Musik steht.«
MYP Magazine:
Bereits seit einigen Jahren begleitet Euch ein mysteriöses grafisches Element, das so gut wie alle visuellen Aspekte von Kiasmos prägt, vom Album-Artwork bis zu den Bühnenshows. Was steckt hinter dieser dreidimensionalen, außerirdisch wirkenden Raute, die auch aus einem Science-Fiction-Film oder einer Netflix-Serie stammen könnte?
Ólafur:
Wir nennen dieses Element Monolith. Für die einen wirkt es wie ein Artefakt aus einer längst vergessenen Zivilisation. Andere erinnert es an etwas Heiliges, wieder andere empfinden es als bedrohlich – und dann gibt es sogar Leute, die bemerken es gar nicht. (lacht)
Was ich damit sagen will: Der Monolith ist nichts anderes als ein Symbol, das für die Offenheit und Durchlässigkeit unserer Musik steht, wenn es um individuelle Interpretationsräume geht.
»Wir triggern die Regisseure, dem jeweiligen Song eine gewisse Bedeutung zu verleihen.«
MYP Magazine:
Dieser Monolith ist selbstverständlich auch im allerersten Musikvideo zu sehen, das Ihr zum neuen Album veröffentlicht habt. Mit dem Clip zum Track „Flown“ werft ihr den Blick in das Leben eines alten Mannes, der von tiefen Sehnsüchten und fast kindlichen Träumen getrieben zu sein scheint. In unserer jugendfixierten Gesellschaft ist das ein Narrativ, das kaum bedient wird. Alte Menschen haben auch alt zu denken, zu fühlen und zu handeln. Wie geht ihr damit um, dass das Video dem Song nun eine konkrete Bedeutungsebene gibt, die ihr ja eigentlich offen halten wolltet?
Ólafur:
Das passiert, wenn man einem Regisseur völlige Freiheit lässt. (grinst) Aber im Ernst: Es war schon immer Teil unserer Philosophie, den Filmemachern, die unsere Songs in Form von Musikvideos interpretieren, maximalen Freiraum zu geben. Das war bei Greg Barnes, der „Flown“ inszeniert hat, nicht anders. Es gab immer nur eine einzige Vorgabe: Der Monolith muss in irgendeiner Art und Weise in dem Video vorkommen. Dadurch triggern wir die Regisseure natürlich, dem jeweiligen Song eine gewisse Bedeutung zu verleihen. Was sie daraus aber am Ende machen, ist ihre Sache.

»Die Realisierung von Visionen ist bei mir eher der Normalzustand.«
MYP Magazine:
Der alte Mann im Video verfolgt einen großen Traum: Er möchte fliegen können. Wann hattet Ihr das letzte Mal in Eurem Leben einen ähnlich großen, unerfüllten Wunsch, den Ihr unbedingt in die Tat umsetzen wolltet?
Janus:
Mein größter Lebenstraum war es immer, im Tourbus schlafen zu können.
Alle lachen.
Janus:
Nein, wirklich. Das hat mich in den letzten Jahren immer wieder an den Rand des Wahnsinns getrieben. Mir fällt das echt schwer. Mittlerweile funktioniert es ganz okay, weil ich auf Tour auf fast alles verzichte: auf Alkohol, auf Nikotin, auf Kaffee. Dadurch bin ich zwar recht langweilig geworden, aber immerhin kann ich schlafen.
Ólafur: (überlegt)
Ich glaube, in mir gibt es keinen unerfüllten Wunsch. In meinem Leben war es schon immer so, dass ich die Ideen, die mir in den Kopf kommen, auch direkt in die Tat umsetzen will, was wiederum sehr viel Zeit erfordert und mit noch mehr Arbeit verbunden ist. Die Realisierung von Visionen ist bei mir also eher der Normalzustand.
Janus:
Wenn ich auf die Frage ein zweites Mal antworten darf: Für mich geht es eher darum, in den Fluss der Dinge zu kommen. Es gibt keine einzelne Vision, die ich realisieren will – für mich zählt viel mehr, ständig in Bewegung zu sein. Wie man seine Tage verbringt, so verbringt man sein Leben.

Mehr von und über Kiasmos:
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Maximilian König
instagram.com/studio.maximilian.koenig
maximilian-koenig.com
double-t-photographers.com (Repräsentanz)
The Baseballs
Interview — The Baseballs
»Wir verfügen gerade über die perfekte Mischung aus Erfahrung und Neugier«
Mit ihrem neunten Album »That’s Alright« melden sich The Baseballs fulminant zurück. Zwar ist das einstige Trio jetzt nur noch zu zweit, der Qualität ihrer Musik tut das aber keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Hinter der für die Band so typischen, Hüftschwung-evozierenden Rock’n’Roll-Stilistik versteckt sich eine neue Nachdenklichkeit. Ein Interview über den Soundtrack einer ganzen Generation, Homophobie im Musikgeschäft und Rock’n’Roll als Ausdruck von Rebellion – damals wie heute.
29. September 2024 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Stefan Hobmaier

Rebellion, so groß und ungestüm sie klingen mag, vollzieht sich manchmal im ganz Kleinen. Wie etwa, in der Schule Jeans zu tragen – zumindest im Westdeutschland der Fünfziger. „Wenn einer damit gekommen ist, wurde er wieder heimgeschickt“, erinnert sich Claus-Kurt Ilge, Jahrgang 1942, in einem NDR-Beitrag.
Für Jugendliche wie ihn war die junge Bundesrepublik nicht der harmlos-beschauliche Ort, wie er über die letzten Jahrzehnte immer wieder romantisiert wurde – Stichwort Nierentische, Petticoats und Mercedes-Heckflossen. Ganz im Gegenteil: Die BRD bedeutete für ihn bürgerliche Enge, mit autoritären Gesellschaftsstrukturen, traditionellen Rollenbildern und der dahinplätschernden „Moldau“ auf dem Plattenteller beim gemeinsamen Sonntagsfrühstück. „Das hat uns alles angekotzt“, verriet Ilge dem NDR.
Und während seine Eltern und Großeltern die Anwesenheit der Besatzungsmächte als große Schmach empfanden, machte der junge Claus-Kurt durchweg positive Erfahrungen mit den Amis. Alles, was aus den USA kam, faszinierte ihn: Donuts, Ice-Cream, Straßenkreuzer, Hollywood – und ganz besonders die Musik, die sich in einem einzigen Namen manifestiert: Elvis Presley.
Als Elvis 1958 als GI nach Deutschland kam, um seinen Wehrdienst anzutreten, standen die Teenager der Bundesrepublik Kopf. „Das war unser Idol, unser Vorbild, und wir haben das hautnah gehabt“, erinnert sich Ilge. Dass er dem „King“ auch bald persönlich begegnen und sogar sein persönlicher Zeitschriften-Zuträger werden sollte, ist eine andere Geschichte, die NDR-Redakteurin Ulrike Bosse in ihrem Beitrag „Rock me!: Rock’n’Roll wird zum Soundtrack einer Generation“ erzählt.
Dass die Faszination für diesen Soundtrack bis heute anhält, zeigt unter anderem die Existenz von The Baseballs. Seit 2007 hat sich die Band voll und ganz dem Rock’n’Roll verschrieben, sei es mit selbst geschriebenen Songs oder den Cover-Versionen weltbekannter Hits aus Pop, Rock und R’n’B. Seitdem haben The Baseballs ganze acht Alben veröffentlicht, mit „That’s Alright“ ist gerade ihr neuntes erschienen.
Wer sich die Mühe macht, auf die Texte hinter den prägnanten Rock’n’Roll-Rhythmen zu achten, wird feststellen, dass die Band eine gewisse Nachdenklichkeit ereilt hat. Vielleicht, weil das eben so ist, wenn man gerade die 40er-Marke im Leben überschritten hat. Vielleicht aber auch, weil Sebastian „Basti“ Rätzel und Sven „Sam“ Budja nach dem Ausscheiden ihres Gründungsmitglieds Rüdiger „Digger“ Brans nun nur noch zu zweit unterwegs sind.
Vor einigen Wochen haben wir Sam und Basti im Studio von Fotograf Stefan Hobmaier zum Interview getroffen. Im Vorfeld hatten wir ihnen versprochen, uns nicht danach zu erkundigen, wie lange das Frisieren ihrer Haarpracht dauere – denn diese Frage würde ihnen mit Abstand am häufigsten gestellt. Wir wären auch nicht auf die Idee gekommen. Immerhin geht’s im Rock‘n’Roll um Rebellion. Sogar noch heute.

»Wir haben uns die Freiheit genommen, diese bisher unbekannte Seite unserer Gefühlswelt sichtbar zu machen.«
MYP Magazine:
Sam und Basti, bei der Songauswahl auf Eurem neuen Album hat man den Eindruck, dass Ihr euch thematisch mit dem Ende eines langen Kapitels und dem Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt auseinandersetzt. Was genau verarbeitet Ihr da?
Basti:
Neuanfang ist definitiv eines der Hauptthemen. Alles andere wäre auch seltsam, immerhin sind wir nach all den Jahren nur noch zu zweit unterwegs. Unser Ziel war, uns musikalisch aus alten Fahrwassern herausbewegen, sowohl bei den gecoverten Songs als auch bei den eigenen Nummern. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen – auch, weil wir mit den vielen Facetten, die diese Retromusik hergibt, mehr gespielt haben.
Sam:
Das war etwas total Neues für uns. Früher haben wir einfach nur poppige, leichte und eingängige Rock’n’Roll-Songs geschrieben und dafür auch gerne mal auf klischeehafte Formulierungen zurückgegriffen – vielleicht sogar, um schneller ans Ziel zu kommen. Aber das ist jetzt Vergangenheit.
Bei dem neuen Album haben wir uns zum ersten Mal gefragt: Was bewegt uns eigentlich? Welche eigenen Gefühle gibt es, die wir in den Songs zum Thema machen wollen? Das hat unserer Musik bis dahin gefehlt. Es ging bei The Baseballs immer nur darum, eine gute Zeit zu haben und mit den Leuten zu feiern. Das hat sich zwar nicht geändert – unsere Shows machen nach wie vor richtig viel Spaß. Aber auch in unserem Leben gibt es immer wieder Momente, in denen nicht alles so locker, leicht und schön ist, wie es von außen scheint. Daher haben wir uns nun die Freiheit genommen, diese bisher unbekannte Seite unserer Gefühlswelt sichtbar zu machen.
MYP Magazine:
„It’s alright, it’s okay / To be sad on a summer day“
Basti:
Ja, zum Beispiel. Für uns ist es schön zu sehen, dass sich Nummern wie „Sad On A Summerday“ zu echten Fan-Lieblingen gemausert haben. Das zeigt uns: Die Leute sind bereit, auch schwere Gefühle in unserer Musik zuzulassen. Daher haben wir bei der Arbeit an dem neuen Album von Anfang an gesagt: Wir scheißen auf das Genre. Der Plan ist, erst mal gute Songs zu schreiben und ihnen dann unser typisches Rock’n’Roll-Outfit zu verpassen.

»Man könnte sagen: Wir sind eine Partyband mit Anspruch.«
MYP Magazine:
Viele der 13 Album-Tracks haben auf der lyrischen Eben ein eher ernsteres Anliegen: „As It Was“ von Harry Styles zu Beispiel behandelt Themen wie Einsamkeit und Depression. Und in „About Damn Time“ von Lizzo geht es um die Bewältigung einer schweren Lebensphase. Worin liegt für Euch der Reiz, diese inhaltliche Ernsthaftigkeit mit energetischer Rock’n’Roll-Musik zu verbinden?
Basti:
Ich fand diese Dualität in der Musik schon immer spannend. Und wenn ich selbst derjenige sein darf, der sie erschafft: umso besser! Eines meiner Lieblingsbeispiele ist „Chasing Cars“ von Snow Patrol – eine hochemotionale, tiefsinnige Ballade, die wir 2010 gecovert hatten. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht, die musikalische Persönlichkeit des Songs komplett zu drehen, dabei aber die inhaltliche Aussage nicht anzutasten.
Sam:
Es scheint in der Popwelt ohnehin gerade ein Trend zu sein, dieses Spannungsfeld zu erzeugen.
Basti:
Stimmt. Es gibt Songs von Harry Styles oder Taylor Swift, die sich beim ersten Hören einfach nur nach gefälligem Pop anfühlen. Aber wenn man auf die Lyrics achtet, merkt man, dass da schon ein bisschen mehr dahintersteckt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum solche Künstler*innen vielleicht ein kleines bisschen erfolgreicher sind als andere – weil da am Ende etwas bleibt. Und weil darin sowohl diejenigen etwas finden, die einfach nur gefällige Popmusik hören wollen, als auch die Leute, die mehr Inhalt brauchen. Und diese Spannweite findet man auch bei The Baseballs. Man könnte sagen: Wir sind eine Partyband mit Anspruch.
»Als Ostdeutscher hat man gelernt, Texte anders zu hören.«
MYP Magazine:
Wie gelingt Euch dieser Spagat?
Sam:
Die Herausforderung ist, nicht verkopft zu klingen. Auch wenn ein Song inhaltlich ziemlich in die Tiefe geht, ist es wichtig, dass er trotzdem nicht die Leichtigkeit verliert, die für die Musik der Fünfziger- und Sechzigerjahre so charakteristisch ist…
Basti:
… wobei auch in jener vermeintlichen Leichtigkeit immer wieder Themen wie Rassismus oder Diskriminierung behandelt wurden. Allerdings ist das kaum mehr wahrnehmbar, da die Sprache von damals heute eher niedlich und harmlos wirkt – wie übrigens bei der Musik in der DDR. Ich persönlich bin ja ostsozialisiert und erinnere mich noch gut daran, dass die Künstler*innen damals eine ganz eigene Lyrik für ihre Songtexte entwickelt hatten. Die war so blumig, dass man keine problematischen oder besser gesagt regimekritischen Stellen identifizieren konnte. Aber als Ostdeutscher hat man gelernt, Texte anders zu hören und die darin versteckte Kritik zu identifizieren.

»Ich dachte, was ist das denn für ein dummer Reim, den ich da so halb im Ohr hatte?«
MYP Magazine:
Lernt man einen Song von einer anderen Seite kennen, wenn man versucht, daraus ein Cover zu machen?
Basti:
Eindeutig ja. „Cruel Summer“ von Taylor Swift zum Beispiel war ein Song, den ich immer wieder irgendwo im Radio gehört hatte und bei dem ich instinktiv dachte, dass er sich gut für ein Cover eignen würde. Aber inhaltlich hatte ich mich nie damit auseinandergesetzt, ganz im Gegenteil. Ich fragte mich eher, was ist das für ein dummer Reim, den ich da so halb im Ohr hatte? „And it’s new, the shape of your body, it’s blue” – damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Erst beim Covern habe ich bemerkt, dass der Satz in der nächsten Zeile fortgesetzt wird: „It‘s blue / The feeling I’ve got“. Das ist richtig smart gemacht!
Sam:
Ja, oder „Unwritten“ von Natasha Bedingfield. Auch das ist so ein typischer Radio-Song, bei dem man erst in der Cover-Arbeit merkt, wie genial er komponiert, arrangiert und produziert ist.
»Aus einem Stück, in dem Eric Clapton den Tod seines vierjährigen Sohnes verarbeitet, kann ich einfach keine happy Rock’n’Roll-Ballade machen.«
MYP Magazine:
Gibt es Songs, die Ihr nicht covern würdet?
Sam:
Ich antworte mal aus einer anderen Perspektive: Es gibt für uns im Grunde nur zwei Anforderungen, die ein Song erfüllen muss, damit wir ihn uns vornehmen: Erstens muss er sich aus musikalischer Sicht eignen. Und zweitens muss das Ganze moralisch vertretbar sein.
Basti:
Daher würde ich zum Beispiel einen Song wie „Tears in Heaven“ nie für ein Cover in Betracht ziehen. Aus einem Stück, in dem Eric Clapton den Tod seines vierjährigen Sohnes verarbeitet, kann ich einfach keine happy Rock’n’Roll-Ballade machen.
Sam:
Aber davon abgesehen gibt es für uns keine Beschränkungen. Und je weiter weg der Musikstil eines Originalsongs vom Fünfzigerjahre-Rock’n‘Roll ist, desto interessanter wird es für uns. Das klappt natürlich nicht immer – wir haben uns in der Vergangenheit schon oft den Kopf verrenkt und es am Ende doch nicht geschafft, ein brauchbares Cover zu bauen.

»Es gibt den einen oder anderen Artist, bei dem man sich denkt: Och nee, der ist echt so cheesy, das können wir nicht machen.«
MYP Magazine:
Wir hatten hier im Studio vor Kurzem die österreichische Band Wanda zu Gast. Im Interview verriet uns der Sänger Marco:
„Kurz bevor wir ins Studio gegangen sind, hing ich in einer sehr komischen und wilden Harry-Styles-Phase fest. Ich war regelrecht besessen von ihm und wollte sogar kurz mal er sein. Seine Musik hat irgendwie auf mich abgefärbt und ich habe ein bisschen was Unreines mit in die Probe gebracht.“
Hattet Ihr in der Vergangenheit auch mal eine Fanboy-Phase, in der Ihr „ein bisschen was Unreines in die Probe gebracht“ habt? Immerhin findet sich auch auf Eurem neuen Album ein Harry-Styles-Cover.
Sam:
Wir sind die reinste Band der Welt! Aber im Ernst: Es gibt schon den einen oder anderen Artist, bei dem man sich denkt: Och nee, der ist echt so cheesy, das können wir nicht machen.
MYP Magazine:
Zum Beispiel?
Sam:
David Hasselhoff. Als im Proberaum irgendwann mal der Vorschlag aufkam, „Looking for Freedom“ zu covern, haben alle ganz tief Luft geholt. Klar, die Nummer kennt man und hat sie sofort im Ohr. Und durch Baywatch und Knight Rider ist David Hasselhoff auch so etwas wie ein Hero der Achtziger und Neunziger. Aber zwischenzeitlich war er doch ziemlich in den Trash-Bereich abgedriftet, bevor er dann zum Kult wurde.



»Bei vielen Songs muss man erst mal die Kitschfassade einreißen, bevor man sich ans Covern macht.«
MYP Magazine:
Immerhin hat David Hasselhoff nach eigenen Angaben die Berliner Mauer niedergesungen.
Sam: (lacht)
Genau. David Hasselhoff ist heute Kult. Aber ein Kult, der aus Kitsch hervorgegangen ist. Daher waren wir am Anfang eher skeptisch und hatten das Gefühl, dass ein Cover vielleicht noch viel trashiger werden könnte. Aber nach einigem Hin und Her haben wir uns dazu durchgerungen und aus dem Song eine richtig geile Gospel-Variante gemacht. Und siehe da: Die Leute kamen nach den Shows zu uns und sagten, unsere Version hätten sie viel, viel besser und anspruchsvoller gefunden als das Original.
Basti:
Eine Nummer, die wir eigentlich auch immer mal machen wollten, ist „Wrecking Ball“ von Miley Cyrus. Durch das Video mit der Abrisskugel wirkt das Ganze zwar ebenfalls echt cheesy, aber wenn man den Aspekt mal beiseiteschiebt, stellt man fest, was für ein geniales Lied das ist. Bei vielen Songs muss man eben erst mal die Kitschfassade einreißen, bevor man sich ans Covern macht.
»Ich fände es äußerst problematisch, wenn wir als Band versuchen würden, uns diese Frauenpower anzueignen.«
MYP Magazine:
Vielleicht passt „Flowers“ von Miley Cyrus ja noch besser zu Euch.
Basti:
Diese Idee stand auch mal kurz im Raum. Aber ich habe mich ganz klar dagegen ausgesprochen. Ich finde, der Song funktioniert nur aus der Perspektive einer Frau – und ich meine damit nicht die Frage, ob sich ein Mann selbst Blumen kaufen kann. In dem Lied geht es um weibliche Selbstermächtigung und Frauenpower. Wenn da jetzt schon wieder zwei Männer um die Ecke kämen, und dann noch mit Tolle, würde das ein Image befördern, das aus wirklich anderen Zeiten stammt – und da auch hingehört. Ich fände es äußerst problematisch, wenn wir als Band versuchen würden, uns diese Frauenpower anzueignen.

»Als Sam vor Kurzem 40 wurde, habe ich gesagt: Wir sind jetzt offiziell eine Altherrenband.«
MYP Magazine:
Während Ihr mit Euren letzten beiden Alben hauptsächlich Hits der Achtziger und Neunziger gecovert habt, schaut Ihr mit der neuen Platte vor allem auf die Nuller- und Zehnerjahre zurück. Der Song „Whole Again” von Atomic Kitten zum Beispiel wurde im Jahr 2000 veröffentlicht – das ist jetzt fast ein Vierteljahrhundert her. Mit welchen Nostalgiegefühlen blickt Ihr auf diese Zeit zurück?
Basti:
Im Jahr 2000 war ich zarte 17 und hauptsächlich damit beschäftigt, erwachsen zu werden. Wie lange das zurückliegt, habe ich erst neulich wieder bemerkt, als ich in einem Berliner Club stand. Es lief Musik der Neunziger- und Nullerjahre und ich war erstaunt, dass die 20-Jährigen um mich herum darauf so abgingen. Im ersten Moment dachte ich: Geil, die feiern die gleiche Musik wie ich. Aber dann habe ich bemerkt, dass ich auf einer Oldies-Party. Das war in etwa so, als hätten wir damals als Teenager zu Abba getanzt.
Sam:
Auch für mich waren die frühen Nullerjahre eine wahnsinnig aufregende Zeit. Ich war 18, hatte eine eigene Band und kam zum ersten Mal mit einem Leben in Berührung, in dem man als Musiker permanent unterwegs ist.
Basti:
Als Sam vor Kurzem 40 wurde, habe ich gesagt: Wir sind jetzt offiziell eine Altherrenband. 2007, also mit Mitte 20, haben wir als Boyband angefangen und zwei Jahre später unser erstes Album veröffentlicht. Das heißt, 2024 feiern wir 15 Jahre Albumdebüt – 15 Jahre, das ist echt ein Brett in unserem Business.
Sam:
Hätte man uns damals gesagt, dass wir 15 Jahre später immer noch Alben veröffentlichen und Shows spielen würden, hätten wir das nicht geglaubt. Es hätte uns auch in der Branche niemand zugetraut. Die Leute hatten uns maximal drei Jahre gegeben. Und jetzt gehören wir schon fast zum alten Eisen – das aber kein bisschen rostet.

»Erwachsen zu sein heißt für uns, wirklich alles selbst zu machen und nicht mehr auf andere angewiesen zu sein.«
MYP Magazine:
Manchmal macht man ohnehin die beste Musik, wenn man erwachsen ist.
Basti:
Vielleicht. Erwachsen zu sein heißt für uns aber in erster Linie, wirklich alles selbst zu machen und nicht mehr auf andere angewiesen zu sein. Es gibt kein Label mehr, das uns reinredet, wir haben alles in der eigenen Hand. Das ist zwar super viel Arbeit, macht aber auch super viel Spaß. Allein deshalb bin ich der Meinung, dass „That’s Alright“ das beste Album ist, das wir je gemacht haben – auch wenn ich weiß, wie klischeehaft sich das anhört.
Sam: (lächelt)
Ich probier’s mal etwas sachlicher als Basti. Aus meiner Sicht ist die neue Platte die reifere Version unseres allerersten Baseballs-Albums – und genau das macht es für mich so aufregend. Nach all der Zeit ist es uns immer noch möglich, neue musikalische Facetten zu entdecken. Es ist uns immer noch möglich, neue Wege einzuschlagen und nicht das Gefühl zu haben, man hätte schon alles ausprobiert und erlebt.
Basti:
Ich finde, es prickelt wieder so richtig.
Sam:
Das ist das Rheuma, Basti.
Basti: (lacht)
So schlimm ist es Gott sei Dank noch nicht. Aber im Ernst: Wir spüren, dass der Funke immer noch da ist. Ich würde sagen, wir verfügen gerade über die perfekte Mischung aus Erfahrung und Neugier. Und ich hoffe, das spüren auch die Fans. Es gibt ja viele tatsächliche Altherrenbands, die seit über 40 Jahren im Geschäft sind, aber keine Freude mehr vermitteln. Wenn die Leute das Gefühl haben, die Rente wäre für eine Band die deutlich bessere Option, sollte man auch wirklich aufhören.

»Greatest Hits – so ein Titel wäre uns sicher als Arroganz ausgelegt worden.«
MYP Magazine:
Das neue Album besteht aus neun Cover-Songs und vier eigenen Nummern. Wird es in Zukunft mehr Selbstgeschriebenes von The Baseballs geben?
Sam:
Gut möglich. Bereits für dieses Album hatten wir von Anfang an das Ziel ausgegeben, mehr eigenes Material zu schreiben. Dementsprechend haben wir uns auch zuerst mit den eigenen Songs und dann erst mit den Cover-Nummern beschäftigt – denn die wollten wir natürlich nicht außer Acht lassen. Allerdings haben wir uns davon frei gemacht, uns bei der Auswahl der Lieder auf ein bestimmtes Jahrzehnt zu beschränken. Im Gegensatz zu den beiden Alben davor gab es diesmal kein Konzept.
Basti:
Wir hatten uns bei der Suche nach möglichen Coversongs schlicht und einfach die Frage gestellt: Welche großen Hits und Artists sind bisher an uns vorbeigegangen? Lustigerweise war das derselbe Ansatz wie 2007 bei unserem allerersten Album: Wir hatten auch nach den großen Hits gesucht und geschaut, ob sie sich für ein Cover eignen. Daher hatte ich vor 15 Jahren auch vorgeschlagen, unser Debütalbum „Greatest Hits“ zu nennen. Ich hätte das ganz geil gefunden – aber so ein Titel wäre uns sicher als Arroganz ausgelegt worden.

»In Skandinavien gibt es bereits einen besonderen Nährboden für das, was wir so machen.«
MYP Magazine:
In den mittlerweile 17 Jahren Eurer Bandgeschichte wart Ihr auch in den skandinavischen Ländern sehr erfolgreich. Ist Rock’n’Roll die beste Medizin gegen wenig Licht und lange Winter?
Sam:
Tatsächlich wurde uns im Laufe der Zeit immer wieder die Frage gestellt, was der Grund für den Erfolg in diesen Ländern sei. Wir hatten darauf nie eine Antwort – Rock’n’Roll als Mittel gegen die Witterungsverhältnisse wäre da zumindest eine plausible Erklärung. Wir haben das am eigenen Leib erlebt: Als wir während unserer allerersten Promophase in Finnland unterwegs waren, wurde es nie wirklich hell.
Basti:
Auf jeden Fall gibt es in Ländern wie Finnland, Schweden oder Norwegen eine lange Rock’n’Roll-Tradition, und das nicht nur, was die Musik angeht. Es gibt etliche Rock’n’Roll-Feste, man sieht auf den Straßen viele Oldtimer aus den Fünfzigern und Sechzigern und so weiter und so fort. Das heißt: In Skandinavien besteht bereits ein besonderer Nährboden für das, was wir so machen.
Sam:
Dennoch ist Rock‘n‘Roll auch außerhalb Skandinaviens ein Genre, das im positiven Sinne massenkompatibel ist. Mit dieser Musik erreicht man Menschen über alle Altersgrenzen hinweg.
Basti:
Ich erinnere mich noch gut, wie unsere damalige Plattenfirma in der Schweiz uns mitteilte, dass man es aufgegeben hätte, unsere Zielgruppe demografisch einzusortieren – denn es war schlicht nicht möglich. Von 13 bis 73 waren alle Altersklassen war alles dabei. Und das ist auch heute noch so.



»Solange es Liebe gibt auf dieser Welt, werden sich die Menschen auch mit Songs über die Liebe identifizieren.«
MYP Magazine:
Auch auf künstlerischer Seite scheint der Rock’n’Roll nicht auszusterben. Elliot James Reay und Stephen Sanchez etwa, die zu den prominentesten Gesichtern einer jungen Rock’n’Roller-Generation zählen, erreichen mit ihrer Musik allein auf TikTok Abermillionen Menschen. Stephen Sanchez erklärte uns letztes Jahr in einem Interview:
„Ich habe das Gefühl, dass die Musik der Fünfziger- und Sechzigerjahre für die Zukunft geschrieben wurde. Sie ist so zeitlos und immer noch so universell, weil sie sich auf ein Konzept stützt, zum Beispiel: Ich habe mein Herz an sie verloren. Für mich ist diese Musik so besonders, weil sie einfach ist. Sie versucht nicht, schmutzig, provokativ oder protzig zu sein. Sie ist einfach und direkt, als ob sie sagen würde: Ich habe einen Fehler gemacht und liebe dich trotzdem. In dieser Einfachheit liegt eine große Schönheit.“
Seht Ihr das ähnlich?
Sam:
Hmm… die Musik damals war schon auch sehr provokativ und aggressiv. Das nehmen wir heute nur nicht mehr so wahr, weil es mittlerweile viel mehr Genres gibt, die auf andere und oft auch lautere Art und Weise provozieren. So, wie sich Elvis Presley in den Fünfzigern zu „Tutti Frutti“ bewegt hat, war das ein handfester Skandal – weil es als sexuell anstößig galt. So ein Aufsehen schafft heute höchstens noch jemand wie Lady Gaga, wenn sie sich mit einem Kleid aus Fleischfetzen zeigt.
Basti:
Wo Stephen Sanchez allerdings einen Punkt hat, ist die Zeitlosigkeit der Themen, vor allem, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Solange es Liebe gibt auf dieser Welt, werden sich die Menschen auch mit Songs über die Liebe identifizieren.

»Was viele Leute nicht wissen: Elvis hat sich für die Gleichstellung der Schwarzen Bevölkerung eingesetzt.«
MYP Magazine:
Basti, vor Kurzem warst Du in der Late-Night-Show von Dragqueen Jurassica Parka zu Gast, die im Laufe des Abends die Bemerkung fallen ließ, dass sie Elvis Presley scheiße fände.
Sam: (lächelt)
Solche Kommentare gibt es immer wieder. Aber was viele Leute nicht wissen: Elvis war ein entschiedener Gegner der sogenannten Rassentrennung und hat sich für die Gleichstellung der Schwarzen Bevölkerung eingesetzt. Martin Luther King zum Beispiel war ein großes Vorbild für ihn. Und Little Richard, der wie viele andere Schwarze Artists von Elvis gefördert wurde, hat ihn als seinen Bruder bezeichnet.
Basti:
Interessanterweise hatte Elvis Presley selbst mit Diskriminierung zu kämpfen, und zwar ganz am Anfang seiner Karriere. Die weißen Radiosender wollten ihn nicht spielen, weil ihnen seine Stimme zu Schwarz klang. Und die Schwarzen Radios wollten ihn nicht spielen, weil er ein Weißer war.

»In den Kommentarspalten lesen wir immer wieder mal, wir würden die heutigen Realitäten nicht sehen.«
MYP Magazine:
Seid auch Ihr als Band mit bestimmten Vorurteilen konfrontiert? Immerhin seid Ihr zwei Menschen des 21. Jahrhunderts, die sich mit der Musik ihrer Großeltern beschäftigen.
Basti:
Klar, bei einigen Leuten schwingt immer ein bestimmtes Set an Vorurteilen mit, wenn sie uns sehen. Schließlich erinnern unsere Outfits an eine Zeit, die längst vergangen ist. Daraus ziehen manche den Schluss, dass wir auch in unserer Weltanschauung ein bisschen rückwärtsgewandt seien. In den Kommentarspalten lesen wir immer wieder, wir würden die heutigen Realitäten nicht sehen. Das finde ich immer besonders amüsant. Würde man sich nur ein kleines bisschen mit dem auseinandersetzen, wer wir sind und was wir tun, würde man wissen, dass wir uns schon immer sehr deutlich für Vielfalt ausgesprochen und uns gesellschaftspolitisch klar positioniert haben.


»Der Rock’n’Roll war für junge Menschen in der Bundesrepublik ein wirksames Mittel, um sich von der Kleinbürgerlichkeit ihrer Eltern abzugrenzen.«
MYP Magazine:
Vor wenigen Monaten haben wir in Deutschland 75 Jahre Grundgesetz gefeiert. Was viele nicht wissen: In der noch jungen Bundesrepublik hatte Rock’n’Roll aus den USA eine ganz besondere Bedeutung – er war die Musik einer jungen Generation, die sich nach Aufbruch und Freiheit sehnte und die sich von ihren Eltern lossagen wollte. Wie stellt Ihr euch diese Zeit und die damaligen Lebensumstände vor? Hat der Rock’n’Roll aus Eurer Sicht eine Revision verdient?
Basti:
Rock’n’Roll war damals der Soundtrack der Jugend. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen: Diese Musik hat in den Fünfzigern dafür gesorgt, dass Jugendliche zum ersten Mal überhaupt als eigene Gruppe innerhalb der Gesellschaft wahrgenommen wurden. Und da die Bundesrepublik damals stellenweise konservativer war als zum Ende der Weimarer Republik, war der Rock’n’Roll für junge Menschen ein wirksames Mittel, um sich von der Kleinbürgerlichkeit ihrer Eltern abzugrenzen. Die Jahre nach 1949 waren in Deutschland spießig, miefig und strukturell sehr autoritär – auch, weil in den Gerichten, Lehrerzimmern und Parlamenten immer noch etliche Altnazis saßen. In diesem erzkonservativen Umfeld hat der Rock’n‘Roll für erste Erschütterungen und Freiheitsbewegungen gesorgt, und das lange vor den Achtundsechzigern.

»Wir sind ein Stück weit der Beweis dafür, dass dieser Musikstil nie an Relevanz verloren hat.«
MYP Magazine:
Aber dann passierte das, was immer passiert im Kapitalismus.
Basti: (lächelt)
Stimmt. Es hat nicht lange gedauert, bis man erkannt hat: Junge Menschen – das ist ja eine Zielgruppe, mit der man Geld verdienen kann! Und so wurde der Rock’n’Roll relativ schnell weichgespült und in den Sechzigern sogar eingeschlagert. Das schmälert aber nicht seine gesellschaftspolitischen Verdienste.
Sam:
Ja, aber auch aus musikalischer Sicht kann man ihn als die Basis von allem betrachten, was sich daraus über die folgenden Jahrzehnte entwickelt hat. Die Rolling Stones oder die Beatles zum Beispiel wären ohne den Rock’n’Roll nicht denkbar gewesen. Oder Elton John, der zwar eher im Bereich Disco-Pop angesiedelt ist, aber in dessen Klavierspiel man deutlich Rock’n’Roll-Elemente erkennen kann. Der Einfluss dieser Musik reicht bis in die Gegenwart und wird auch noch in Zukunft Künstler*innen inspirieren.
Basti:
Auch wir sind ja ein Stück weit der Beweis dafür, dass dieser Musikstil nie an Relevanz verloren hat. Überhaupt gab es in den letzten 70 Jahren nie einen Punkt, an dem man hätte sagen können: Rock’n‘Roll interessiert keinen. Das ist auch der Grund, warum diese Musik nach wie vor gemacht und gehört wird, siehe Stephen Sanchez.

»In meinem Kopf schwirrte immer der Gedanke herum, mein Schwulsein könnte unser Image als Rock’n‘Roll-Band beschädigen.«
MYP Magazine:
Was in den letzten 70 Jahren allerdings die meiste Zeit undenkbar gewesen wäre: als Person des öffentlichen Lebens zu Gast in der Late-Night-Show einer Dragqueen zu sein. Gab es in der Geschichte Eurer Band Momente, in denen Bastis Homosexualität als problematisch angesehen wurde?
Basti:
Ja, die gab es tatsächlich, und zwar ganz am Anfang. Nachdem die Leute von unserem ersten Management erfahren hatten, dass ich schwul bin, riefen sie ganz hektisch bei der Plattenfirma an und fragten: „Wir haben hier ein Problem, was machen wir jetzt?“ Für unser damaliges Management schien das ein echter Supergau zu sein. Bei einem anderen Act, für den einer der Manager mal mitverantwortlich war, hatte man aus diesem Grund sogar ein Bandmitglied ausgetauscht.
Sam:
Gott sei Dank hat unsere Plattenfirma total cool reagiert. Sie verstanden das „Problem“ einfach nicht.
Basti:
Trotzdem hat das Ganze bei mir ein bisschen nachgewirkt. Nicht, dass ich meine Sexualität danach versteckt hätte. Aber ich habe sie bewusst nicht zum Thema gemacht hat. In meinem Kopf schwirrte immer der Gedanke herum, mein Schwulsein könnte unser Image als „kernig-maskuline“ Rock’n‘Roll-Band in irgendeiner Form beschädigen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich okay damit war und dachte: scheiß drauf, ich rede jetzt ganz offen darüber. Dabei habe ich festgestellt: Wenn man sich öffnet, macht das alles nicht nur realistischer, es kommen plötzlich auch ganz andere Leute auf einen zu. Denn auch Queers hören Rock’n’Roll – wär hätte es gedacht.


»Ich wollte ein Zeichen setzen und dafür werben, trotz Putins Politik im Gespräch zu bleiben und sich vor allem über den Kulturbereich weiter auszutauschen.«
MYP Magazine:
Basti, Du hast in der Show von Jurassica Parka auch über das Thema Russland gesprochen, wo Ihr im Laufe der Jahre immer wieder aufgetreten seid.
Basti:
Als wir 2014 in auf Russland-Tour waren, habe ich mich auf dem Roten Platz in Moskau mit einem T-Shirt fotografieren lassen, das mit dem lateinischen Wort „Homo“ und dem kyrillischen Begirff für „Propaganda“ bedruckt war. Dieses Foto habe ich dann auf Social Media gepostet – mit dem Hinweis „From Russia with love“. Ich wollte einfach nur ein Zeichen setzen und dafür werben, trotz Putins Politik im Gespräch zu bleiben und sich vor allem über den Kulturbereich weiter auszutauschen. Mit der Vehemenz der Reaktionen auf dieses Posting hatte ich nicht gerechnet.
MYP Magazine:
Inwiefern?
Basti:
Während manche darüber diskutierten, ob das jetzt eher ein Coming-out oder doch ein politisches Statement gewesen sei, signalisierten uns die russischen Fans, wie wichtig und wertvoll dieser Post für sie gewesen war – denn er machte nicht nur die Lage speziell von queeren Menschen in Russland sichtbar, sondern auch ganz allgemein die Situation all jener, die sich gegen das immer autokratischer werdende Regime stellen. Heutzutage wäre so eine Aktion viel zu gefährlich – nicht nur für mich, sondern auch für alle, die in Russland so einen Post liken würden.

»Es würde uns nicht schaden, wenn wir alle mal eine Woche Social-Media-frei machen würden.«
MYP Magazine:
Auch in Deutschland gerät die Demokratie zunehmend in Gefahr, insbesondere mit dem Erstarken einer in Teilen gesichert rechtsextremen Partei wie der AfD. Wie blickt Ihr auf die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land?
Sam:
Dass sich unsere Gesellschaft gerade so entwickelt, macht mir große Sorgen. Allein schon, weil ich den Eindruck habe, dass viele Menschen gar nicht mehr bereit sind, miteinander in Austausch zu gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer schwieriger wird, bestimmte Leute in einem normalen Gespräch zu erreichen.
Basti:
Dieses fehlende Verständnis füreinander macht auch mir am meisten Sorgen. Dazu kommt dieses Missverständnis von Meinungsfreiheit. Immer mehr Leute sind der Auffassung, Meinungsfreiheit würde bedeuten, dass ihre eigene Meinung unwidersprochen bleiben müsse. Dass aber bereits darin die Begrenzung der Meinungsfreiheit von anderen liegt, die natürlich ihre Gegenmeinung äußern dürfen, geht ihnen nicht in den Kopf. Wo soll denn da der Austausch stattfinden?
Sam:
Die Stimmung ist so aufgeheizt, dass es uns nicht schaden würde, wenn wir alle mal eine Woche Social-Media-frei machen würden.


»Bei unseren Konzerten kommen immer so unterschiedliche Menschen zusammen, dass man meinen könnte, es wäre Europameisterschaft.«
MYP Magazine:
Vielleicht müssten die Leute öfter mal ein Baseballs-Konzert besuchen.
Basti:
Ja, tatsächlich. Bei unseren Konzerten kommen immer so unterschiedliche Menschen zusammen, dass man meinen könnte, es wäre Europameisterschaft: eine bunte, glückliche Gemeinschaft von Leuten, die ein gemeinsames Erlebnis genießen wollen. In dem Zusammenhang fand ich auch das Statement von Julian Nagelsmann so erfrischend, der sagte: Leute, lasst doch mal weniger meckern und uns einfach an dem erfreuen, was wir haben! Lasst doch mal mehr miteinander statt gegeneinander denken!
Sam:
Musik ist die universellste Sprache, die es gibt. Die versteht jeder, ganz egal, woher man kommt, wie man aussieht, wen man liebt oder woran man glaubt.

»Für viele Dreierkombos bedeutet das Ausscheiden eines Bandmitglieds das sichere Ende.«
MYP Magazine:
Ihr sprecht die Sprache der Musik seit mittlerweile 17 Jahren. Was habt Ihr euch für die nächsten 17 Jahre vorgenommen? Ist die Geschichte der Baseballs erst dann auserzählt, wenn Ihr nur noch eigene Songs schreibt und von anderen gecovert werdet?
Sam: (lächelt)
Sollte es irgendwann eine Baseballs-Tribute-Coverband geben, haben wir’s wirklich geschafft.
Basti:
Wir haben gar nicht das große Ziel. Wir wollen einfach weiter erfolgreich sein, auf Tour gehen und den Leuten eine gute Zeit bescheren. Wenn wir das in 17 Jahren noch mit der gleichen Freude, dem gleichen Elan und der gleichen Neugier machen können, bin ich mehr als happy. Um es mit den Worten von Natasha Bedingfield zu sagen: „The rest is still unwritten.“
Sam:
Man muss auch immer bedenken: Für viele Dreierkombos bedeutet das Ausscheiden eines Bandmitglieds das sichere Ende. Aber Basti und ich haben so viel Spaß an der Sache und hängen so sehr mit dem Herzen daran, dass wir gesagt haben: Das kann es nicht gewesen sein. Es gibt noch so viel, was wir mit dieser Band tun möchten. Es gibt etliche Bühnen auf dieser Welt, die wir noch nicht bespielt haben. Und den amerikanischen Markt haben wir auch noch nicht geknackt.
Basti:
Robbie Williams auch nicht. Vielleicht versuchen wir mal was mit ihm zusammen.
Sam:
Wir können ihn ja mitnehmen… als Vorband.

Mehr von und über The Baseballs:
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Stefan Hobmaier
Alfie Templeman
Interview — Alfie Templeman
»Mich inspirieren Menschen, die sich mit der Welt auseinandersetzen«
»Radiosoul«, das dritte Studioalbum von Alfie Templeman, ist genau das Richtige, wenn über einem dunkle Wolken aufziehen – eine große Portion Funk und Soul, die vor allem mit ihren komplexen Arrangements besticht. Entstanden ist die Platte aus den persönlichen Tiefen heraus, die der 21-jährige Multi-Instrumentalist, Songwriter und Produzent in den letzten Jahren durchlebt hat. Ein Interview über musikalische Freiräume auf dem Dorf, die Macht von Algorithmen und die Frage, ob man seine Probleme in einer Tupperbox frischhalten sollte.
31. August 2024 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Roberto Brundo

Es gibt Momente im Leben, da hängt man emotional ziemlich in den Seilen. Waschmaschine kaputt, Beziehung auch, und weder draußen vor der Tür noch drinnen im Herzen will sich richtig Sommer einstellen. Was also tun gegen den bleiernen Blues?
Am besten eine große Portion Eis! Oder noch besser: eine große Portion Funk und Soul, wie sie etwa auf dem neuen Album von Alfie Templeman serviert wird. Kein Scherz. Denn in „Radiosoul“, dem mittlerweile dritten Studioalbum des 21-jährigen Multitalents aus London, steckt so viel musikalische Energie und Lebensfreude, dass man gar nicht anders kann, als mit dem Popöchen zu wackeln, die Vorhänge aufzuziehen und mal kräftig durchzulüften in der dunklen Bude.
Das Bestechende an diesem Album ist allerdings nicht die schiere Massen an verschiedenen musikalischen Elementen, sondern ihre Zusammensetzung. Zwar spielt Alfie insgesamt elf Musikinstrumente (oder zwölf, wenn man seine oft eher instrumental genutzte Stimme mitzählt). Dennoch hat er präzise darauf geachtet, nicht einfach alles in einen Topf zu werfen und daraus einen großen Pott Londoner Allerlei zu kredenzen.
Das komplexe Arrangement der insgesamt elf Songs auf „Radiosoul“ entspricht eher einem ausgeklügelten, fein abgestimmten Menü eines Sternerestaurants, bei dem sich mit jedem Gang eine kleine Geschmacksexplosion am Gaumen vollzieht. Hört sich an wie ein Werbetext? Nee, wir meinen das wirklich ernst. Hier eine kleine Kostprobe:
Aufgewachsen ist Alfie Templeman in Carlton, einem 800-Seelen-Dorf zwei Stunden nördlich von London, von wo aus er 2018 seine musikalische Karriere startete – mit Songs, die er in seinem Kinderzimmer aufnahm und die mittlerweile Abermillionen Streams auf Spotify zählen.
Doch der 21-Jährige wirkt alles andere als abgehoben, als wir ihn Ende Mai in Berlin zu einem lauschigen Interview- und Shooting-Nachmittag treffen. Nein, Alfie freut sich geradezu darüber, nicht auf der Straße erkannt zu werden, und steht den Marktmechanismen der Musikindustrie, die mittlerweile stark von den Algorithmen sozialer Netzwerke getriebenen sind, äußerst kritisch gegenüber.
Doch reden wir erst mal über das neue Album: jene große Portion Funk und Soul, mit der sich jeder emotionale Grauschleier vertreiben lässt – und die Alfie Templeman mit einem ungewöhnlichen Hinweis zur persönlichen Problembewältigung beginnen lässt.

»Mit dem Song wollte ich mir selbst für einen kurzen Moment eine Atempause verschaffen.«
MYP Magazine:
Alfie, Du eröffnest Dein neues Album mit der Zeile „I stashed my problems in a Tupperware“. Ist das eine empfehlenswerte Strategie, um mit Sorgen und Problemen umzugehen?
Alfie Templeman: (lacht)
Leider nein – auch wenn ich versuche, mir das selbst einzureden, zumindest bei dem Song „Radiosoul“, aus dem die Zeile stammt. Wie bei jedem anderen Menschen gibt es auch in meinem Leben Dinge, die mich belasten – und ich bin jemand, der immer wieder versucht, all seine Probleme beiseitezuschieben. Mit dem Song wollte ich mir selbst für einen kurzen Moment eine Atempause verschaffen. Ich wollte mich und andere ermutigen, die eigenen Probleme mal kurz in eine Tupperdose zu stecken. Aber vielleicht sollte man das auch einfach lassen. Immerhin löst man damit kein Problem, sondern verschiebt es nur – denn in so einer Box bleiben die Probleme länger frisch… höchste Zeit eigentlich, dass ich meine Tupperware öffne und mich meinen Sorgen stelle.

»Vielleicht bleibt mir beim Songschreiben gar nichts anderes übrig, als aus meiner eigenen Realität zu schöpfen.«
MYP Magazine:
In der Pressemitteilung zu dem Album heißt es, dass es Dir schwerfällt, über Deine Gefühle zu sprechen – interessanterweise ganz im Gegenteil zu Deiner Musik, denn in den elf Songs Deines neuen Albums öffnest Du dich gegenüber Dein Publikum auf eine fast radikale Art und Weise. Bist Du von dieser Ambivalenz selbst überrascht?
Alfie Templeman:
Überrascht bin ich nicht. Ich finde es eher seltsam. Wenn ich in einem Song über meine Gefühle spreche, denke ich darüber nicht wirklich nach. Es ist vielmehr eine unterbewusste Entscheidung, meine persönlichen Empfindungen zu thematisieren. Vielleicht bleibt mir beim Songschreiben aber auch gar nichts anderes übrig, als aus meiner eigenen Realität zu schöpfen. Wer weiß: Würde ich in meiner Freizeit gerne Fantasy-Romane lesen und mich von dieser Welt inspirieren lassen, würde ich meine eigenen Texte wohl viel fiktionaler gestalten.
Alfie überlegt einen Moment.
Es passiert übrigens immer wieder, dass mir Menschen davon berichten, wie meine Musik ihnen in bestimmten Phasen ihres Lebens geholfen hat. Dabei beziehen sie sich oft auf konkrete Songtexte, in denen sie ihre eigenen Gefühle gespiegelt sehen, und wollen wissen, welche persönlichen Erlebnisse ich da verarbeitet habe. In solchen Momenten habe ich fast nie eine Antwort parat – weil ich bei den allermeisten Songs vergessen habe, aus welcher Situation heraus sie entstanden sind.

»In meinen Songs gibt es nicht allzu viele Bilder. Ich schreie immer direkt heraus, wie es mir geht.«
MYP Magazine:
Wir hatten vor Kurzem ein Interview mit der österreichischen Rockband Wanda, in dem der Frontmann sagte: „Eigentlich will ich den Text (eines Songs) gar nicht so sezieren. Es handelt sich dabei immer noch um Lyrik – und die kann niemals eindeutig sein. Selbst wenn ich eine Zeile wie der Himmel ist blau in einen Song hinein schreiben würde, gäbe es da immer noch ein riesiges Spektrum an Bedeutungen.“ Sind Deine Texte inhaltlich verbindlicher?
Alfie Templeman:
Ja, auf jeden Fall! In meinen Songs gibt es nicht allzu viele Bilder. Ich schreie immer direkt heraus, wie es mir geht. Und wenn es auf den ersten Blick nicht so glasklar ist, kann man die Bedeutung einer Zeile zumindest irgendwie erahnen, denn ich beschreibe in der Regel einfach nur das, was ich fühle.
MYP Magazine:
Dein Song „Eyes Wide Shut“ wirkt wie eine letzte große Abrechnung mit der Welt. Bildet dieses Lied ebenfalls Deinen persönlichen Gefühlszustand ab?
Alfie Templeman:
Dieser Song ist während und nach meiner letzten Tour entstanden. Damals gab es immer wieder Situationen, in denen ich super beschäftigt war und sich mein Gehirn fast überreaktiv anfühlte. Dann, im nächsten Moment, war ich plötzlich irgendwo im Nirgendwo, ganz alleine und ohne irgendeine Aufgabe. Da war nur absolute Stille. Diesen Kontrast zu erleben, fand ich sehr spannend – und daraus habe ich dann einen Song gebastelt.

»Die großen Ohren sollen zeigen, wie es sich anfühlt, wenn man eine absolute Reizüberflutung erlebt.«
MYP Magazine:
In dem Video bist Du mit übergroßen Ohren zu sehen. Welche Idee steckt hinter dieser plakativen Maske?
Alfie Templeman:
Die großen Ohren sollen zeigen, wie es sich anfühlt, wenn man eine absolute Reizüberflutung erlebt, von allem um sich herum absolut überwältigt ist und einfach nur die Stille sucht.
MYP Magazine:
Interessanterweise bestehen auch die Lyrics von „Eyes Wide Shut“ aus vielen symbolträchtigen Bildern – was für Deine Musik eher ungewöhnlich ist.
Alfie Templeman:
Das liegt vor allem daran, dass ich den Song zusammen mit meinem guten Freund Justin Hayward-Young geschrieben habe. Justin hat mir nicht nur dabei geholfen, den Text zu zerhacken, sondern mir auch bei der Bildsprache unter die Arme gegriffen. Er ist wirklich gut darin, allein mit Worten besondere Bilder zu malen. Das ist etwas, was ich selbst nicht so gut kann – aber worin ich besser werden will. Ich mag Songs wie „Eyes Wide Shut“ total, weil sie aus vielen kleinen Wortfetzen zusammengesetzt sind. Das finde ich ziemlich lustig.

»Leider habe ich zunehmend das Gefühl, dass wir uns in der Musikbranche auf einen falschen Weg begeben haben.«
MYP Magazine:
Dabei hat der Song aber auch eine ernsthafte Seite, denn er nimmt eine Perspektive ein, die aktuell viele und vor allem junge Menschen verbindet: Die ganze Welt ist beschissen und es gibt keine positive Vision für die Zukunft. Gleichzeitig strotzt der Sound von „Eyes Wide Shut“ nur so vor Funk und Soul. Ist energetische Musik das einzige Mittel, mit dem man unsere Welt noch ertragen kann?
Alfie Templeman:
Eindeutig ja. Zumindest, wenn man mit Musik respektvoll umgeht und als das ansieht, was sie ist: eine Kunstform. Mich inspirieren Menschen, die sich mit der Welt auseinandersetzen, daraus eine klare Vision für ihre Musik ableiten und in ein Album transformieren. Solange es solche Menschen gibt, bleibe ich optimistisch – in Bezug auf meine eigene Zukunft, aber auch die der ganzen Welt.
Leider habe ich zunehmend das Gefühl, dass wir uns in der Musikbranche auf einen falschen Weg begeben haben. Alles wirkt immer oberflächlicher und oft hat man den Eindruck, dass soziale Medien, allen voran TikTok, mehr und mehr die Kriterien für die Entwicklung von Musik vorgeben. Das macht mich sehr traurig und beunruhigt mich auch. Umso schöner ist es daher, wenn man auf echte Künstler stößt, die der Kunst immer noch den Vorrang geben.

»Ich habe mir fest vorgenommen, mich nicht den Algorithmen zu unterwerfen.«
MYP Magazine:
Vielleicht gibt es irgendwann in der Zukunft ja mal eine Social-Media-Plattform, die sich an ganzen Musikalben und nicht an maximal 60 Sekunden langen Tracks orientiert.
Alfie Templeman:
Das wäre zu schön.
MYP Magazine:
Fühlst Du persönlich einen gewissen Druck, Musik zu kreieren, die in erster Linie den Algorithmen schmeichelt?
Alfie Templeman:
Tatsächlich wurde ich von Labels immer wieder mal gefragt, ob ich nicht einen Song für TikTok schreiben könne. Das ist heutzutage ganz normal und ich mache den Labels da auch keinen Vorwurf. Aber so etwas ist einfach nicht mein Ding. Ich habe mir fest vorgenommen, mich nicht den Algorithmen zu unterwerfen. Für mich persönlich fühlt sich das weder richtig noch natürlich an.

»Ich weiß, das klingt ein bisschen großspurig. Aber ich hatte mir tatsächlich das Ziel gesteckt, mich selbst mit meiner Musik zu begeistern.«
MYP Magazine:
Dein neues Album kommt überaus lebendig und energiegeladen daher, beim Hören wird man von Rhythmen, Melodien und komplexen Arrangements nur so überschüttet. Wie ist dieses gewaltige Stück Funk und Soul entstanden? Was genau war da in Dir, das unbedingt herauswollte?
Alfie Templeman: (lacht)
Danke für die Blumen, das Kompliment weiß ich wirklich zu schätzen. Ich hatte in den letzten Jahren immer öfter das Bedürfnis, mich mit meiner Musik in alle Genres auszubreiten. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum sich mein Sound über die Zeit sehr verändert hat. Meine erste Platte „Forever Isn’t Long Enough“ zum Beispiel entstand größtenteils während der Pandemie, ich hatte sie weitgehend selbst produziert. Diese Situation hat mich damals sehr eingeschränkt – musikalisch, inhaltlich und produktionstechnisch. Bei „Radiosoul“, meinem mittlerweile dritten Album, war es höchste Zeit, mich mit dem Sound in viele andere Richtungen zu bewegen. Ich wollte einfach ein bisschen herumexperimentieren und dabei in allen künstlerischen Entscheidungen völlig frei sein.
Klar, natürlich gibt es auf dem neuen Album immer noch klassische Indie-Pop-Songs wie „Hello Lonely“ oder „Eyes Wide Shut“, für die mich die Leute bereits kennen. Aber es finden sich darauf auch Tracks wie „Beckham“ oder „Submarine“, die wesentlich vielschichtiger sind – und bei denen es mein Anspruch war, vor allem ein besserer Musiker zu werden.
MYP Magazine:
Sehr ambitioniert!
Alfie Templeman: (lächelt)
Ich weiß, das klingt ein bisschen großspurig. Aber ich hatte mir tatsächlich das Ziel gesteckt, mich selbst mit meiner Musik zu begeistern.
Alfie macht eine kurze Pause.
Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich letztes Jahr von zu Hause ausgezogen bin. Vom kleinen Carlton in Bedfordshire ging’s ins große London, einer Stadt voller Künstler und Kreativer. Als ich dort ankam, bohrten sich mir sofort etliche Fragen in den Kopf: Wie passe ich hier rein? Wie kann ich vor mir selbst rechtfertigen, dass ich hier leben darf? Wie kann ich beweisen, dass ich als Künstler und Musiker gut genug bin, um hier dazuzugehören? Das alles hat meine Standards, die ich mir im Laufe der Jahre beim Schreiben und Aufnehmen gesetzt hatte, deutlich verändert. Die Messlatte lag plötzlich viel höher.

»Ich weiß jetzt viel besser, dass es nicht allzu viele Dinge braucht, um einen Song groß klingen zu lassen.«
MYP Magazine:
Die musikalische Komplexität Deines neuen Albums erinnert ein bisschen an ein Wimmelbild, in dem es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt – ganz so, als wärst Du vom „horror vacui“ getrieben, jenem künstlerischen Konzept, das die Leere scheut und den Wunsch beschreibt, alle weißen Flächen mit Darstellungen oder Ornamenten zu füllen. Wann weißt Du, dass das Arrangement eines Songs final ist und Du keine zusätzlichen musikalischen Elemente mehr hinzufügen musst?
Alfie Templeman:
Tatsächlich ist es mir sehr wichtig, mit einem Song nicht zu weit zu gehen. Auch wenn sich das neue Album musikalisch sehr reichhaltig anhört, habe ich während des Produktionsprozesses genau darauf geachtet, sehr vorsichtig mit zusätzlichen Klangelementen zu sein.
Ein Beispiel: Wenn man einen Song aufnimmt, teilt man die Instrumente und Effekte nach Frequenzen auf. Dabei gibt es hohe, mittlere und tiefe Frequenzen – hier finden unter anderem das Schlagzeug und der Bass statt. Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass man vermeiden sollte, zu viele Elemente in den oberen und mittleren Frequenzen miteinander kollidieren zu lassen. Soll heißen: Wenn ich etwa in den hohen Frequenzen einige prägnante Gitarrenparts habe, siedele ich dort keine Klavierelemente mehr an. Interessanterweise bedeutet dieses Vorgehen erst mal eine Einschränkung, die ich eigentlich vermeiden wollte. Aber manchmal ist weniger tatsächlich mehr: Ich kann in meinem Sound immer noch maximalistisch sein – nur weiß ich jetzt viel besser, dass es nicht allzu viele Dinge braucht, um einen Song groß klingen zu lassen.

»Auf dem Dorf konnte ich so viel Lärm machen, wie ich wollte, es hat sich nie jemand beschwert. In London wäre so etwas undenkbar.«
MYP Magazine:
Du bist im beschaulichen Carlton aufgewachsen, einem 800-Seelen-Dorf zwei Stunden nördlich von London. Welche Vorteile hat es, seine Kindheit und Jugend an einem solchen Ort zu verbringen – vor allem, wenn man Berufsmusiker werden will?
Alfie Templeman:
Für mich als Teenager war Carlton großartig, ich hatte dort die Möglichkeit, mich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren. Wäre ich in einer Stadt wie London großgeworden, wäre ich wahrscheinlich permanent von anderen Dingen abgelenkt gewesen – und vielleicht mit 13 schon zum Vollalkoholiker geworden. (lacht)
Aber im Ernst: Auch wenn die Gegend um Carlton ziemlich trostlos war und mir kaum etwas anderes übrig blieb, als Musik zu machen, hätte ich an jedem anderen Ort der Welt sicher nichts anderes getan. Musik war schon immer meine einzig wahre Leidenschaft, schon in meiner Kindheit. Dennoch war es natürlich hilfreich, in einem kleinen Dorf mit netten Nachbarn zu leben, die mich einfach Schlagzeug spielen ließen. Ich konnte so viel Lärm machen, wie ich wollte, es hat sich nie jemand beschwert. In London wäre so etwas undenkbar. Dort kann man nur Musik machen, wenn man ein Studio hat – einfach, weil die Umgebung so laut ist. Bei mir ging das damals im Kinderzimmer.
»Die meisten der elf Album-Tracks sind eher aus den Tiefen entstanden – und ich finde, sie gehören zu den besten Songs, die ich je geschrieben habe.«
MYP Magazine:
Es gibt auf Deinem neuen Album einen Song namens „Hello Lonely“, in dem Du singst:
Back when days were friends of mine
I killed them and I let them die slowly
Now I’m lonely
Nothin’ is forever
But forever’s always whisperin’ closely
“Hello, lonely”
Der österreichische Dichter Rainer Maria Rilke beschrieb einmal in einem seiner Bücher, dass man als Künstler die Einsamkeit suchen müsse. Er sagte: „Es ist gut, einsam zu sein, denn einsam zu sein ist schwer; die Tatsache, dass etwas schwer ist, muss für uns ein umso größerer Grund sein, es zu tun.“ Ist das ein Gedanke, in dem Du dich persönlich wiederfindest?
Alfie Templeman:
Einsamkeit ist ein notwendiges Übel – zumindest manchmal. Sie ist Segen und Fluch zugleich. Im Laufe der Jahre habe ich immer wieder bemerkt, dass mir genau dann die besten Songs gelingen, wenn ich mich selbst zu 100 Prozent miteinbeziehe. Und das fällt mir am leichtesten, wenn ich besonders traurig bin und viel Schmerz empfinde. Das wirkt wie ein Katalysator… aber ist das in der Kunst nicht immer so?
In den insgesamt zwei Jahren, in denen ich an dem Album geschrieben habe, gab es in meinem Leben viele Höhen und Tiefen. Die meisten der elf Tracks sind eher aus den Tiefen entstanden – und ich finde, sie gehören zu den besten Songs, die ich je geschrieben habe.

»In diesem Alter verändert man sich in der Regel sehr – ich persönlich hatte das Gefühl, mich jeden einzelnen Monat zu verändern. Das ist auf zwei Jahre gerechnet ein ganz schönes Chaos.«
MYP Magazine:
Interessanterweise hat man das Gefühl, dass die schwermütigen Songs vor allem in den ersten beiden Dritteln des Albums zu finden sind. Ab „Submarine“ scheint die neue Platte sukzessive optimistischer, zuversichtlicher und glücklicher zu werden. Entspricht diese Dramaturgie auch Deiner persönlichen Reise und Entwicklung in der Realität?
Alfie Templeman:
Auf jeden Fall. Auch wenn ich die meisten Tracks zwischen Februar und Juni letzten Jahres aufgenommen habe, gehen einige Lieder bis ins Jahr 2022 zurück. Das bedeutet: Ich war 19, als ich mit dem Schreiben anfing, und fast 21, als ich alles zusammen hatte. In diesem Alter verändert man sich in der Regel sehr – ich persönlich hatte das Gefühl, mich jeden einzelnen Monat zu verändern. Das ist auf zwei Jahre gerechnet ein ganz schönes Chaos. (lächelt)
Ich habe zwar vorher nie darüber nachgedacht, aber es scheint in der Tat so zu sein, dass ich gegen Ende des Albums optimistischer werde. Die letzten vier Tracks wirken im Vergleich zum Rest eher hoffnungsvoll. „Run to Tomorrow“, das letzte Stück auf der Platte, ist ein durchweg positiver Song. Aber auch „Switch“, in dem es darum geht, eine kalte Dusche zu nehmen, sein Gehirn zu aktivieren und zu versuchen, seinen Scheiß endlich auf die Reihe zu bekommen.
„Submarine“ wiederum handelt davon, wie ich von einer Tour nach Hause komme, um meine Freundin endlich mal wiederzusehen. Da sie sich sehr für Meeresbiologie interessiert, erzähle ich in dem Song, wie ich mit einem U-Boot aus Amerika zu ihr zurückkomme – statt ganz konventionell mit dem Flugzeug.
»2018 habe ich meine erste Single veröffentlicht und seitdem drei Alben gemacht. Ich finde, das ist noch lange kein Grund, warum mich jemand auf der Straße erkennen sollte.«
MYP Magazine:
Den vierten Songs dieses letzten Albumdrittels hast Du dem Fußballer David Beckham gewidmet. Zu Beckhams Biografie gehört: Je erfolgreicher er während seiner aktiven Karriere wurde, desto größer wurden auch der Erfolgsdruck und die Erwartungen, die an ihn gestellt wurden. Ist das etwas, das Du in ähnlicher Form auch erlebt hast? Schließlich hast Du mit Deiner Musik bereits in jungen Jahren sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit erhalten.
Alfie Templeman:
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ehrlicherweise fühlt es sich für mich auch gar nicht so an, als ob ich erfolgreich wäre. Ich fühle mich auch nicht in irgendeiner Form berühmt – einfach, weil ich es nicht bin. Ganz im Gegenteil: Ich bin immer wieder völlig überwältigt, wenn die Leute zu meinen Auftritten kommen. 2018 habe ich meine erste Single veröffentlicht und seitdem drei Alben gemacht. Ich finde, das ist noch lange kein Grund, warum mich jemand auf der Straße erkennen sollte – und das ist großartig! Dementsprechend habe ich auch nicht das Gefühl, dass es viele Erwartungen an mich gibt. Ich habe eine relativ kleine, aber tolle Fangemeinde, die es zu mögen scheint, dass ich einfach nur ein bisschen herumspiele und mich musikalisch immer wieder verändere.


»Es geht mir nur darum, als Künstler ein gutes Gesamtwerk zu schaffen.«
MYP Magazine:
Hast Du für Dich persönlich eine Definition von Erfolg?
Alfie Templeman: (lacht)
Na, auf jeden Fall keine kapitalistische. Es geht mir nur darum, als Künstler ein gutes Gesamtwerk zu schaffen – etwas, worauf ich stolz bin, wenn ich in ein paar Jahren darauf zurückblicke. Ich will einfach nur Songs schreiben, die mich selbst begeistern und mich musikalisch herausfordern; Songs, die mich selbst so weit pushen, dass ich gezwungen bin, so viele Instrumente wie möglich zu lernen, um eine gute Ein-Mann-Band zu werden. Alles andere ist mir egal.

»Hin und wieder ist es nicht die schlechteste Idee, einfach etwas Verrücktes zu tun. Manchmal bringt das die großartigsten Ergebnisse hervor.«
MYP Magazine:
Kommen wir zum Schluss noch mal kurz auf „Radiosoul“ zurück, den ersten Song des neuen Albums. Im Refrain singst Du:
‘Cause I’ve been running the red lights like it’s the beginning
And the radio stays on while nobody listens
Ist es wirklich ein gutes Vorbild, bei Rot über die Ampel zu fahren?
Alfie Templeman:
Ich weiß, das ist sehr gefährlich. Aber dieses Bild hat mich irgendwie gepackt – vielleicht auch deshalb, weil ich selbst ein eher schlechter Autofahrer bin und schon ein paar Mal aus Versehen über eine rote Ampel gefahren bin.
Im Song will ich mit dem Bild sagen: Wenn ich eine rote Ampel überfahre, dann nur, weil ich in dem Moment nicht wirklich über mein Leben nachdenke. Ich stelle mein Handeln nicht in Frage, hänge nicht in der Vergangenheit fest und bewege mich per Autopilot stoisch nach vorne.
Davon abgesehen bin ich aber der Meinung, dass es hin und wieder nicht die schlechteste Idee ist, einfach etwas Verrücktes zu tun. Manchmal bringt das die großartigsten Ergebnisse hervor. Wie zum Beispiel bei meinem neuen Album. Da ging es letztendlich nur darum, ein bisschen herumzualbern und neue Dinge auszuprobieren, ohne sich darum zu kümmern, ob sie schiefgehen könnten. Denn was wäre das maximal Schlimmste gewesen, was hätte passieren können? Genau: das Album einfach nicht zu veröffentlichen. Mehr nicht.
MYP Magazine:
Über eine rote Ampel zu fahren, wirkt zumindest auf dem Dorf wie eine kleine Rebellion, die man sich hin und wieder erlauben kann – zumindest, wenn weit und breit kein anderes Auto zu sehen ist.
Alfie Templeman:
Stimmt. Und es wäre doch auch ein viel schlechteres Vorbild, wenn ich singen würde:
(singt in der Melodie des „Radiosoul“-Refrains)
„I’ve been robbing a baaank“
Da ist die rote Ampel auf dem Dorf doch viel harmloser.

Mehr von und über Alfie Templeman:
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Roberto Brundo
Philipp Oehmke
Interview — Philipp Oehmke
»Literatur kann da helfen, wo Journalismus nicht mehr weiterkommt«
Als Kulturressort-Leiter beim SPIEGEL analysierte Philipp Oehmke das Verschwinden von Kate Middleton, fasste die Row-Zero-Kontroverse um Rammstein zusammen oder ging mit Pete Doherty in der Normandie im Meer schwimmen. In seinem Debütroman »Schönwald« seziert er eine deutsche Familie und geht der Frage nach, wie unsere demokratische Gesellschaft zwischen Widersprüchlichkeiten und Wahrheitsfindung überleben kann.
13. August 2024 — Interview & Text: Katharina Viktoria Weiß, Fotografie: Roberto Brundo

Als Familie Schönwald die Eröffnung ihres Buchladens feiern will, wird sie von einer Farbbombe überrascht – und dem Vorwurf, „Menschen mit Nazihintergrund“ zu sein. Philipp Oehmkes Buch „Schönwald“, erschienenen im vergangenen Herbst, beginnt mit einer Szene, die von der Realität abgekupfert ist: 2021 hatten Aktivisten der Betreiberin der queerfeministischen Buchhandlung „She said“ in Berlin-Neukölln vorgeworfen, ihren Laden mit dem Erbe eines zu Zeiten des Nationalsozialismus erwirtschafteten Vermögens finanziert zu haben.
Von diesem Ereignis aus entspannt sich ein mächtiger Familienroman, der es aufgrund seines pointierten Humors schafft, die verschiedenen Generationen, politischen Haltungen und Lebensstile der Figuren elegant aufeinanderprallen zu lassen, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Dabei gelingt es Philipp Oehmke immer wieder, in seinen Lesern ein mächtiges Gefühl der Identifikation herauszukitzeln.

Doch nicht nur in seinem Buch, auch in seinen journalistischen Artikeln geht es dem Leiter des SPIEGEL-Kulturressorts zumeist um das Gruppengefühl: Er schreibt darüber, warum wir aus Prinzessin Dianas Tod nicht gelernt haben, wie mit dem Blick auf die BRD-Erfahrungen mit der RAF seltsam verklärte Gefühle entwickeln oder befasst sich mit Phänomenen wie Ex-Skandalmusiker Pete Doherty, Pop-Guru Rick Rubin oder Hochstaplerin Anna Sorokin.
Der 1974 geborene Autor wirkt dabei in seinem Schreibstil seltsam alterslos. Nur ein Detail in „Schönwald“ liefert einen Hinweis auf die Generation, aus der er stammt: Chris, der älteste Schönwald-Sohn. Er ist im selben Alter wie Philipp Oehmke und Professor für Literaturwissenschaft in New York. Auch Oehmke lebte und studierte viele Jahre ebendort – und hat sich doch für einen anderen Berufsweg entschieden. Zwar sind seine ausformulierten Meinungsartikel manchmal streitbar, aber er bemüht sich, die Welt stets in ihrer Komplexität zu betrachten. Der fiktionale Chris hingegen ist bei den Wilden, den Rechten, den Make-America-Great-Again-Djangos mit ihren simplen Populismus-Thesen gelandet.

»Die Bösen verkörpern das, was Punk mal war: provokant und im ständigen No-Go-Bereich.«
Katharina Viktoria Weiß:
Der Charakter Chris Schönwald ist nicht nur in Deinem Alter, sondern hat genau wie Du auch in New York gelebt. Was hat Dich gereizt, diese Figur zu zeichnen, die so ähnlich zu Deiner eigenen Biografie scheint?
Philipp Oehmke:
Chris sieht mir von außen vielleicht ähnlich – ist er aber nicht. Allerdings könnte man sagen, dass ich manche meiner schlechten Eigenschaften bei ihm abgeladen habe, zum Beispiel einige guilty pleasures. Jeder in der Romanfamilie hat allerdings irgendeinen Scheiß von mir. Sie sind ja alle fehlerhaft. Chris hat vielleicht am meisten abbekommen.
Katharina Viktoria Weiß:
Hattest Du bei Chris das Gefühl, dass Du dich selbst einfach mal von der dunklen Seite der Macht verführen lassen konntest?
Philipp Oehmke:
Absolut. Sein Verführer ist ja vage inspiriert von einer Figur, die es wirklich gibt: Gavin McInnes, Gründer des VICE-Magazins und mittlerweile ein Trump-Verfechter, den ich in New York kennengelernt habe. Er wohnte dort durch Zufall eine Ecke weiter, wir begegneten uns öfter und irgendwann schrieb ich auch über ihn. Auf einer persönlichen Ebene, am Tisch mit ein paar Drinks, haben wir uns gut verstanden. Der ist so, wie VICE Mitte der 90er auch war: anarchisch, schnell im Kopf, lustig. Mit ihm hatte ich eine gute Zeit, aber er war gleichzeitig auch ein MAGA-Aktivist und hat es immer genossen, mich zu provozieren. Und da war es manchmal schwer, mit einer langweiligen Mainstream-Meinung dagegenzuhalten: Donald Trump ist böse, Angela Merkel ist eigentlich ganz ok und so weiter. Kurz fühlt man die Ohnmacht und denkt, die Bösen seien einfach cooler, frischer, hätten die interessanteren Argumente, auch wenn sie natürlich falsch sind. Aber sie verkörpern das, was Punk mal war: provokant und im ständigen No-Go-Bereich. Und man selbst ist inzwischen der Vernünftige. Das habe ich Chris auch mal erleben lassen und das Gedankenspiel verfolgt, was geschieht, wenn man sich von dieser Attitüde wirklich verführen und überzeugen ließe.

Katharina Viktoria Weiß:
Bleiben wir beim Gedankenspiel: Wenn wir die Schönwalds noch länger begleiten dürften, wie würden sie zum Beispiel angesichts der Nachrichtenlage aus Gaza denken, diskutieren und vielleicht auf Social Media agieren?
Philipp Oehmke:
Dieser Frage gehe ich auch gerade nach, denn ich schreibe aktuell am zweiten Teil des Buches. Ich bin noch dabei herauszufinden, wie die Kriege in der Ukraine und in Gaza sowie die US-Wahl im Herbst 2024 eine Familie möglicherweise belasten, die ohnehin schon pessimistisch auf die Welt schaut. Wie funktionieren ihre erprobten und gleichzeitig schwachen Verdrängungsmechanismen in einer noch komplizierteren Welt?

»Ihr müsst eure Eltern schon mal fragen, worauf euer ganzer Wohlstand basiert und was eure Großeltern im Krieg gemacht haben.«
Katharina Viktoria Weiß:
Gewisse Dinge runterzuschlucken, um das ganze Konstrukt am Laufen zu halten, hat mich auch an meine Familie in Bayern erinnert: Mit etwa 30 Jahren kommt meine Generation so langsam zu dem späten Eingeständnis, dass dieser vorgelebte Pragmatismus streckenweise auch seine effektiven Seiten hatte, auch wenn er bestimmt schmerzhaft für die Persönlichkeitsentwicklung einzelner Familienmitglieder war.
Philipp Oehmke:
In „Schönwald“ kämpfen drei Generationsmodelle gegeneinander. Erstens die Nachkriegsgeneration, mit ihrer absoluten Verdrängungsstrategie, die keine Gefühle zulässt. Dann deren Kinder, die jetzt um die 40 sind und im Grunde alles ironisch sehen: Aus allem wird ein Witz gemacht, schließlich ist man aufgewachsenen im Wohlstand der 1980er und 90er Jahre. Sie lieben Quentin Tarantino und Bret Easton Ellis und nehmen nichts wirklich ernst, weil wir von allem wahnsinnig gelangweilt sind. Nazivergangenheit? Die war zu weit weg, das spielt keine Rolle mehr. Und dann melden sich die Millennials oder sogar die Altersstufe darunter, die Kids der Gen Z, die im Buch vor allem durch zwei Instagram-Aktivisten verkörpert werden. Diese Generation fordert nun doch wieder Moral ein und sagt: Sorry, so einfach könnt ihr es euch nicht machen. Ihr müsst eure Eltern schon mal fragen, worauf euer ganzer Wohlstand basiert und was eure Großeltern im Krieg gemacht haben.

»Ich habe gehört, sie hätte es als anmaßend empfunden, dass dass ich ihre Geschichte und die Vorwürfe gegen sie fiktional aufgegriffen habe.«
Katharina Viktoria Weiß:
Die Instagram-Aktivisten, die eine etwa gleich alte Buchladen-Besitzerin mit ihrem familiär weit zurückreichenden Nazihintergrund konfrontiert haben, gibt es wirklich. Eine der Personen kenne ich entfernt aus dem persönlichen Bekanntenkreis, ich war total überrascht, sie auf diese Weise literarisch verfremdet im Buch zu entdecken. Wurde dieser Umstand von den Aktivisten als künstlerische Verarbeitung des Ganzen akzeptiert? Oder gab es an dieser Stelle Reibungsmomente, weil sie so leicht identifizierbar waren?
Philipp Oehmke:
Damit hatte ich eigentlich gerechnet, doch hier blieben Reaktionen aus. Womit ich nicht gerechnet hatte, ist, dass die Besitzerin des Buchladens nicht happy war mit meinem Roman.
Katharina Viktoria Weiß:
Faszinierend – und schade, denn als Leserin hatte ich im Buch eigentlich viel Empathie für ihr Dilemma aufgebracht. Was ist passiert?
Ich habe gehört, sie hätte es als anmaßend empfunden, dass dass ich ihre Geschichte und die Vorwürfe gegen sie fiktional aufgegriffen habe. Tatsächlich aber liegt der Fall bei ihr ganz anders, und meine Romanfigur hat ja auch sonst überhaupt nichts mit ihr zu tun.

»Eine Familie ist der kleinste gemeinsame Nenner, in dem verhandelt wird, wie wir miteinander umgehen.«
Katharina Viktoria Weiß:
Wie wirkt das Motiv der Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeiten leben zu können, auf Deine schriftstellerische Linse ein?
Philipp Oehmke:
Das war das Grundmotiv von „Schönwald“. Eine Familie ist der kleinste gemeinsame Nenner, in dem verhandelt wird, wie wir miteinander umgehen. Das lässt sich übertragen auf gesellschaftliche Konstellationen. Ich bemerkte: Da war ich mit meinem journalistischen Darstellungsmöglichkeiten am Ende. In einem SPIEGEL-Artikel muss man sich nachvollziehbar positionieren und eine Sachlage sehr klar durchdeklinieren.
Katharina Viktoria Weiß:
Und die Literatur hat Dir andere Möglichkeiten geschenkt?
Philipp Oehmke:
Ein Roman kann Dinge durchspielen oder nur anreißen. Er ist nicht gezwungen, auch immer gleich die Lösung mitzuliefern. Ich hatte die Hoffnung: Literatur kann da helfen, wo Journalismus nicht mehr weiterkommt. Und das hat besser funktioniert, als ich mir das vorgestellt hatte.

»Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen bereit sind, anderen zu verzeihen, wenn sie darum gebeten werden.«
Katharina Viktoria Weiß:
Um was geht es am Ende bei „Schönwald“?
Philipp Oehmke:
Ums Verzeihen. Die Figuren lavieren sich in schwierige Situationen, weil sie Dinge verleugnen oder verschweigen. Und dann kommen Geheimnisse ans Tageslicht und sie bemerken: Es ist an sich alles okay, ich werde trotzdem geliebt. Das ist eine wahnsinnig schöne Erkenntnis. Die Schönwalds und vermutlich auch ich haben zwar lange dafür gebraucht. Aber beim Schreiben ist mir plötzlich klar geworden: Am Ende geht es um Vergebung. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen bereit sind, anderen zu verzeihen, wenn sie darum gebeten werden. Ob die Schönwalds sich wirklich verziehen haben, muss sich allerdings erst noch herausstellen.


»Ich habe für mich nie einen Weg in den sozialen Netzwerken gefunden, den ich nicht peinlich, eitel oder selbstdarstellerisch gefunden hätte.«
Katharina Viktoria Weiß:
Um das Buch zu schreiben, hast Du dir neun Monate frei genommen und bist zum Schreiben vorübergehend in die USA gezogen. Warum postest Du dazu nicht toll und viel auf Social Media?
Philipp Oehmke:
Ich habe es in über zehn Jahren nicht geschafft, mir eine sinnvolle, glaubhafte und nicht peinliche Social-Media-Personality zuzulegen. Zum einen hatte ich immer einen zu hohen Anspruch an Texte jeder Art – egal, ob es sich um einen Romantext, einen journalistischen Text oder auch nur einen Kurztext handelt, den ich meinen Freunden schreibe. Deshalb habe ich über die Jahre verschiedene Sachen ausprobiert. Aber ich habe für mich nie einen Weg in den sozialen Netzwerken gefunden, den ich nicht peinlich, eitel oder selbstdarstellerisch gefunden hätte. Dabei sagt meine Frau immer, dass ich eigentlich genug Bildmaterial hätte – wenn ich berufsbedingt im Wohnzimmer mit Jonathan Franzen sitze oder bei Pete Doherty im Garten.

»Die BRD war ein interessantes Projekt mit vielen Abgründen.«
Katharina Viktoria Weiß:
Du bist 1974 in Bonn geboren, damals die Hauptstadt des geteilten Deutschlands. In Teilen Deines Werks, zum Beispiel im Artikel „Der Trost der RAF“, der sich mit der Festnahme von Terroristin Daniela Klette im März 2024 befasst, schimmert eine besondere Erinnerungskultur an die BRD durch, die Du nur bis zum Teenageralter erlebt hast. Was löst der Begriff BRD in Dir aus?
Philipp Oehmke:
Peinlicherweise tatsächlich ein bisschen Nostalgie. Aber es war schon ein interessanter und kurzlebiger Staat, von 1949 bis 1989. Die alte Bundesrepublik war ein lohnenswertes Projekt mit vielen Abgründen. Damit beschäftigt sich auch der Gesprächsband „BRD Noir“ von Frank Witzel und Philipp Felsch. Das war übrigens auch ein Grundmotiv meiner Toten-Hosen-Biographie, denn es gibt ja nichts Bundesrepublikanischeres als diese Band. Die Achtundsechziger hatten einen echten Grund, gegen ihre Nazi-Eltern zu rebellieren. Die Punk-Generation der 70er- und 80er-Jahre hingegen eigentlich überhaupt nicht: Deren Eltern hatten mit dem Nationalsozialismus altersmäßig gar nichts mehr zu tun. Ich habe die Mitglieder der Toten Hosen gefragt: Was hat euch eigentlich so aufgeregt, dass ihr Punks geworden seid und so rebelliert habt? Und es war eben dieses Miefige, dieses Kleingeistige, dieses „Vorgartige“ der Bundesrepublik. Die war so ängstlich und leise, man wollte bloß nicht auffallen. Es hat fast schon etwas Rührendes.

»Mittlerweile kann jeder seine eigene Wahrheit an ein riesiges Publikum verbreiten.«
Katharina Viktoria Weiß:
„Es gibt schon länger Zweifel, ob die Demokratie im Social-Media-Zeitalter überleben kann. Sie ist auf so etwas wie eine gemeinsame öffentliche Wahrheit angewiesen, die zunehmend im Netz versickert“, schreibst Du – ausgerechnet in einem Artikel über Kate Middleton. An welchen weiteren Anhaltspunkten machst Du deine Sorgen um unsere demokratischen Freiheiten fest?
Philipp Oehmke:
Als dieses möglicherweise großartige Prinzip Demokratie erfunden wurde, hat niemand mit Twitter oder Tiktok gerechnet. Ich glaube, in dem Moment, wo man sich nicht mehr kollektiv auf Wahrheiten einigen kann, wird eine politische Meinungsbildung, die in einer Demokratie unerlässlich ist, fast unmöglich. Mittlerweile kann jeder seine eigene Wahrheit an ein riesiges Publikum verbreiten. Filtersysteme wie klassische Medien – zum Beispiel der SPIEGEL, die Süddeutsche oder die New York Times – haben immer damit operiert, dass jemand Fachkundiges einen Überblick über die Sachlage und die Fakten erstellt. Ob die immer stimmte, ist eine andere Frage, aber zu 90 Prozent kam sie einer Richtigkeit zumindest nahe. Als Trump das erste Mal als Präsident kandidierte, war ich gerade wieder in die USA gezogen und musste begreifen: Es gibt jetzt offenbar die Möglichkeit, mit 70 Millionen Twitter-Followern auf die klassischen Medien zu scheißen und einfach eine eigene Wahrheit zu verbreiten.

»Ich kenne Menschen, die daran zerbrechen, dass nichts mehr klar zu sein scheint.«
Katharina Viktoria Weiß:
Ist das der neue Status quo?
Philipp Oehmke:
Ja, in unserer Lebenswelt konkurrieren inzwischen alle möglichen Wahrheiten miteinander. Jeder kennt mittlerweile Leute im seinem Umkreis, die ein absurdes Weltbild haben und einem Zeugs zu Covid, der Ukraine oder Gaza erzählen, bei dem man nur den Kopf schütteln kann. Wenn man sensibel ist und über keine Ambiguitätstoleranz verfügt, dann wird es echt schwer. Ich kenne Menschen, die daran zerbrechen, dass nichts mehr klar zu sein scheint.
Katharina Viktoria Weiß:
Wie hat sich der Wahrheitsbegriff in Deinem Arbeitsalltag als Journalist über die Jahre verändert?
Philipp Oehmke:
Als ich in den Beruf eingestiegen bin, hatten klassische Medien wie der SPIEGEL immer noch das Verständnis: Wir sind die Checker und erklären die Welt – und wir machen dabei nicht transparent, wie wir das machen oder aus welcher Position wir sprechen. Mittlerweile werden die subjektiven, biografischen, individuellen – heute würde man sagen identitätspolitischen – Aspekte, die unsere Meinung mitformen, viel deutlicher gekennzeichnet. Denn man hat begriffen: Wahrheit entsteht auch immer im Empfänger, das heißt: Wer die Botschaft verbreitet, bringt auch einiges seiner eigenen Perspektive, Biografie oder Identität mit ein.


»Die meisten von uns wähnen sich in der Situation, dass sie damals auf der Seite der Achtundsechziger gestanden hätten.«
Katharina Viktoria Weiß:
Aktuell ringen wir vor allem im Gaza-Krieg um Wahrheiten. Wie blickt man auf die Debatte, wenn man wie Du eine breite Expertise im Bereich Popkultur hat?
Philipp Oehmke:
Als jemand, der sich immer irgendwie als links und progressiv begriffen hat, denke ich aktuell oft an die 68er-Bewegung. Die meisten von uns wähnen sich in der Situation, dass sie damals auf der Seite der Achtundsechziger gestanden hätten, an der Seite der Studentenbewegung und gegen den Vietnamkrieg. Weil es Pop war, weil da die jungen Leute waren und weil es aus heutiger Sicht richtig scheint. Achtundsechzig hat gewonnen und ist heute mehrheitsfähig. Nun, wie werden wir in ein paar Jahren auf die Pro-Palästina-Versammlungen und die Demonstrationen gegen Israel schauen? Aktuell kommen mir diese häufig überzogen vor. Aber für nachfolgende Generationen scheint Pro-Palästina das, was mit Pop und Coolness verbunden ist und was viele junge Menschen gut finden…
Katharina Viktoria Weiß:
… und Megastar Macklemore schrieb kürzlich eine Protestsong für die Pro-Palästina-Studentenbewegung.
Philipp Oehmke:
Zum Beispiel. Wenn ich es von allen popkulturellen Aspekten weghalte, neige ich persönlich auch dazu, eher Israel zu verstehen und zu sagen: Die sind angegriffen worden – und ihnen jetzt die ganze Schuld zu geben, ist schwierig. Aber wenn ich die popkulturellen Aspekte mit in die Perspektive aufnehme, ist festzustellen: Die pro-palästinische Protest, so übertrieben und teilweise falsch ich ihn politisch finde, nimmt für sich in Anspruch, die coole, progressive Seite zu sein. Insofern frage ich mich: Wäre ich dann 1968 vielleicht auch auf der Seite der Konservativen gewesen, die von den Hippies verachtet wurden und ständig mahnten: „Die Studenten übertreiben total, das können die doch so nicht sagen!“ Für mich ist der Prozess nicht abgeschlossen und ich bin immer noch dabei, mich hier zu hinterfragen.

»Mein Anspruch als Ressortleiter ist es, eher pubertär als abgehangen zu agieren.«
Katharina Viktoria Weiß:
Seit Ende 2023 bist Du Leiter des Kulturressorts beim SPIEGEL. Ein Job, der aus Sicht jüngerer Pop-Rebellen immer jene innehaben, die nicht verstehen, wie gut ein Nischen-Künstler sei oder warum jener Independent-Film unbedingt eine Rezension im Blatt verdient habe. Wie hat diese leitende Rolle Deine Sicht auf die Branche geprägt?
Philipp Oehmke:
Ich versuche eher, mein 22-jähriges Ich darin zu verwirklichen und riskanter zu agieren. Mein Anspruch als Ressortleiter ist es, eher pubertär als abgehangen zu agieren. Und auch Themen abseits des Mainstreams aufzugreifen. Natürlich kommt man nicht immer mit allen Ideen durch, aber ich wurde nicht in eine Rolle gedrängt, in der ich plötzlich nur noch seriöse Hochkultur machen kann.

»Diese Opas erzählen nicht nur ihren Ehefrauen und Enkelkindern, was sie so von der Welt halten. Sondern sie posten es auf Social Media.«
Katharina Viktoria Weiß:
Es gibt viele Beispiele bekannter Journalisten, die als junge Reporter sehr links oder progressiv waren, um dann im Alter zu rechten Galionsfiguren zu werden. Wie etwa Matthias Matussek, einer Deiner Vorgänger als Ressortleiter beim SPIEGEL. Wie erklärst Du dir eine solche Entwicklung?
Philipp Oehmke:
Der Aspekt von ehemals Linken oder „Counter Culture“-Leuten wie Matthias Matussek oder Gavin McInnes, die sich immer weiter in die rechte und auch affirmative rechte Richtung radikalisieren, ist ein Phänomen, das es immer gegeben hat. Früher waren diese Personen einfach nicht mehr sichtbar, nachdem sie aus dem Berufsleben ausgeschieden waren. Heute dagegen fallen sie mehr auf, denn diese Opas erzählen nicht nur ihren Ehefrauen und Enkelkindern, was sie so von der Welt halten, sondern sie posten es auf Social Media. Das ist tragisch. Matussek war es, der mich damals zum SPIEGEL geholt hatte. Wir kannten uns gut. Aber schon lange bevor er sich radikalisiert hat, hatten wir uns über inhaltliche und stilistische Fragen entzweit.

»Ich bin auf der Suche nach Leuten, die etwas Besonderes mitbringen.«
Katharina Viktoria Weiß:
So schön der Beruf Journalist auch ist: Er ist kein einfacher, denn die Branche hat ein Image- und auch Finanzierungsproblem. Dennoch gibt es viele Menschen, die sich für diesen Job begeistern. Welchen Wegweiser würdest Du jungen Autoren mitgeben, die gerade am Berufsanfang stehen?
Philipp Oehmke:
Ich bin auf der Suche nach Leuten, die etwas Besonderes mitbringen: weil sie eine ungewöhnliche Stimme haben und sich was trauen. Die aktuelle Krise der Medien macht es Leuten viel schwerer. „Der klingt ganz lustig, den stellen wir mal ein und schauen, was dabei herauskommt“ – dieses Prinzip gibt es so nicht mehr. Heute stehen die Medien extrem unter Druck und gute, originelle Stimmen haben es schwer. Aber eigentlich sollten wir genau auf diese Menschen setzen. Denn die menschlichen Nachrichtenmaschinen brauchen wir bald nicht mehr, das kann dann die KI. Meine Hoffnung dabei ist, dass der individuelle, fein geschliffene Blick immer wertvoller wird.
Lange Rede, kurzer Sinn – mein Tipp: Baut Eure Stärken aus, vergesst Eure Schwächen, spezialisiert Euch – und traut Euch vor allem, Eurem eigenen Gefühl zu vertrauen!
»Schönwald«
Ein Roman von Philipp Oehmke
Erschienen im Piper Verlag
544 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag
EAN 978-3-492-07190-1
Mehr von und über Philipp Oehmke:
Interview & Text: Katharina Viktoria Weiß
Fotografie: Roberto Brundo
Kyrylo Sirchenko
Portrait — Kyrylo Sirchenko
»Butscha hat mir die Unschuld geraubt«
Eigentlich ist Kyrylo Sirchenko (27) ausgebildeter Schauspieler. Doch statt in Kyiv auf der Theaterbühne zu stehen, hat er in den letzten beiden Jahren Journalist*innen aus aller Welt dabei unterstützt, vom Krieg in seiner Heimat zu berichten. Ein kleiner Einblick in ein junges Leben mitten in Europa, das sich mit Putins Angriff auf die Ukraine schlagartig geändert hat. Und in dem Humor zur Überlebensstrategie gehört.
30. Juli 2024 — Text: Jonas Meyer, Fotografie: Kristina Ursylyak

Triggerwarnung:
In diesem Beitrag werden potenzielle Trigger-Themen erwähnt. Dazu gehören: Gewalt, Krieg und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn Du dich damit unwohl fühlst, lies den Text lieber nicht oder mit einer weiteren Person.
Wenn Du dich in einer emotionalen Krisensituation befindest und mit jemandem reden möchtest – hier findest Du Hilfe: Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern lauten 0800 – 111 0 111 und 0800 – 111 0 222.


»Wenn man zu lange Urlaub vom Krieg macht, will man irgendwann nicht mehr an die Front.«
Ein Dienstagabend Ende März vor einem kleinen Programmkino in Berlin-Neukölln. Nach der Filmvorstellung hat sich auf dem Gehweg eine bunte Traube von Menschen gebildet. Sie trinken, rauchen, unterhalten sich. Eine Szene, wie sie gewöhnlicher nicht sein könnte – solange man den Umstand ausblendet, dass drei von ihnen gerade aus dem Krieg kommen. Und dahin auch wieder zurück müssen.
„Wenn man zu lange Urlaub vom Krieg macht, will man irgendwann nicht mehr an die Front“, bemerkt Kyrylo Sirchenko mit einem seltsamen Grinsen auf dem Gesicht. Der Humor des 27-jährigen Ukrainers mit den wilden Locken und der freundlichen Ausstrahlung ist für die Leute um ihn herum nur schwer zu fassen. Doch dieser Humor, so erzählt er, sei einer der wenigen Gründe, warum er die letzten zwei Jahre überhaupt überlebt habe.
Kyrylo ist ein sogenannter Fixer: Als lokaler Ansprech- und Produktionspartner unterstützt er fast täglich ausländische Medien bei der Kriegsberichterstattung in seiner Heimat. Menschen wie er machen in den Krisengebieten der Welt die Arbeit von Journalist*innen oft erst möglich, denn sie sprechen nicht nur die Sprache des Landes und damit der Soldaten, Opfer und Augenzeug*innen, sondern verfügen auch über genaue Ortskenntnisse, wertvolle Kontakte und viele andere besondere Fähigkeiten.

»Ich weiß, dass der Begriff Fixer im Deutschen auch eine Person meinen kann, die sich Drogen per Spritze in die Venen jagt.«
In der Regel werden Fixer von Medienunternehmen gebucht oder direkt von Auslandskorrespondent*innen engagiert, um eine Story zu arrangieren und produzieren. Aus diesem Grund bevorzugt Kyrylo auch den Jobtitel local producer – „vor allem, seit ich weiß, dass der Begriff Fixer im Deutschen auch eine Person meinen kann, die sich Drogen per Spritze in die Venen jagt“, witzelt er.
Das sehen Oleksandra Aleksandrenko und Andrii Kolesnyk übrigens genauso. Zusammen mit Kyrylo machen sie für ein paar Tage Urlaub vom Krieg in ihrer Heimat, um mit dem Kinopublikum in Paris, Brüssel und hier in Berlin ins Gespräch zu kommen. Die drei local producers sind die Hauptprotagonist*innen der knapp 30-minütigen Dokumentation „Fixers in Wartime – The invisible Reporters“, die aktuell auch in der Arte-Mediathek zu sehen ist. Produziert wurde der Film unter anderem von der Organisation RSF („Reporters sans frontières“, dt. „Reporter ohne Grenzen“). Die international tätige Nichtregierungsorganisation setzt sich seit 1985 weltweit für die Pressefreiheit und gegen Zensur ein.
»Paris, Brüssel, Berlin – diese Städte erinnern mich daran, wie wir selbst leben könnten, leben würden, wenn dieser Krieg nicht wäre.«
Für die Kinopremieren in Frankreich, Belgien und Deutschland gelang es RSF, die persönliche Anwesenheit von Kyrylo, Andrii und Oleksandra zu arrangieren – ein Aufwand, der vor allem bei den beiden Männern nicht unerheblich war. Immerhin befinden sich Kyrylo und Andrii im wehrfähigen Alter und dürfen ihr Land eigentlich nicht verlassen.
„Paris, Brüssel, Berlin – diese Städte erinnern mich daran, wie wir selbst leben könnten, leben würden, wenn dieser Krieg nicht wäre“, stellt Kyrylo fest. Manchmal habe er sich in den letzten Tagen bei dem Gedankenspiel erwischt, wie es wäre, einfach hierzubleiben und nicht mehr in die umkämpfte Heimat zurückzukehren.
„Seit ich die Ukraine verlassen habe, habe ich besser geschlafen, besser gegessen und bin besser gelaunt“, erzählt Kyrylo. „Klar würde ich gerne noch länger hierbleiben“, fügt er nach einer Gedenksekunde hinzu, „aber ich habe das Gefühl, dass meine Aufgabe in der Ukraine noch nicht beendet ist.“ Er habe sich versprochen: Sobald es seiner Heimat gelungen sei, sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland zu verteidigen, reise er in aller Ruhe durch Europa – „vorausgesetzt, ich habe dann noch alle Arme, Beine und meinen Kopf – und eben meinen Humor“. Denn der sei für ihn wie ein Lebenselixier.

»Die Monate vor dem Krieg waren die beste Zeit meines Lebens.«
Kyrylo ist in Kyiv geboren und aufgewachsen. Sein noch junges Leben hat er bereits eingeteilt in eine Zeit vor dem Krieg und eine danach. Vor dem 24. Februar 2022 – jenem Tag, an dem Putins Russland die Ukraine überfallen hat – wäre es ihm im Traum nicht eingefallen, dass er mal ausländische Medien bei der Kriegsberichterstattung unterstützen würde, und das auch noch hauptberuflich und im eigenen Land. Und noch weniger, dass er mal etwas sehen würde, dessen Abgrund sich allein über die bloße Nennung des Ortsnamens erschließt: Butscha.
In seinem Leben vor dem Krieg hatte Kyrylo Schauspiel und Dramaturgie studiert. Während der Corona-Hochphase arbeitete er erst in einer Brauerei und dann in einem Laden für Musikinstrumente, bevor er schließlich im Herbst 2021 ein Engagement am Kyiver „Proenglish Theater“ annahm, wo er für das Stück „The City Was There“ besetzt wurde. Gleichzeitig fing er an, selbst Musik zu komponieren und zu produzieren. „Die Monate vor dem Krieg waren die beste Zeit meines Lebens“, erinnert sich Kyrylo zurück, „ich hatte eine wahnsinnige Energie in mir.“ Die profunden Englischkenntnisse, die er sich am Theater angeeignet hatte, sollten sich wenig später als entscheidender Vorteil herausstellen, ebneten sie ihm doch den Weg in seinen neuen Job.
Den Ausbruch des Krieges erlebte Kyrylo auf dem Dachboden seines Elternhauses. Nachdem sich kurz zuvor seine Freundin von ihm getrennt hatte und er der Bitte seiner Eltern gefolgt war, wieder bei ihnen einzuziehen, hatte er sich dort ein kleines Musikstudio eingerichtet. „Ich weiß noch, dass ich in dieser Nacht nicht schlafen konnte“, erinnert er sich an die frühen Morgenstunden des 24. Februar. „Ich saß in Boxershorts vor meinem Computer, machte ein bisschen Musik, rauchte eine Zigarette nach der anderen und dachte über tausend Dinge nach. Dann, gegen 5 Uhr morgens, hörte ich die Sirenen und kurz darauf die ersten Raketeneinschläge: bam, bam, bam!“ Heute würden ihm solche Geräusche nichts mehr ausmachen, bemerkt Kyrylo etwas abgehalftert. „Aber damals war das verdammt beängstigend.“

»Wir saßen zusammen in der Küche und fragten uns, ob das wohl der Anfang des Dritten Weltkriegs sei.«
Nachdem er sich gesammelt hatte, eilte er die Treppe herunter zu seinen Eltern, die kreidebleich am Küchentisch saßen. In den Tagen zuvor, als Putin seine Truppen an der Grenze aufgezogen hatte, hatten sich die Sirchenkos zu Hause noch gegenseitig beschwichtigt. Ein Säbelrasseln sei das, nichts weiter. „Doch nun saßen wir zusammen in der Küche und fragten uns, ob das wohl der Anfang des Dritten Weltkriegs sei“, erzählt Kyrylo. Sein Vater, Jahrgang 1938, hatte als Kind die beiden Schlachten um Kyiv erleben müssen. „Sofort schossen in ihm wieder die Erinnerungen hoch.“
Als sich in den nächsten Tagen die Situation zuspitzte und die Russen immer weiter auf Kyiv vorrückten, brachte er seine Eltern zu Verwandten aufs Land. Doch nachdem die ukrainische Armee den Vormarsch der Russen auf die Hauptstadt gestoppt und zurückgedrängt hatte, wagte sich Kyrylo wieder nach Kyiv. Beim Anblick der vielen Soldaten auf den Straßen hatte er das Bedürfnis, sich nützlich zu machen. Doch sich freiwillig zur Armee zu melden, kam für ihn in dem Moment nicht in Frage. „Nicht, weil ich feige bin“, erklärt er. „Sondern weil meine Eltern so alt sind. Ich könnte es ihnen nicht antun, die Uniform zu tragen. Das wäre für sie eine zu große emotionale Belastung, die ich ihnen nicht zumuten möchte.“
Also fing Kyrylo an, ehrenamtlich in der Küche eines Checkpoints zu arbeiten, wo er von morgens bis abends Kartoffeln schälte. „Ich bin zwar ein lausiger Koch“, sagt er, „aber mit den Händen arbeiten, das kann ich.“ Anfang April erhielt er einen Anruf von einem Schauspielkollegen aus der englischen Theatergruppe, der bereits als local producer mit ausländischen Medien zusammenarbeitete. Er fragte ihn, ob er morgen einen Journalisten vom Schweizer „Tages-Anzeiger“ begleiten könne, da er selbst verhindert sei. Kyrylo sagte spontan zu: „Natürlich mach‘ ich das, fucking yes!“

»Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mit der Kiste mal in den Krieg fahren würde.«
Am nächsten Tag traf er den Schweizer Reporter und dessen Fotograf. Da die beiden Journalisten kein Fahrzeug hatten und Kyrylo keinen Führerschein, drückte er ihnen den Schlüssel des Autos seiner Mutter in die Hand. „Das war ein 20 Jahre alter Toyota Solara“, erinnert er sich mit einem Lachen zurück. „Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mit der Kiste mal in den Krieg fahren würde.“
So weit war der Krieg auch nicht entfernt. Das Ziel der Journalisten lag nur eine knappe Stunde vom Kyiver Stadtzentrum entfernt, eine Kleinstadt mit etwa 30.000 Einwohner*innen. Ihr Name: Butscha. Gerade erst hatte die ukrainische Armee den Ort für die internationale Presse geöffnet, um der Weltöffentlichkeit die Kriegsverbrechen vor Augen zu führen, die die russische Armee in der kleinen Stadt nordwestlich von Kyiv begangen hatte.
Die New York Times schildert die Ereignisse folgendermaßen: „Als der russische Vormarsch auf Kiew angesichts des erbitterten Widerstands ins Stocken geriet, schlug die feindliche Besatzung von Butscha laut Zivilist*innen in einen Feldzug des Terrors und der Rache um. Als sich die besiegte und demoralisierte russische Armee schließlich zurückzog, hinterließ sie ein düsteres Bild: Leichen von Zivilisten, die auf den Straßen, in Kellern oder Hinterhöfen verstreut lagen, viele mit Schusswunden am Kopf, einige mit auf dem Rücken gefesselten Händen.“

»Wenn plötzlich das eigene Land existenziell bedroht ist, gibt es keine Grauzone mehr, in der man sich aufhalten kann.«
„Dieser Anblick hat mein Leben fundamental verändert“, erzählt Kyrylo und nimmt einen tiefen Zug seiner Zigarette. „Vor Butscha gab es ein Ich vor dem Krieg. Aber nach Butscha gibt es nur noch ein Ich im Krieg.“
Er selbst habe sich nie als Patrioten bezeichnet, erklärt er. Wie viele andere aus der ukrainischen Kreativszene habe auch er immer versucht, sich von Politik im Allgemeinen und nationalistischen Positionen im Speziellen zu distanzieren. „Klar, natürlich war auch ich bei den Maidan-Protesten vor zehn Jahren dabei. Und ich war auch vor dem Krieg schon immer pro Ukraine und anti Russland“, sagt Kyrylo. „Aber das war immer mehr aus einer Gewohnheit heraus und nie mit besonders viel Leidenschaft verbunden. So etwas wie Hymnen und Flaggen war mir immer fremd.“
Doch die Erlebnisse in Butscha hätten seine Einstellung komplett über den Haufen geworfen. „Wenn plötzlich das eigene Land existenziell bedroht ist, gibt es keine Grauzone mehr, in der man sich aufhalten kann. Sondern nur noch Schwarz oder Weiß, Freiheit oder Unterwerfung.“ Als er die vielen toten Zivilisten auf den Straßen gesehen habe, habe er verstanden, dass das seine Leute seien. Und dass er nun gar nicht mehr anders könne, als Position zu beziehen.

»Dem armen Greis hatte man ein riesiges Loch ins Gesicht geschossen.«
Kyrylo berichtet, wie er zusammen mit den beiden Journalisten vom Schweizer „Tages-Anzeiger“ zu einer Grube nahe einer kleinen Kirche geführt wurde, in der unzählige Leichen lagen. „Die ukrainische Armee hat sie dort zusammengetragen, um forensische Spuren zu sichern“, fährt er fort. Er sei immer noch nicht in der Lage zu verarbeiten, was dort passiert sei. „Vielleicht gelingt mir das, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist. Aber momentan schiebe ich das ganz weit von mir weg.“
Ein Bild aus Butscha bekomme er dennoch nicht aus dem Kopf: den Anblick eines ukrainischen Ermittlers, der die Leiche eines alten Mannes untersuchte. „Dem armen Greis hatte man ein riesiges Loch ins Gesicht geschossen“, erzählt er. „Und daneben stand dieser junge Ermittler mit seiner coolen Sonnenbrille, der mit Zigarette im Mund ganz routiniert die Leiche inspizierte. Was für eine weirde Situation. Im Leben gibt es auch bei der schlimmsten Tragödie immer etwas, das ein bisschen aus dem Rahmen fällt.“
Gleichzeitig habe er erlebt, wie gut er in seinem neuen Job funktioniert habe. „Ich habe den ganzen Tag lang für die Schweizer Journalisten Augenzeug*innen gesucht, bei den Interviews übersetzt und die Produktion des Artikels möglich gemacht“, erinnert sich Kyrylo. „Ich habe gemerkt: Hier bin ich in meinem Element – auch wenn ich nicht in der Lage war, bei dem Anblick irgendetwas zu essen, und mich nur von Kaffee und Zigaretten ernährt habe.“

»In mir war nur die Frage, wie Menschen im 21. Jahrhundert zu so etwas in der Lage sein können.«
Nach diesem Tag habe er sich richtig elend gefühlt, erzählt er. „In mir war eine einzige, große Leere. Keine Trauer, keine Wut, nichts. Nur die Frage, wie Menschen im 21. Jahrhundert zu so etwas in der Lage sein können.“ Doch am nächsten Tag schien dieses Gefühl wie verflogen. „Ich glaube, Butscha hat mir die Unschuld geraubt“, sagt Kyrylo. „Seitdem ist es für mich zu einer seltsamen Normalität geworden, getötete Menschen zu sehen.“
Völlig kalt lasse ihn dabei vor allem der Anblick toter russischer Soldaten, sogar wenn es sich dabei um verkohlte Leichen 18-jähriger Wehrpflichtiger handele. „Ganz ehrlich“, holt er aus, „für mich ist das einfach nur der Feind, der in mein Land gekommen ist, um meine Leute zu töten und uns zu unterwerfen.“ Natürlich wisse er, dass es in der russischen Kriegsmaschinerie auch etliche Soldaten gebe, die gegen ihren Willen kämpfen müssten. Aber für diese Menschen könne er kein Mitleid empfinden. „Vielleicht gelingt mir auch das nach dem Krieg, wer weiß. Aber aktuell ist das in meinem Herzen keine Option.“

»Wenn ich jemals wieder auf der Bühne stehen will, muss ich mir meine Empathie zurückholen.«
Er wisse, dass das zynisch klinge, sagt Kyrylo. Aber für die Arbeit als local producer sei das eine zwingend notwendige Eigenschaft, sonst ginge man an solchen Gefühlen zugrunde. Dass diese emotionale Entwicklung es ungleich schwieriger macht, irgendwann wieder in seinem alten Beruf als Schauspieler zu arbeiten, weiß er ebenso. „Wenn ich jemals wieder auf der Bühne stehen will, muss ich mir meine Empathie zurückholen“, sagt Kyrylo. Dann ergänzt er etwas zögerlich: „Emotionale Taubheit und Zynismus sind mit einer Karriere als Künstler absolut nicht vereinbar.“
Doch nach einer Rückkehr ans Theater sieht es in Kyrylos Leben aktuell eh nicht aus, ganz im Gegenteil. In den letzten zwei Jahren tat er alles, um in seinen neuen Job, seine neue Lebensaufgabe hineinzuwachsen und sich in diesem Metier einen Namen zu machen – und das nicht selten, ohne sich dabei immer wieder in Lebensgefahr zu begeben.
Wie etwa im Sommer 2022, als er einen seiner Klienten nach Charkiw begleitete. Der junge Norweger hatte es sich zur Aufgabe gemacht hat, zurückgelassene Haustiere aus umkämpften ukrainischen Gebieten zu retten. Einquartiert hatten sich die beiden Männer in einem fast verlassenen Hotel am Stadtrand. Als Kyrylo nachts um zwölf in seinem Bett lag und sich durch ein paar lustige Clips auf Youtube klickte, erschien eine Raketen-Warnmeldung auf seinem Smartphone, gefolgt von heulenden Sirenen.

»Direkt neben dem Hotel klaffte ein riesiges Loch im Boden – so groß, dass ein VW Transporter reingepasst hätte.«
„Es dauerte keine 30 Sekunden und ich wurde durch eine Druckwelle aus dem Bett geschleudert“, berichtet er. „Als ich zu mir kam, sah ich, dass das Fenster in meinem Zimmer komplett zerborsten war.“ Kyrylo wagte sich an das klaffende Loch in seinem Hotelzimmer und schaute hinunter auf die Straße. „Direkt neben dem Hotel klaffte ein riesiges Loch im Boden – so groß, dass ein VW Transporter reingepasst hätte.“
Auch wenn er nur knapp mit seinem Leben davongekommen und eine ganze Weile taub auf einem Ohr war, hinderte ihn diese Erfahrung nicht daran, immer weiterzumachen und Journalist*innen dabei zu unterstützen, über den Krieg in seinem Land zu berichten.
Ein etwas älterer Reporter, der in der Doku „Fixers in Wartime“ zu Wort kommt, beschreibt den 27-jährigen Ukrainer als etwas chaotisch. „Natürlich kann es passieren, dass ich während der Fahrt ein Sandwich esse, rauche und gleichzeitig telefoniere“, erklärt Kyrylo mit einem Lächeln. „Was die meisten Journalisten nicht verstehen: Der organisatorische Part an meinem Job ist verdammt anstrengend. Alles permanent in Bewegung zu halten und die vielen kleinen Puzzleteile zusammenzufügen, ist alles andere als easy.“ Dann fügt er hinzu: „Ich bin lieber etwas chaotisch, als brav auf meinem Hintern zu sitzen und das zu tun, was von mir verlangt wird.“

»Sich um ein Haustier zu kümmern, ist eine gute Strategie, um den Krieg seelisch irgendwie zu überleben.«
Neben der Arbeit für internationale Medien hat Kyrylo vor einiger Zeit auch begonnen, ein eigenes journalistisches Projekt zu realisieren. In einer filmischen Dokumentation befasst er sich mit der Frage, welche seelischen Narben der Krieg bei den Soldaten hinterlässt, denen er begegnet. „Ich habe festgestellt“, erzählt Kyrylo, „dass die meisten Soldaten überraschend offen sind, wenn ich sie zu ihren Gefühlen interviewe – obwohl sie ja ständig von diesem Horror umgeben sind.“ Dennoch müsse er extrem behutsam und mit fast chirurgischer Präzision vorgehen, wenn er die Männer zum Zustand ihrer Seele befrage.
In „Fixers in Wartime“ sind erstaunlicherweise immer wieder Katzen zu sehen, die mit den Soldaten in ihren Posten und Stellungen leben. „Katzen füllen das emotionale Vakuum, dass sich bei diesen Männern gebildet hat“, erklärt Kyrylo. Wenn man sich täglich in Lebensgefahr begebe und für sein Land kämpfe, müsse man immer wieder Wege finden, um Stress abzubauen und sich zu entspannen.
„Sich um ein Haustier zu kümmern, es zu streicheln und mit ihm zu kuscheln, ist eine gute Strategie, um den Krieg seelisch irgendwie zu überleben.“ Es seien diese grundlegenden menschlichen Bedürfnisse, die die Soldaten, die sich in dieser dunklen, schlimmen und tragischen Lage befänden, zurück ins Leben zu holen und ihnen ein wenig inneren Frieden zu schenken.

»Was genau ich erlebt habe, erzähle ich meinen Eltern nicht.«
Wie die Soldaten in den Schützengräben muss auch Kyrylo immer wieder darauf achten, sich um sich selbst zu kümmern. Die Energie, die ihn als Schauspieler in den Monaten vor dem 24. Februar 2022 beflügelt hätte, sei weitestgehend aufgebraucht, er sei erschöpft, rauche zu viel und ernähre sich schlecht. „Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten zwei Jahren um zehn Jahre gealtert bin“, bemerkt er. Außerdem habe er 15 Kilo zugenommen.
Aus diesem Grund lege er zwischen einzelnen Jobs immer wieder Pausen ein, fahre für ein paar Wochen nach Hause, schlafe viel, lenke sich mit Videospielen ab und unterhalte sich mit seinen Eltern. „Was genau ich erlebt habe, erzähle ich ihnen aber nicht“, sagt er. „Das würde ihnen wahrscheinlich das Herz brechen.“
Allzu lange hält er es zu Hause aber nicht aus. „Ich ertrage es einfach nicht, wochenlang nur herumzusitzen und nichts zu tun“, erklärt er. Dann müsse er seinem Gefühl nachgeben, sich nützlich zu machen und etwas beizutragen zu dem Kampf, in dem sein Land stecke.

»Dieses Geld ist aus Tragödien heraus entstanden, aus Kriegsjournalismus – und damit letztendlich aus Blut.«
Geld sei für ihn allerdings keine Motivation, sagt er. Dabei ist der Job als local producer durchaus lukrativ. Kyrylos Tagessatz liegt je nach Medium und Anforderung zwischen 100 und 300 US-Dollar, in den letzten zwei Jahren hat er knapp 70.000 US-Dollar verdient. Zum Vergleich: In der Ukraine lag das durchschnittliche Monatseinkommen im letzten Jahr bei etwa 600 US-Dollar.
Gespart hat Kyrylo allerdings kaum etwas. Den größten Teil seiner Honorare für dringend benötigtes Kriegsequipment wie etwa Drohnen ausgegeben, das er einzelnen Truppenteilen gespendet hat. „An der Front gibt es einen konstant hohen Bedarf an Material aller Art“, erklärt er, „denn die Russen werfen uns ein Vielfaches entgegen.“
Doch das ist nicht der einzige Grund, warum er das verdientes Geld nicht behalten will. „Dieses Geld ist aus Tragödien heraus entstanden, aus Kriegsjournalismus – und damit letztendlich aus Blut.“ Natürlich habe das in diesen Zeiten auch seine Berechtigung, sagt Kyrylo. „Aber ich wollte nie Journalist sein, sondern Schauspieler und Musiker. Damit möchte ich irgendwann mein Geld verdienen – und mit nichts anderem.“


»Putin hat die Ukraine überfallen, um die demokratischen Strukturen unseres Landes zu zerstören.«
Was Kyrylo Sirchenko tatsächlich antreibt in seinem Job, den ihm das Leben vor die Füße geworfen hat, offenbart sich an jenem Dienstagabend im März in dem kleinen Neuköllner Programmkino. Nach der Vorstellung ist eine Fragerunde angesetzt, bei der Kyrylo, Andrii und Oleksandra mit dem Publikum ins Gespräch kommen sollen. Eine etwas ältere Zuschauerin meldet sich zu Wort und fragt, warum die Ukraine weiterkämpfe und sich nicht mit Russland an den Verhandlungstisch setze.
„Ich glaube, die Dame hat bei ihrem Gedankengang die einfachste Route gewählt“, erinnert sich Kyrylo zurück. „Sie sieht, dass vor ihrer Haustür schlimme Dinge passieren und möchte, dass das aufhört. Und dieser Wunsch ist absolut nachvollziehbar.“ Aber in diesem Fall, so fährt er fort, lägen die Dinge etwas anders: „Putin hat die Ukraine überfallen, um die demokratischen Strukturen unseres Landes zu zerstören und die Menschen, die sich nach Freiheit sehnen, seiner Diktatur zu unterwerfen. Das ist völlig inakzeptabel.“

»Wenn ein aggressiver Schüler, der andere mobbt, nie selbst eine schmerzhafte Lektion erhält, wird er immer so weitermachen.«
„Wenn ein aggressiver Schüler, der andere mobbt, nie selbst eine schmerzhafte Lektion erhält, wird er immer so weitermachen“, erklärt Kyrylo. Und im Falle von Ländern wie Russland, Nordkorea oder Iran hätte das unabsehbare und dramatische Folgen – zum Beispiel einen Überfall auf baltische Staaten wie Estland, Lettland oder Finnland. „Die Dame muss leider lernen zu begreifen, dass Leute wie Putin absolut kein Interesse daran haben, sich zivilisiert mit anderen an einen Tisch zu setzen und zu reden. Es geht ihm um die Zerstörung von Demokratie. Und das lassen wir nicht zu.“ Was die Ukraine jetzt brauche, sei kein Mitgefühl, sondern Solidarität.
Ein konkrete Möglichkeit, die Ukraine zu unterstützen, sei zum Beispiel eine Zuwendung an die Hospitallers, erklärt Kyrylo später im Gespräch. Diese Organisation ehrenamtlicher Sanitäter*innen sammelt Geld für Medikamente, Verbandsmaterial, medizinisches Gerät, aber auch Treibstoff, um Verwundete aus den umkämpften Gebieten zu evakuieren. Gegründet wurden die Hospitallers bereits im Jahr 2014, von der querschnittsgelähmten Veteranin und Parlamentarierin Yana Zinkevich, nachdem Russland völkerrechtswidrig die Krim annektiert hatte.

»Ich bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben, denn sie macht vieles klarer in meinem Leben.«
Nach den Kinopremieren in Paris, Brüssel und Berlin kehrt Kyrylo wieder in die Ukraine zurück. Die nächsten Jobs stehen an, außerdem will er an seiner eigenen Dokumentation weiterarbeiten. Dann wird es einige Wochen still um ihn.
Anfang Juli erreicht uns in den frühen Morgenstunden eine Sprachnachricht. Kyrylo erzählt, dass er mittlerweile nicht mehr als local producer arbeite, sondern nun ganz offiziell den ukrainischen Streitkräften angehöre – als Koordinator im Bereich Pressearbeit und Public Relations.
„Diese neue Situation fühlt sich sehr seltsam an“, spricht Kyrylo in sein Telefon. Seine Stimme klingt deutlich schwerer, nachdenklicher und auch erschöpfter als noch im Frühjahr. Als er das Angebot erhalten habe, habe er sofort zugegriffen – denn damit sei er einem eventuellen Zwangseinzug im Zuge der aktuellen Mobilisierungswelle zuvorgekommen.
„Gleichzeitig bin ich froh, diese Entscheidung getroffen zu haben“, lässt er uns wissen, „denn sie macht gerade vieles klarer in meinem Leben.“ Vorher sei er als sogenannter Fixer immer zwischen den jeweiligen Jobs an der Front und seinem elterlichen Zuhause in Kyiv gependelt, diese beiden Extreme seien für ihn mental ziemlich anstrengend gewesen.

»Ich habe mehr Kontrolle über meine Gefühle, wenn ich als Soldat diene.«
„In meinem neuen Job bin ich jetzt permanent an vorderster Front – oder zumindest irgendwo in der Nähe“, erklärt er. „Und da es erst mal nicht zur Debatte steht, dass ich wieder nach Kyiv zurückkehre, habe ich gerade auch das Gefühl, viel stärker irgendwo verankert zu sein als noch vor ein paar Wochen.“ Das liege übrigens nicht nur daran, dass er jetzt einen festen Job habe, bei dem er genau wisse, was er zu tun habe, sagt Kyrylo. „Man könnte auch sagen, ich habe mehr Kontrolle über meine Gefühle, wenn ich als Soldat diene.“
Am schwierigsten sei es für ihn gewesen, seinen betagten Eltern von seiner Entscheidung zu berichten. „Ich war am Boden zerstört, als ich ihnen erzählen musste, dass ich jetzt die Uniform trage“, erinnert sich Kyrylo weiter in der fast achtminütigen Sprachnachricht. „Die beiden haben es überraschend okay aufgenommen“, berichtet er, „vor allem mein Vater. Dabei habe ich überhaupt keine Ahnung, was gerade wirklich in ihm vorgeht, denn im Gegensatz zu ihm habe ich keine Kinder.“

»Medien sind manchmal wie ein Prisma. Und so ein Prisma krümmt das Licht.«
Danach kommt Kyrylo wieder auf seinen neuen Arbeitsalltag zu sprechen. Aus journalistischer Sicht sei er sehr dankbar um die Rolle, die er jetzt innehabe. Denn die Armee – und damit auch er – hätte einen viel besseren und ungefilterten Zugang zu den Geschehnissen und der tatsächlichen Situation an der Front. „Medien sind manchmal wie ein Prisma“, sinniert er. „Und ein Prisma krümmt das Licht. Aber jetzt bin ich persönlich so nah an der Lichtquelle, dass es keine Krümmung mehr gibt.“
Davon abgesehen habe der neue Job den Vorteil, dass er all die vielen Rollen, in die er vorher je nach Auftrag schlüpfen musste, in einer einzigen vereine könne. „Ich bin jetzt Übersetzer, Kontaktperson, Produzent, Autor, Fotograf und Kameramann in einem“, sagt Kyrylo.

»Bei fast allen ukrainischen Männern ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihnen die Armee ihre berufliche Zukunft raubt.«
Nur eines ist er gerade nicht: Schauspieler – jener Beruf, den er ursprünglich mal gelernt hat. Und den er wahrscheinlich nach wie vor ausüben würde, wenn Putins Russland nicht die Ukraine mit einem mörderischen Angriffskrieg überzogen hätte; oder zumindest, wenn Kyrylo nach den Kinopremieren Ende März einfach in Paris, Brüssel oder Berlin geblieben wäre.
Ob er jemals wieder auf einer Theaterbühne stehen wird, weiß er nicht. „Durch die Mobilisierung ist es bei fast allen ukrainischen Männern nur eine Frage der Zeit, bis die Armee ihnen ihre berufliche Zukunft raubt“, sagt er am Ende seiner Sprachnachricht.
Aber immerhin würde ihm der neue Job bei der Armee körperlich sehr gut tun, stellt Kyrylo fest. Er habe bereits etwas Gewicht verloren und ernähre sich nicht mehr so ungesund wie vorher. „Das Essen beim Militär ist zwar nicht überragend. Aber immerhin stopfe ich nicht mehr ständig Chips und Süßigkeiten in mich rein.“
Da ist er plötzlich wieder, jener besondere Humor des Kyrylo Sirchenko, der für viele um ihn herum nur schwer zu fassen ist, aber der ihm tagtäglich beim Überleben hilft. Und mit dem er sich hoffentlich seine Empathie zurückzuholen kann – irgendwann, wenn dieser Krieg ein Ende hat und die Ukraine ihre Freiheit wieder.

Gerne möchten auch wir die von Kyrylo erwähnte Hilfsorganisation „Hospitallers“ finanziell unterstützen.
Dazu sammeln wir bis zum 31. August 2024 über unseren offiziellen PayPal-Account (donate@myp-magazine.com, Account-Inhaber Herausgeber Jonas Meyer) finanzielle Zuwendungen, die wir dann am 1. September 2024 den „Hospitallers“ als Gesamtsumme zukommen lassen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch Dich für eine kleine „Donation“ gewinnen könnten – jeder Euro hilft!
Alle Infos zu der Organisation gibt es hier.
Wichtiger Hinweis: Da das MYP Magazine weder ein eingetragener Verein noch eine gemeinnützige Organisation ist, können wir keine Spendenbescheinigung für Deine Zuwendung ausstellen.
Update:
Unsere Sammelaktion ist abgeschlossen. Dank Eurer Hilfe konnten wir insgesamt 173,06 Euro zusammenbringen, die wir auf 300 US-Dollar (282,44 Euro) aufgestockt und am 9. September 2024 an die Hospitallers gesendet haben.
Wir danken von Herzen allen Unterstützer*innen!
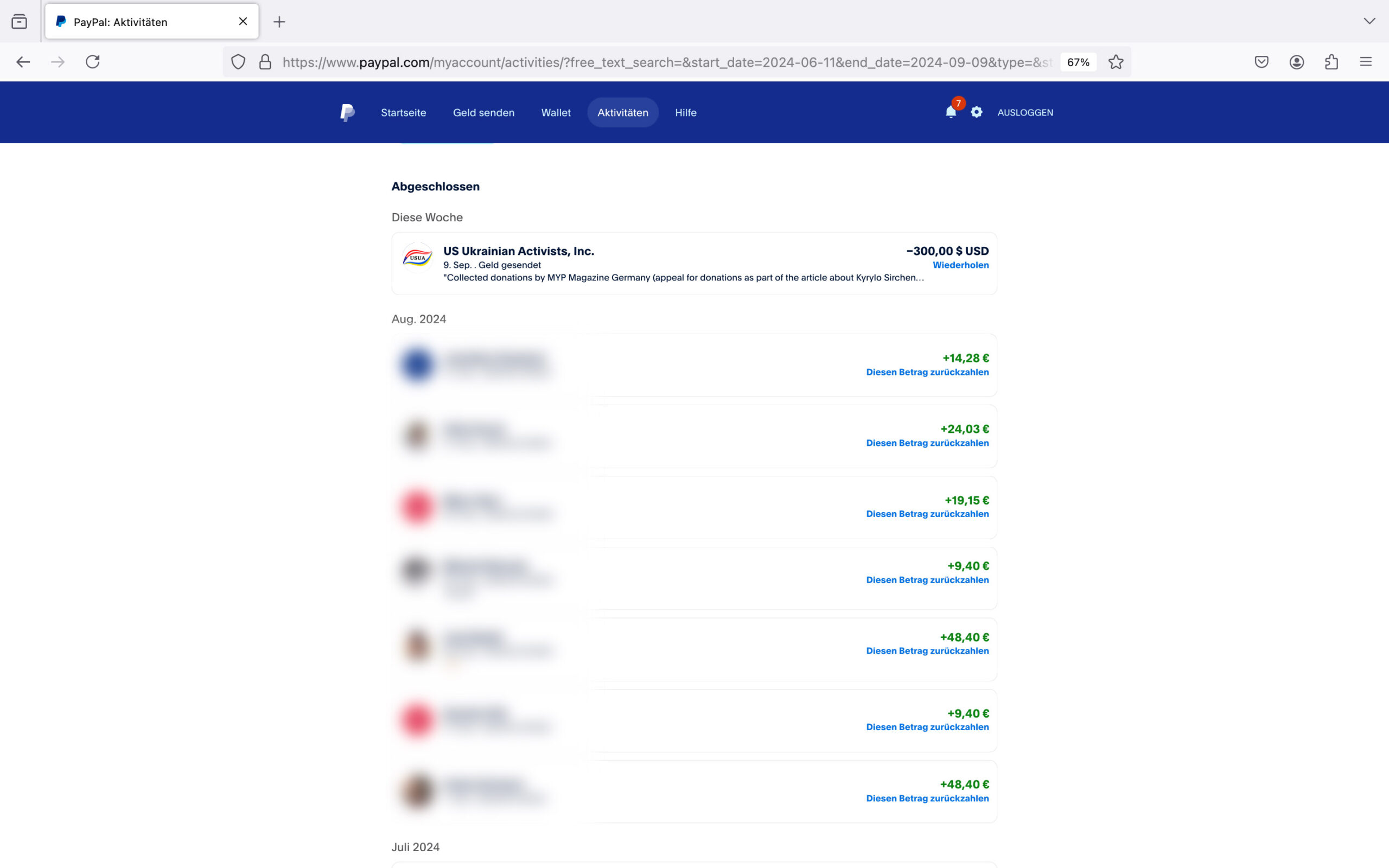
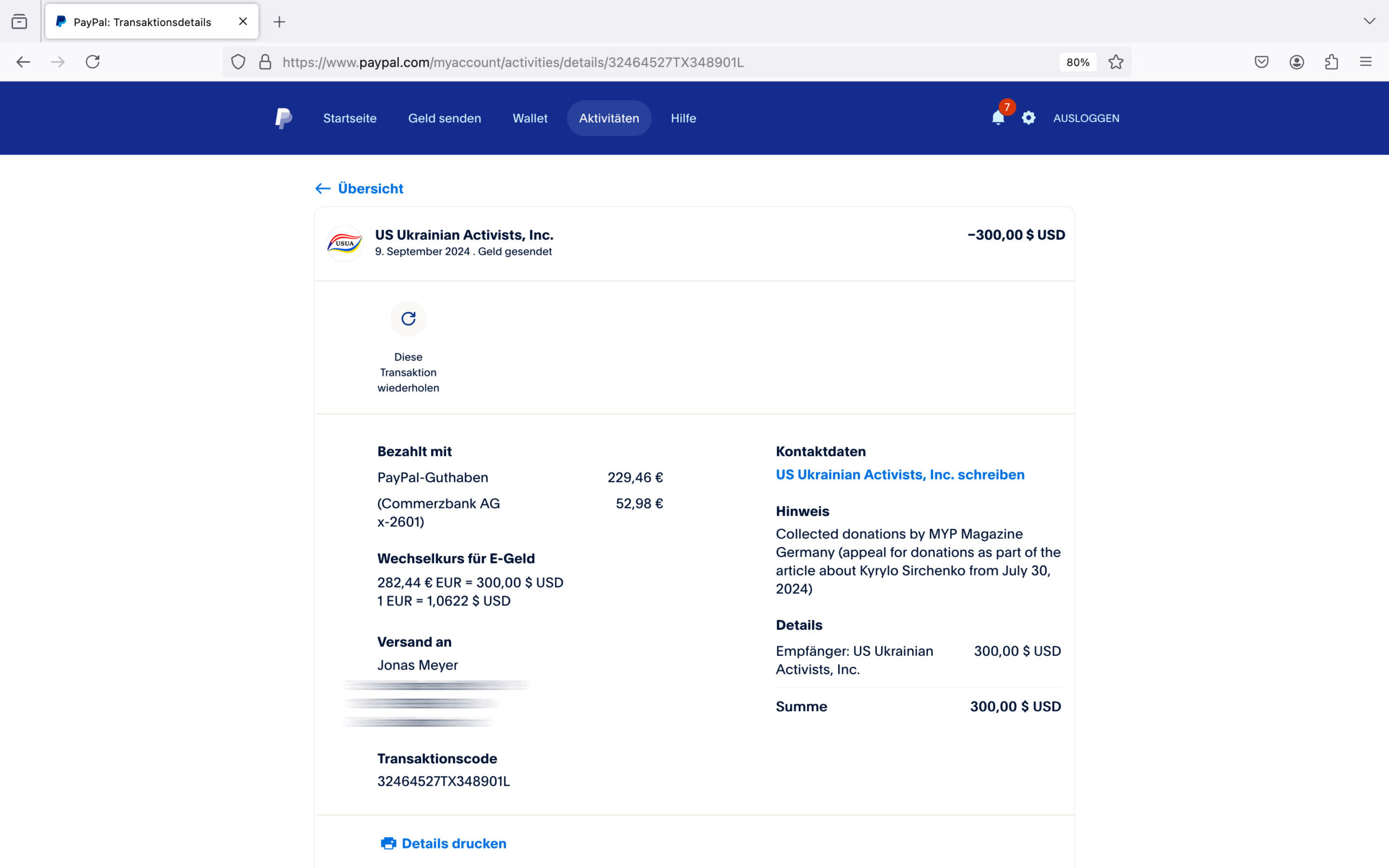
Ukraine: Fixer im Krieg, die stillen Helfer der Reporter
Eine Reportage von Arte und Reporter ohne Grenzen (28 Min.)
Verfügbar in der Arte-Mediathek bis zum 29. März 2027
Mehr von und über Kyrylo Sirchenko:
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Kristina Ursylyak
Robert Stadlober
Interview — Robert Stadlober
»Goebbels ist sich permanent selbst auf den Leim gegangen«
Es war eine Qual für ihn, sagt Robert Stadlober über seine Rolle als Joseph Goebbels im Kinofilm »Führer und Verführer«. Kein Wunder, denn der Schauspieler ist selbst ein feuriger Redner – allerdings mit antifaschistischer Leidenschaft: ein Gespräch über mächtige Manipulatoren, einbahnstraßenhafte Diskurse, den Berliner Buddhismus und die Kraft von Kurt Tucholsky, mit dessen Werk er sich reinwaschen konnte von all dem Nazi-Wahnsinn.
11. Juli 2024 — Text: Katharina Viktoria Weiß, Fotografie: Frederike van der Straeten

Privat tourt Robert Stadlober (41) gerade mit den Gedichten von Pazifist und Antimilitarist Kurt Tucholsky durch Deutschland, im Kino dagegen sieht man ihn zurzeit als einen der – im negativen Sinne – berühmtesten Hetzer der Welt: Joseph Goebbels. Eine reizvolle Casting-Entscheidung, denn Stadlober galt lange Jahre als Punk des deutschen Kinos. Nun motiviert der charismatische Darsteller das deutsche Volk als Hitlers Propagandaminister zum „totalen Krieg“.
Der Film selbst ist vielleicht der wichtigste des Jahres: Er nimmt seine Chronistenpflicht ernst und erzählt faktenreich die Hintergrundgeschichte der Propaganda des Dritten Reichs. Teilweise durchbrechen dokumentarische Elemente die vierte Wand, wie zum Beispiel Kommentare der 102-jährigen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer.
Um das beispiellose Grauen der Nazidiktatur zu zeigen, benutzt der Film echtes Bildmaterial von Erschießungskommandos oder aus Konzentrationslagern. Lediglich den Szenen, die sich mit den Handlungen der Parteiobrigkeit befassen und die in der Regel hinter verschlossenen Türen stattfanden, werden von Fritz Karl als Adolf Hitler und Robert Stadlober in der Rolle des Joseph Goebbels cineastisch illustriert.
Dass der „Führer“ einst von der Kunstakademie in Wien abgelehnt wurde, ist bekannt. Aber auch Goebbels bemühte sich darum, ein klassischer Weimarer Schöngeist zu werden: Aufgrund seines Klumpfußes durfte er nicht zum Militär und studierte stattdessen Germanistik, und das bis zum Doktortitel. Allerdings wurde seine Bewerbung unter anderem von der damals überregionalen Tageszeitung „Berliner Tageblatt“ abgelehnt. Stattdessen nahm ihn das Parteiorgan der NSDAP als Schreiberling.


»Wenn Hitler und Goebbels irgendwo künstlerisch untergekommen wären, dann sicher nur bei Leuten, die ihres eigenen Geistes Kind gewesen wären.«
MYP Magazine:
Wie viel Künstler steckt in Deinem Goebbels?
Robert Stadlober:
Natürlich steckt in ihm eine gewisse Kreativität, das ist aus moralischer Sicht erst mal nicht bewertbar. Dennoch wären sowohl Hitler als auch Goebbels sicher nicht zu Feingeistern der Weimarer Republik geworden. Von Hitler kennt man nur biedere Landschaftsmalereien. Und den Goebbels-Text sieht man an, dass er versucht hat, eine Welt zu verhindern, die bereits in der Weimarer Republik begonnen hat. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs sahen viele Menschen eine unglaubliche Chance darin, ein neues gesellschaftliches Zusammenleben zu erfinden – und ich glaube, jegliche Arbeit von Goebbels, auch die kreative, stand dem entgegen.
Wenn beide daher irgendwo künstlerisch untergekommen wären, dann sicher nur bei Leuten, die ihres eigenen Geistes Kind gewesen wären. Und da sie das nicht geschafft haben, versuchten sie es schließlich über die Sphäre der Politik und trampelten alles kaputt, was an der Weimarer Republik frei und öffnend war. In dem Staat, den die beiden dann geschaffen haben, herrschte eine „Kultur“, die in ihren ästhetischen Überzeugungen dem Talent der beiden entsprach.

»Der italienische Futurismus hatte durchaus progressivere Ansätze als dieser Bierkeller-Nationalismus von Hitler.«
MYP Magazine:
Goebbels inszenierte sich als Liebhaber der schönen Künste – oder zumindest der schönen Künstlerinnen. Gerade mit der Filmbranche war er eng verbandelt. Welche Details und Anekdoten aus diesem Teil seiner Biografie haben Dich besonders überrascht oder berührt?
Robert Stadlober:
Im Vergleich zu vielen anderen Figuren der späteren NS-Führungsriege war Goebbels tatsächlich vom italienischen Futurismus beeinflusst. Der führte zwar später auch in den Faschismus, hatte aber durchaus progressivere Ansätze als dieser Bierkeller-Nationalismus von Hitler. Ich fand es spannend, dass Goebbels es geschafft hat, Hitler davon zu überzeugen, dass man einen Unterhaltungsfilm braucht, der näher an dem tatsächlichen Leben der Menschen ist. Hitler hat ihn an diesem Punkt oft wieder eingefangen. Aber letztlich war Goebbels schon ein „moderner Mensch“. Das erklärt auch sein Interesse am Film, der damals die modernste Kulturform war. Und eben auch sein Interesse an den Machern und Macherinnen des Films – wie etwa den Schauspielerinnen.

»Goebbels war der Erste, der verstanden hat, dass man die Politik in den Unterhaltungsfilm hineinschreiben kann.«
MYP Magazine:
War Goebbels’ Nähe zum Kunst- und Kulturbetrieb entscheidend für die Art und Weise, wie Ihr euch die Rollen erarbeitet habt?
Robert Stadlober:
Ganz entscheidend für ihn ist, dass er zwei Sphären zusammengebracht hat, die bis dahin nichts miteinander zu tun hatten: Zum einen die Politik und zum anderen die Ästhetik, die Kunst, die Kultur. Vor seiner Ära stand auf dem Marktplatz eine Kiste herum. Da hat sich einer draufgestellt und eine politische Rede gehalten. Das hat man sich vielleicht kurz angehört und ist danach ins Theater gegangen. Goebbels war dann der Erste, der verstanden hat, dass man die Politik in den Unterhaltungsfilm hineinschreiben kann. Und dass die Leute, die bei einem amourösen Tête-à-Tête ins Kino gehen, nach ihrem letzten Kuss aus dem Film rauskommen und auf einmal die NSDAP wählen wollen. Heute sind solche Suggestiv-Techniken ganz normal. Das fängt schon bei der Shampoo-Werbung an, da werden einem Sache untergejubelt, von denen man am Ende glaubt, man wäre selbst darauf gekommen.

»Wir versuchen das zu zeigen, von dem Goebbels verhindern wollte, dass es gezeigt wird.«
MYP Magazine:
Euer Film „Führer und Verführer“ versucht jedoch, hinter die Manipulation zu blicken…
Robert Stadlober:
Exakt. Wir stellen Momente nach, die zu diesem Grauen geführt haben und die Menschen dazu verleitet haben, bei dem ganzen Wahnsinn mitzumachen. Die Grundprämisse unseres Films ist, dass wir versuchen das zu zeigen, von dem Goebbels verhindern wollte, dass es gezeigt wird. Sein gesamtes Schaffen und auch sein privates Leben waren eine einzige Inszenierung. Das merkt man an seinen Tagebüchern. Die hat er für einen sehr hohen Vorschuss verkauft, bevor sie überhaupt geschrieben waren. Man merkt den Texten an: Er schreibt in seinem privaten Tagebuch klar für ein Publikum.

»Gegenüber Leuten, die sie als Kollaborateure, Mittäter oder Großfinanziers gewinnen wollten, haben Sie andere Töne angeschlagen.«
MYP Magazine:
Hitler wurde bereits in etlichen Filmen gespielt und ist bei den Zuschauenden mit sehr spezifischen Vorstellungen bezüglich Auftritt, Stimme oder Körperhaltung verbunden. In Eurem Film wirkt er anders.
Robert Stadlober:
Da gibt es eine schöne Anekdote: Einige Monate vor unserem Film hatte Fritz Karl, der Hitler spielt, ein anderes Angebot, bei dem er ebenfalls den „Führer“ verkörpern sollte. Zur Vorlage hatte er sich die einzige Tonaufnahme von Hitler genommen, die ohne dessen Wissen und ohne Inszenierung aufgenommen wurde, und zwar auf einer Zugreise durch Finnland. Nachdem der Regisseur ihn beim Casting gehört hatte, sagte er zu Fritz Karl: „Sie haben ja überhaupt gar nichts verstanden.“
Aber eigentlich hatte er es sehr genau verstanden. Denn die Tonaufnahmen, die wir von Adolf Hitler kennen, sind immer Inszenierung in der Kraft. Privat hat er so nicht gesprochen. Seine Sprache ist eine Bühnensprache, wie sie damals übrigens von den meisten Politikerinnen und Politikern verwendet wurde. Wir empfinden das heute als Nazi-Deutsch, aber so haben auch Leute aus der SPD oder Kommunisten gesprochen – auch wenn es bei Hitler und Goebbels natürlich wieder in etwas Wahnhafteres gekippt ist.
Es ist aber wichtig zu wissen: Die haben sich nicht die ganze Zeit angeschrien. Gegenüber Leuten, die sie als Kollaborateure, Mittäter oder Großfinanziers gewinnen wollten, haben Sie andere Töne angeschlagen.

»Das Interessante ist, dass Goebbels keine gefestigte politische Meinung hatte.«
MYP Magazine:
Du scheinst „Deinen“ Goebbels auch mit viel Lebensfreude zu spielen, die Figur hat oft etwas unternehmerisches – wie jemand, der in einer Werbeagentur arbeitet. War das Absicht?
Robert Stadlober:
Goebbels war ein Charmeur. Lída Baarová, die Frau, mit der er ein langes Verhältnis hatte und in die er wirklich wahnsinnig verliebt war, sagte später über ihn: Sie habe diesen Menschen gar nicht richtig gekannt, sie war stattdessen verliebt in seine Liebe. Sie war verliebt in die Art und Weise, wie er um sie geworben hatte.
MYP Magazine:
Fängt man irgendwann an, die Geniestreiche dieses Massenmörders zu bewundern?
Robert Stadlober:
Nein, bewundern ist das falsche Wort. Das Interessante ist, dass Goebbels keine gefestigte politische Meinung hatte. Er war am Anfang nicht der glühende Antisemit, der Hitler immer war. Goebbels diente sich verschiedensten politischen Strömungen an und landete dann irgendwann bei dem sozialrevolutionären Flügel der NSDAP im Rheinland, der mit der Hitler-Bewegung in Bayern eigentlich nichts zu tun hatte. Irgendwann in den 1920er-Jahren hat er dann Hitler sprechen gesehen – und war sofort tief beeindruckt von diesem Mann, was er auch in seinen Tagebüchern schreibt. Danach konzentrierte er alle seine Anstrengungen darauf, Anerkennung von seinem neuen Vorbild zu erhalten, und richtete dementsprechend auch seine Politik auf ihn aus.

»Das zeugt von einer möglicherweise dissoziativen Persönlichkeitsstörung.«
MYP Magazine:
Gab es auch mal Uneinigkeiten zwischen „Führer“ und „Verführer“?
Robert Stadlober:
Später, während es Krieges, beobachten Historiker, dass es viele Entscheidungen Hitlers gab, die Goebbels zunächst abgelehnt hatte. Den Angriff auf die Sowjetunion zum Beispiel fand er absurd. Doch dann gab es eine längere Unterredung mit dem „Führer“, und am nächsten Tag schrieb Goebbels in sein Tagebuch, dass dies der genialste Schachzug der Außenpolitik in der gesamten Menschheitsgeschichte gewesen sei. Goebbels ist sich also permanent selbst auf den Leim gegangen. Nach der berühmten Sportpalast-Rede schrieb er auf, wie sehr er sich über das gute Presseecho seiner Rede gefreut hätte. Dabei hatte er die guten Pressekritiken im Prinzip selbst geschrieben, da er den Journalisten entsprechende Anweisungen gegeben hatte, was sie am nächsten Tag in ihren Zeitungen schreiben sollten.



»Ich bin da durchgerast in einer absoluten Manie, das hatte mit Spaß überhaupt nichts zu tun.«
MYP Magazine:
Hat es auf eine perfide Art auch Spaß gemacht, das zu spielen?
Robert Stadlober:
Es war eine absolute Qual, eine wirkliche Tortur. Wir hatten nur 24 Drehtage, was sehr wenig ist. Ich habe jeden Tag seitenweise Text geredet. Ich bin da durchgerast in einer absoluten Manie, das hatte mit Spaß überhaupt nichts zu tun. Ich habe es keine Sekunde genossen, das zu machen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich meine Instrumente nutzen kann, um wichtige Sachverhalte und Fragen aufzuwerfen – etwa die, wie man das Manipulationspotenzial von Film durch das Medium Film aufdecken kann: Das hat mich daran interessiert, deshalb war ich bereit, mich darauf einzulassen.

»Die AfD-Trolle finden alles, was sie von dem Film gesehen haben, scheiße – das ist der beste Beweis dafür, dass der Film sehr gut ist.«
MYP Magazine:
Gab es bereits Reaktionen aus der rechtsextremen Blase zu Eurem Film?
Robert Stadlober:
Man muss natürlich heutzutage Trailer und anderes Material auf Social Media ausspielen. Aber leider merkt man sehr schnell, dass das so Honigtöpfe sind, in denen sofort alle AfD-Trolle drinhängen – und die in den Kommentarspalten vom Grün-Rot-faschistischen Regime in Berlin sprechen. Die finden alles, was sie von dem Film gesehen haben, scheiße – und das ist, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass der Film sehr gut ist. Denn er ist dafür gedacht, dass ihn solche Leute richtig scheiße finden.
MYP Magazine:
Weil es nichts Verherrlichendes gibt?
Robert Stadlober:
Genau. Ich finde niemanden in diesem Film, den ich verstehe. Da gab es überhaupt keinen Moment, in dem ich dachte: Jetzt wird es für mich menschlich nachvollziehbar, wie man so grausam sein kann. Ich möchte Goebbels auch nicht psychologisch verstehen. Ich möchte nichts von dem, was er getan hat, mit irgendeinem Leid, das er in seiner Kindheit erlitten hat, entschuldigen. Mit dem Film ging es uns um geschichtliche Tatsachen, die wir bebildern müssen, da es die Originalbilder dafür nicht gibt – weil er sie verhindert hat.

»Es ist schockierend, wie einbahnstraßenhaft Diskurse mittlerweile funktionieren.«
MYP Magazine:
Propaganda und Desinformation gehören zu den wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit. Gab es in Deinem privaten Leben auch schon Situationen, in denen Du mit Mechanismen der Medienmanipulation und -kontrolle konfrontiert warst?
Robert Stadlober:
Goebbels hatte mit der Nutzung des Massenmediums Radio einer ganzen Nation das Gefühl gegeben, nah am vermeintlichen Zeitgeschehen zu sein. Das tragen wir jetzt permanent in unserer Hosentasche. Und wir bilden uns auch noch ein, dass wir selbst bestimmen, wer dieses Radio spielt. Die Manipulation durch Algorithmen und Echokammern ist so extrem, dass ich nicht glaube, dass man heute schon die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklung überblicken kann. Es ist schockierend, wie einbahnstraßenhaft Diskurse mittlerweile funktionieren – durch jene Medienformen, die uns ständig suggerieren: Es ist etwas ganz Schlimmes passiert und du darfst hautnah mit dabei sein.

»Es waren schon immer viele Dinge schlecht auf der Welt. Wir wissen heute nur mehr darüber.«
MYP Magazine:
Endzeitstimmung also?
Robert Stadlober:
Es sind viele Dinge schlecht auf der Welt, mit Sicherheit. Aber es waren auch schon immer viele Dinge schlecht auf der Welt. Wir wissen heute nur mehr darüber. Und die große Gefahr ist, dass man sich in diesen Strudel der Negativität hineinziehen lässt. Das einzige Instrument dagegen ist aus meiner Sicht, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, aus seiner Echokammer herauszutreten und mal in der U-Bahn nach links oder rechts zu gucken.

»Was ist eure Einladung an die Menschen? Die Einladung muss doch sein, dass wir das schönere Leben bauen.«
MYP Magazine:
Wie nimmst Du aktuelle politische Diskurse wahr?
Robert Stadlober:
Ich erlebe eine unglaubliche Verengung – und das nicht nur in rechter Politik, sondern auch in den vermeintlich progressiveren Lagern: Einmal das falsche Wort gesagt, sofort bist du draußen. Es wird permanent auf alle eingeschrieben. Es gab Wahlkampfplakate zur Europawahl, auf denen stand: „Gegen Hass, gegen Hetze“. Da frage ich mich: Das ist euer politisches Programm? Das sollte doch die Grundvoraussetzung sein! Aber wo wollt ihr denn hin? Was ist eure Einladung an die Menschen?
Die Einladung muss doch sein, dass wir das schönere Leben bauen. Und dass wir wollen, dass die Menschen da mitgehen. Unsere Party ist doch ganz klar die schönere, weil wir keinen Jägerzaun darum herumgezogen haben. Sondern weil es eine Welt ist, in der verschiedenste Meinungen und Hintergründe nebeneinander existieren können.

»Das System der Kultur im 21. Jahrhundert ist ein zutiefst ungerechtes.«
MYP Magazine:
Auf der einen Seite gibt es politische Propaganda und investigative Berichterstattung. Auf der anderen Seite gibt es den Kino- und Kulturbetrieb, der andere Regeln hat. Schaust Du nach dem Dreh dieses Films anders auf selbstverständliche Praktiken Deiner Branche?
Robert Stadlober:
Ich schaue schon immer anders auf selbstverständliche Praktiken in meiner Branche – und da gibt es wahnsinnig viel Hinterfragenswertes. Das System der Kultur im 21. Jahrhundert – und auch in den 20, 30 Jahren davor, die ich persönlich überblicken kann – ist ein zutiefst ungerechtes. Zum demokratischen Diskurs gehört immer dazu, die Sprecherposition in Frage zu stellen und zu beleuchten: Warum hast du jetzt gerade die Hoheit über mich?

»Geschichten kann man am besten erzählen, wenn man bei sich selbst anfängt.«
MYP Magazine:
Was ist mit dem Thema Schönfärberei? Wie stark muss man sich in Deiner Branche verstellen, um einen gewissen Marktwert zu erlangen?
Robert Stadlober:
Klar, auch ich kenne Leute, die vorne das eine erzählen und privat etwas ganz anderes leben. Das finde ich persönlich schwierig. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu naiv in der Art und Weise, wie ich Kultur mache. Das kommt bei mir aus einem anderen Antrieb. Mir geht’s nicht um den Karrieregedanken, sondern tatsächlich darum, Geschichten zu erzählen. Und die kann man am besten erzählen, wenn man bei sich selbst anfängt – aber dafür muss man mit sich und seinem Publikum ehrlich sein.

»Dieses sich selbst darstellen – das ist ein ungemütlicher Teil der ganzen Geschichte.«
MYP Magazine:
Du hattest bereits als Teenager Deinen Kino-Durchbruch. Wie hat sich in den letzten Jahrzehnten Dein Verhältnis dazu, Dich selbst darstellen zu müssen, verändert?
Robert Stadlober:
Dieses sich selbst darstellen – das ist ein ungemütlicher Teil der ganzen Geschichte. Eigentlich geht es in meinem Beruf darum, andere darzustellen. Mich selbst stelle ich nur dar, um die Sachen zu verkaufen, in denen ich andere dargestellt habe. Mein Verhältnis dazu ist unverkrampfter geworden.
Ich hatte früher viel mehr Angst davor, was die Leute von mir denken. Aber wenn man lange genug etwas macht – oder vielleicht, wenn man lange genug gelebt hat – merkt man irgendwann, dass viele meistens eh nur irgendeinen Scheiß denken. (reimt)
Sie reden und reden,
über alle und über jeden,
die ganz besonders Blöden,
die reden über dich.

»Ich fand schon immer all jene faszinierender, die genau das gemacht haben, was man nicht erwartet hat.«
MYP Magazine:
Vom Leistungsgedanken bist Du also eher genervt?
Robert Stadlober:
Ja, ich habe darauf schon immer keinen Wert gelegt und fand all jene faszinierender, die genau das gemacht haben, was man nicht erwartet hat. Dabei ist es übrigens ein Irrtum, dass man immer irgendetwas Neues für sich oder andere erschaffen und entdecken muss.
In „Es gibt keinen Neuschnee“ erklärt Tucholsky: Egal, wie weit du nach oben kletterst, irgendjemand war schon vor dir auf dem Berg. Aber für dich ist es neu – und das reicht doch vollkommen! Er sagt: Klettere, steige, steige! Aber es gibt keine Spitze. Und es gibt keinen Neuschnee.
Das ist Berliner Buddhismus. Wenn die Leute das ein bisschen mehr verinnerlichen würden, würden sie sich auch nicht permanent gegenseitig auf die Nerven gehen. Lasst die Leute das machen, was sie gerne machen – und gebt ihnen den Raum, dass daraus etwas Gemeinsames entstehen kann, das viel schöner ist als die Sage von dem Einen, der es erreicht hat. Ich will, dass alle zusammen Schönes erleben.
MYP Magazine:
Man sollte über die Wanderungen reden, nicht über das Ziel?
Robert Stadlober:
Das ganze Leben ist so – weil das Ziel schlussendlich der Sarg ist.
MYP Magazine:
Hast Du diese Gelassenheit, weil Du bereits als Teenager das erreicht hattest, worauf andere viele Jahre warten?
Robert Stadlober:
Mit 20 habe ich mir ein ganz anderes Leben vorgestellt oder möglicherweise auch erträumt. Aber ich bin extrem froh und zufrieden mit dem Leben, jetzt mit 41. Ich möchte all das gar nicht haben, was ich mir mit 20 Jahren erträumt habe.

»Tucholsky hat mich reingewaschen von diesem Nazi-Wahnsinn.«
MYP Magazine:
„Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut“ – so heißt Dein neues Herzensprojekt, bei dem Du Gedichte von Kurt Tucholsky vertont hast. Was ist mit Deinen Gedankengängen passiert, als du diese beiden Männer, mit denen Du dich aktuell so viel beschäftigt hast, zusammen gedacht hast?
Robert Stadlober:
Tucholsky hat mich reingewaschen von diesem Nazi-Wahnsinn. Die Beschäftigung mit seinem Werk war eine direkte Folge aus dem Arbeiten an Goebbels. Tucholsky hat sich schon 1938 wegen dem umgebracht, was in Europa durch die Nazis passiert ist. Er hatte immer eine unglaubliche Liebe zu den Unterschieden im Menschsein und hat das auch total gefeiert. Das gibt mir eine enorme Kraft und auch den Mut zu wissen: Ich kann jetzt diese Platte machen und werde dafür nicht verhaftet und geschlagen. Und der Grund dafür ist, dass Goebbels nicht gewonnen hat. Er hat unvorstellbares Leid über Europa gebracht, aber schlussendlich haben wir gewonnen. Wir sind die Sieger. Wir können frei hier sitzen, vor dem „Diener Tattersall“, Bierchen trinken und Zeugs labern – das ist doch wirklich wunderbar.

»Führer und Verführer« (135 min., Regie: Joachim A. Lang) ab dem 11. Juli 2024 im Kino.
Mit besonderem Dank an den »Diener Tattersall«:
Mehr von und über Robert Stadlober:
Interview & Text: Katharina Viktoria Weiß
Fotografie: Frederike van der Straeten
Wanda
Interview — Wanda
»Mit einer Verantwortung zu leben, ist deutlich besser«
Mit ihrem sechsten Studioalbum melden sich Wanda fulminant zurück: »Ende nie« ist eine Platte voller lyrischer und instrumentaler Goldstücke, auf der die österreichische Rockband ihre gesamte Lebens- und Musikerfahrung zusammenführt – und gleichzeitig zwei private Katastrophen verarbeitet. Ein Interview über reife Musik von reifen Menschen, das Nebeneinanderstehen von Euphorie und Trauer und eine komisch-wilde Phase im Leben von Marco Wanda, in der er Harry Styles sein wollte.
8. Juni 2024 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

„Der nächste Song ist für alle, die jemanden verloren haben“, ruft Marco Wanda mit gefasster Stimme ins Mikrofon. Es ist der Abend des 7. Mai, zusammen mit seinen Bandkollegen Reinhold „Ray“ Weber am Bass und Manuel „Manu“ Poppe an der Gitarre hat er gerade zwei Stunden lang das Potsdamer Waschhaus zum Beben gebracht.
Marco hält einen Moment inne, dann fügt er hinzu: „Das betrifft ja wahrscheinlich alle hier. Denn so ungeküsst geht niemand durchs Leben.“ Wenige Sekunden später schlägt der 37-Jährige auf dem Klavier die ersten Töne zu „Bei niemand anders“ an.
Dieses Lied, das kann man nicht anders sagen, hat es in sich. Nicht nur, weil es einem bereits nach dem ersten Hören einen Ohrwurm einpflanzt, der absolut keine Anstalten macht, sein neues Zuhause wieder zu räumen. Sondern auch, weil „Bei niemand anders“ zu dem Gefühlvollsten, Ehrlichsten und Nahbarsten zählt, was die Wiener Rockband jemals in die Welt geworfen hat.
Dieser Song war es auch, mit dem Wanda im November 2023 ein erstes musikalisches Lebenszeichen sendete, nachdem die Band innerhalb kürzester Zeit von zwei Katastrophen überrollt wurde. Zuerst starb im September 2022 der Keyboarder und Wanda-Mitbegründer Christian Hummer. Und wenige Monate später verlor Marco auch noch seinen Vater. Hätte die Band an dem Punkt alles hingeschmissen, ganz ehrlich, man hätte es verstanden.
Doch es war Sebastian „Zebo“ Adam, der Wanda half, wieder zurück ins künstlerische Leben zu finden. Der Produzent, der als Gitarrist auch Teil der Live-Besetzung ist und an diesem Abend in Potsdam mit auf der Bühne steht, schuf für die Band einen sicheren Raum, in dem Marco, Ray und Manu über Monate und ganz behutsam an einem neuen Album arbeiten konnten.
„Ende nie“ heißt das gute Stück, gerade hat es das Licht der Welt erblickt. Es ist das mittlerweile sechste Studioalbum der Österreicher, die sich 2012 als fünfköpfige Combo gegründet hatten und nach Christians Tod und dem Ausscheiden von Drummer Lukas Hasitschka im Jahr 2020 nun „nur“ noch zu dritt sind. Eröffnet wird die neue Platte von „Bei niemand anders“, es folgen elf weitere kleine und große Goldstücke, mit denen man Wanda auch mal von einer anderen Seite kennenlernen darf, stilistisch wie inhaltlich. Ganz am Ende des Albums scheint sogar mal der Geist von Rio Reiser durch die Lautsprecher zu schweben. Aber dazu später mehr.
Am 28. März 2024, dem Tag der Veröffentlichung ihrer dritten Single-Auskopplung „Jeder kann es sein“, haben wir Marco, Ray und Manu in Berlin zu einem sehr persönlichen Interview und einem noch persönlicheren Fotoshooting getroffen.

»Solange ich das Video noch nicht gesehen habe, ist der Song für mich auch noch nicht auf der Welt.«
MYP Magazine:
Wir wünschen Euch einen happy release day, wie man in der Musikindustrie so schön sagt. Aber sind solche Tage nach 14 Jahren Wanda überhaupt noch etwas Besonderes für Euch?
Marco:
Klar! Mich berührt immer noch jeder einzelne Single-Release – vor allem, wenn er mit einem Musikvideo verbunden ist. An so einem release day schnappe ich mir abends ein Fläschchen Weißwein, setze die Kopfhörer auf und habe ein großes Privatvergnügen daran, dem neuen Song mit den Augen und Ohren eines Fremden zu begegnen. Erst in diesem Moment erschließt sich mir unsere Musik zur Gänze – und solange ich das Video noch nicht gesehen habe, ist der Song für mich auch noch nicht auf der Welt. Daher ist es für mich total spannend, den Moment der Geburt live mitzuerleben.
»Das Leben zu besitzen ist die größte Komödie, die ich mir vorstellen kann.«
MYP Magazine:
„Jeder kann es sein“ – die Single, die Ihr heute veröffentlicht habt – wirkt wie die logische Ergänzung zu „De Kinettn wo I schlof“. In dem über 50 Jahre alten Song erzählt Wolfgang Ambros, wie es sich aus der Perspektive eines Obdachlosen anfühlt, für die Gesellschaft mehr oder weniger unsichtbar zu sein. Aus welchem Bedürfnis heraus habt Ihr „Jeder kann es sein“ geschrieben? Wolltet Ihr allen, die auf der Gewinnerseite des Lebens stehen, klar machen: Es hätte auch anders kommen können?
Marco:
„Jeder kann es sein“ ist das einzige Stück auf der Platte, bei dem ich selbst nicht wirklich weiß, worum es geht. Mich hat schlicht und einfach dieses Thema interessiert: die Einteilung von Menschen in Gewinner und Verlierer. Die Gewinner sind für mich gleichbedeutend mit denen, die leben. Und die Verlierer stehen für die, die sterben. Das Leben zu verlieren ist die größte Tragödie, die ich mir vorstellen kann. Und das Leben zu besitzen ist die größte Komödie, die ich mir vorstellen kann.
Aber eigentlich will ich den Text gar nicht so sezieren. Es handelt sich dabei immer noch um Lyrik – und die kann niemals eindeutig sein. Selbst wenn ich eine Zeile wie „der Himmel ist blau“ in einen Song hinein schreiben würde, gäbe es da immer noch ein riesiges Spektrum an Bedeutungen.

»Wir haben beim Arrangement der Musik darauf geachtet, dass nichts bremst.«
MYP Magazine:
Im Musikvideo zu dem Song sehen wir Euch im Smoking auf einer tropischen Insel. Habt Ihr euch von „Triangle of Sadness“ inspirieren lassen, jener erfolgreichen Kinokomödie aus dem Jahr 2022, in der das dekadente Leben der Luxus-Gesellschaft persifliert wird?
Marco:
Wir waren in der Bildsprache vor allem von „Saltburn“ beeinflusst. Die Regenschirme zum Beispiel sind eine eindeutige Hommage an diesen großartigen Film.
MYP Magazine:
Der inhaltlichen Tiefe von „Jeder kann es sein“ steht ein eher leichtfüßiger, tanzbarer und sehr eingängiger Sound gegenüber – eine Gegensätzlichkeit, die sich wie ein roter Faden auch durch die anderen Songs des neuen Albums zieht.
Manu:
Stimmt. Wir haben beim Arrangement der Musik darauf geachtet, dass nichts bremst – von der Bass Drum bis zu den Gitarren. Alles sollte ständig im Fluss sein und sich richtig schön locker-flockig anfühlen.

»Emotionen wie Euphorie und Trauer können in ihrem Extrem auch nebeneinanderstehen, und zwar permanent.«
MYP Magazine:
Dennoch ist bei allen zwölf Tracks auch eine gewisse emotionale Dringlichkeit zu spüren. Man muss immer wieder an die Katastrophen denken, die Euch in der jüngeren Zeit widerfahren sind. Aber bei all der Tragik will man sich auch permanent zu den eingängigen Hooks und Gitarrenklängen bewegen. War die Dualität aus ernsten Texten und energetischer Musik für Euch ein Weg, den Tod von Christian und Marcos Vater zu verarbeiten?
Marco:
Es gibt einen Satz von Leonard Cohen, der mich immer sehr beschäftigt hat: „There’s a crack in everything, that‘s how the light gets in.“ Das bringt es auf den Punkt. Ich glaube, man kann das Leben auf zwei verschiedene Arten leben: Man kann entweder in einer negativen Gefühlslage verharren wollen und dann in eine positive wechseln – und meistens sind beide sehr extrem. Oder man kann anerkennen, dass Emotionen wie Euphorie und Trauer in ihrem Extrem auch nebeneinanderstehen können, und zwar permanent.
Das ist übrigens etwas, das vor allem in der Wiener Kunst immer wieder zu beobachten ist. Bereits Gustav Klimt hatte in seinen Bildern den Tod in schillerndsten Farben dargestellt. Diese Ambivalenz ist zutiefst wienerisch und ich frage mich manchmal, ob so etwas in Deutschland überhaupt möglich wäre. Ich hatte mal ein Gespräch mit Sido, der mir sagte: „Hier in Deutschland musst du entweder total traurig oder total komisch sein. Irgendwo dazwischen geht nicht.“ Das ist hochinteressant, denn bei uns in Wien kann man nur Erfolg haben, wenn man genau die Mitte trifft – und nicht, wenn man nur eines von beiden Extremen bedient. Wir kommen da also aus einer gewissen Tradition.

»Ich habe schon sehr jung angefangen, mit der Musik zu weinen.«
MYP Magazine:
Nicht wenige Menschen machen die Beobachtung, dass sie mit zunehmendem Alter von Musik tiefer berührt werden und leichter mal ein Tränchen vergießen. Geht Euch das ähnlich?
Ray:
Ich habe schon sehr jung angefangen, mit der Musik zu weinen, und es gibt einige Lieder, die mich heute immer noch so berühren wie in meiner Kindheit und Jugend. Songs von Queen oder The Police zum Beispiel, die habe ich damals wirklich sehr, sehr viel gehört. Vor allem bei Queen war es so, dass ich manchmal stundenlang im Auto meiner Eltern saß und dabei drei Alben durchgehört habe, wenn wir irgendwo unterwegs waren. Ich habe zwar damals die Texte noch nicht verstanden, aber ich habe immer und immer wieder weinen müssen, wenn ich gehört habe, was Freddie Mercury da einfach so rausgehauen hat. Das ist eine Kindheitserinnerung, die mir immer noch sehr präsent ist.
Manu:
Mir geht’s da ganz ähnlich. Ich bin schon lange Fan von The Breeders und ich weiß noch gut, wie mir aus purer Freude das Wasser in die Augen geschossen ist, als ich die Band vor ein paar Jahren mal bei einem Konzert in Wien gesehen habe.
Marco: (nickt)
Für mich war das Musikhören schon in meiner Kindheit der Ort, an dem ich große Gefühle erleben konnte. Mal habe ich aus Freude geweint, mal aus Trauer, mal aus Ergriffenheit. Grundsätzlich aber hat Musik schon immer etwas in mir berührt.

»Das, was ich in letzten anderthalb Jahren erlebt habe, war auch für mich eine vollkommen neue Dimension.«
MYP Magazine:
Als Christian und kurz darauf Marcos Papa gestorben sind, wart Ihr Anfang, Mitte 30. In diesem Alter ist das Thema Tod für viele Menschen noch ganz weit weg. War die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens für Euch ebenso ein Debüt?
Marco:
Ich war damit leider schon häufiger konfrontiert – in meinem Leben sind bereits etliche Menschen gestorben. Aber das, was ich in letzten anderthalb Jahren erlebt habe, war auch für mich eine vollkommen neue Dimension. Wenn erst ein enger Freund und kurz darauf ein Elternteil geht, ist das absolut lebensverändernd. Wer so etwas noch nicht erlebt hat, steht da einfach sehr, sehr unwissend davor. Und ich glaube, diese Unwissenheit erzeugt eine gewisse Angst, da man plötzlich gezwungen ist, sich mit Tod und Vergänglichkeit zu beschäftigen. Ich persönlich würde auch empfehlen, sich mit dem Thema erst auseinanderzusetzen, wenn es wirklich so weit ist. Ansonsten würde man viel zu viel Energie und Zeit verschwenden, die man eigentlich noch als Geschenk hat – als Guthaben auf dem Konto des Lebens.

»Die Leute um uns herum hätten auch Verständnis dafür gehabt, wenn wir gesagt hätten: Wir lassen das jetzt ganz.«
MYP Magazine:
Wie haben Euer berufliches Umfeld und die Branche auf die Situation reagiert? Hattet Ihr Sorge, dass Ihr als Band in Zukunft auf das Thema Tod reduziert werdet?
Marco:
Wir haben um uns herum ein Team an fantastischen Menschen, die von Anfang an sehr unterstützend waren. Und ich erinnere mich: Nachdem wir am 30. September 2022 unsere letzte Platte veröffentlicht hatten, also wenige Tage nach Christians Tod, haben wir eine Woche lang absolut gar nichts gemacht. Erst dann ging es peu à peu weiter – ganz langsam wieder in Richtung Normalität. Dabei hätten die Leute um uns herum auch Verständnis dafür gehabt, wenn wir gesagt hätten: Wir lassen das jetzt ganz und sagen alles ab.
Wir haben das große Glück, dass unser berufliches Umfeld empathisch genug ist zu verstehen, dass man nicht alles von Menschen verlangen kann. Aber letztendlich waren wir es, die die Entscheidung getroffen haben, als Band weiterzumachen. Wir haben die Entscheidung getroffen, ein Album aufzunehmen. Wir haben die Entscheidung getroffen, innerhalb gewisser Grenzen darüber öffentlich zu reden.

»So etwas schauen Menschen in der Regel, um sich die Birne wegzuknallen. Und das ist auch völlig okay.«
MYP Magazine:
Ende 2023 seid Ihr bei der ARD-Show „Your Songs“ aufgetreten. Nachdem Ihr auf der Bühne den Song „Bei niemand anders“ gespielt habt, wurde Marco auf der Gästecouch von Moderatorin Jeannette Biedermann gefragt, wie man so ein exzessives Rockstar-Leben überstehen könne…
Marco: (lacht)
… es ist ja noch nicht überstanden!
MYP Magazine:
Auch Jeannette Biedermann lachte laut und bemerkte etwas flapsig: „Ihr habt’s überlebt!“ Das war ein sehr unangenehmer Moment, denn tatsächlich haben nicht alle von Euch überlebt. Wie ging es Dir in dieser Situation, Marco?
Marco:
In dieser Produktion wusste ich sofort, dass alle mit dem Thema überfordert sind – auf der menschlichen Ebene, nicht auf der professionellen. Mein Briefing für die Show war: Wir reden über Christian. Damit war eigentlich klar, dass sein Tod ein Thema sein wird. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass niemand sich getraut hat, darüber zu reden. Gleichzeitig hatte ich selbst nicht das Bedürfnis, das Ganze von mir aus anzustoßen. Und so wurde in der Show über Christian einfach nicht gesprochen – wahrscheinlich auch zum Glück. Denn am Ende ist „Your Songs“ ja eine leichte Unterhaltungsshow. So etwas schauen Menschen in der Regel, um sich die Birne wegzuknallen. Und das ist auch völlig okay.
MYP Magazine:
Aber geht man dann nicht von der Bühne und denkt sich, was war das denn?
Marco: (lächelt)
Das denk‘ ich mir immer!


»Älter werden heißt ja auch, dass man lebt.«
MYP Magazine:
Marco, Du hast in einem Spiegel-Interview, das im Rahmen dieser ARD-Show entstanden ist, von einem Traum erzählt, den Du vor einer Weile hattest: Du hast dich im Wohnzimmer Deiner Eltern befunden und warst eine Playmobilfigur, die aus ihrer Perspektive auf die Welt blickte und das wunderschön fand. Du hast die Tür eines kleinen Playmobil-Schuppens geöffnet, in dem Dein Papa saß. Er hat sich gefreut, Dich zu sehen – dann bist Du aufgewacht. Diesen Moment hast Du als „Ende der Kindheit“ bezeichnet. Kannst Du, könnt Ihr bei aller Tragik diesem Ende der Kindheit etwas Positives oder zumindest Hoffnungsvolles abgewinnen?
Marco:
Wenn ein Elternteil stirbt, dann ist man kein Kind mehr – weil man kein Kind mehr von jemandem ist. So hätte ich es damals erklären sollen.
Manu:
Ich bin froh, dass ich schon älter bin und immer älter werde. Älter werden heißt ja auch, dass man lebt.
MYP Magazine:
Seid Ihr durch die Ereignisse der letzten anderthalb Jahre auch angstfreier geworden?
Marco:
Ich glaube schon. Ich wüsste jetzt nicht, was da noch viel Schlimmeres kommen sollte.

»Es hat fast ein Jahr gedauert, diese Platte zu machen – für knapp 40 Minuten und ein Zehn-Euro-Abo auf Spotify.«
MYP Magazine:
Hat sich die Art und Weise, wie Ihr Musik macht, infolge der beiden Todesfälle verändert?
Marco:
Ja, und zwar fundamental – allein schon, weil wir nur noch zu dritt sind. Das ist ein völlig anderes Szenario. Daher fühlt sich die neue Platte auch wie ein Debütalbum an. Dazu kommt, dass zum ersten Mal jemand aus der Band ein Album mitproduziert beziehungsweise vorproduziert hat. Bereits vor anderthalb Jahren hatte ich Manu relativ viel Demo-Material geschickt, das er dann fast schon zu Ende arrangiert und wieder zurückgeschickt hat. Und auf dieser Grundlage sind wir überhaupt erst ins Studio gegangen. Das heißt, die neuen Songs hatten schon einen wichtigen Produktionsschritt durchlaufen, bevor sie aufgenommen wurden.
Das war für uns völlig neu. All die Jahre davor waren wir im Studio eigentlich wie die frühen Beatles. Soll heißen: ein Tag, ein Song, fertig. Alles lebte von dieser Energie, von dem Momentum, vom Rock’n’Roll, es durfte immer nur ein Take gespielt werden. Und diesmal war es so: Scheißegal, dann spielen wir halt hundert Mal das Gleiche – so lange, bis es passt. Wir haben uns also viel mehr Zeit genommen. Am Ende hat es fast ein Jahr gedauert, diese Platte zu machen – für knapp 40 Minuten und ein Zehn-Euro-Abo auf Spotify.
»Kurz bevor wir ins Studio gegangen sind, hing ich in einer sehr komischen und wilden Harry-Styles-Phase fest.«
MYP Magazine:
Dabei habt Ihr euch auch die Freiheit genommen, ein paar neue musikalische Pfade einzuschlagen. Der Song „Woher soll ich wissen“ zum Beispiel klingt wesentlich poppiger, als man von Euch gewohnt ist. Und „Niemand was schuldig“ fühlt sich an wie eine kleine Verneigung von Rio Reiser.
Marco:
Dadurch, dass das Album eine Art Debüt ist, hat sich zwangsläufig auch die Musik verändert. Ich fand es sehr reizvoll, die Chance zu nutzen und mal etwas ganz was anderes zuzulassen. Wir haben über all die Jahre mehr oder weniger innerhalb eines gewissen Baukastens operiert. Wenn man so genial wie die Beatles ist, schafft man es vielleicht, so einen Baukasten mit zwei, drei Tricks über fünf, sechs Alben zu Tode zu reiten. Aber spätesten dann muss sich konsequenterweise irgendwo ein Fenster öffnen.
Übrigens: An diesem Pop-Appeal, der unserer neuen Platte wesentlich stärker anhaftet als den vorherigen, bin ich nicht ganz unschuldig. Kurz bevor wir ins Studio gegangen sind, hing ich in einer sehr komischen und wilden Harry-Styles-Phase fest. Ich war regelrecht besessen von ihm und wollte sogar kurz mal er sein. Seine Musik hat irgendwie auf mich abgefärbt und ich habe ein bisschen was Unreines mit in die Probe gebracht. (lächelt)
MYP Magazine:
Nichts gegen Harry Styles! Immerhin hat er es geschafft, sich aus dem engen Korsett einer Boyband zu befreien.
Marco:
Im übertragenen Sinn haben wir das auch: Wir sind aus einer Boyband ausgebrochen und haben dann ein Album aufgenommen.

»In Deutschland hieß es immer, das sei der Wiener Schmäh. Dabei haben wir den gar nicht.«
MYP Magazine:
Boyband klingt sehr harmlos. Wenn man ein wenig zu Wanda recherchiert, stößt man immer wieder auf den Begriff Gang. Ist das eine Eigenbezeichnung? Oder wurde Euch das Wort unfreiwillig angedichtet?
Marco:
Der Begriff kommt unserem Lebensgefühl schon sehr nah, vor allem in den Anfangstagen der Band. Schon lange bevor wir berühmt wurden, waren wir immer sehr offen und haben gerne, wie soll ich sagen, den Gastgeber im Underground gespielt. Trotzdem waren wir fünf immer total hermetisch, allein durch den kryptischen und nach außen hin fast wirkungslosen Schmäh, den wir uns gemeinsam angeeignet haben. In Deutschland hieß es immer, das sei der Wiener Schmäh. Dabei haben wir den gar nicht, ganz im Gegenteil. Wir haben einen sehr spezifischen Cliquen-Schmäh, den auch in Wien keiner versteht.

»Das ist einfach so fucking German! Die Deutschen suchen immer irgendwo eine Message.«
MYP Magazine:
Da Ihr eben das Zehn-Euro-Abo auf Spotify angesprochen habt: Einer Eurer neuen Songs trägt den Titel „F*** Youtube“. Habt Ihr ein kritisches Verhältnis zu großen Streaming-Plattformen?
Marco: (lacht)
Überhaupt nicht! Das ist auch wieder so interessant… wie soll ich das jetzt sagen, ohne despektierlich zu sein?
MYP Magazine:
Bitte sei despektierlich!
Marco:
Okay, dann sage ich es: Das ist mal wieder so deutsch! Das ist einfach so fucking German! Die Deutschen suchen immer irgendwo eine Message. Aber der Songtitel ist keine Message, sondern einfach nur ein Teil einer Geschichte. In dem Lied geht es um jemanden, der einen bestimmten Song nicht hören kann, weil er ihn an eine schlimme Zeit erinnert. Und da dieser Song zufälligerweise auf Youtube läuft, fängt er an zu fluchen: Fuck Youtube! Ich dreh‘ das jetzt ab und spiele eine CD.
MYP Magazine:
Sorry.
Marco: (lächelt)
Es stimmt ja auch: Mit unserem Streaming-Konsum lassen wir alle uns einfach nie auf eine Sache ein. Wir haben verlernt, uns zu hyperfokussieren. Aber auch das ist keine Message, sondern einfach nur eine Tatsache. Und letztendlich ist der Song sogar eine Hommage an Youtube. Wir lieben diese Plattform, sonst würden wir dafür kaum so teure Clips produzieren. Was wir in den letzten zehn Jahren allein für die Produktion und Vermarktung von Musikvideos ausgegeben haben, kratzt mittlerweile an der Million. Das hätten wir nicht getan, wenn wir Youtube hassen würden.

»Wir machen reife Musik. Reife Musik von reifen Menschen.«
MYP Magazine:
Es gibt in Berlin einen Radiosender, der sich den Slogan „nur für Erwachsene“ gegeben hat. Da Ihr auf Eurem neuen Album etliche Themen behandelt, mit denen man sich eher mit Mitte 30 als mit 13 auseinandersetzt: Würdet Ihr sagen, dass Ihr heute schwerpunktmäßig eine Band nur für Erwachsene seid?
Ray:
Darüber haben wir erst vor Kurzem im Studio gesprochen. Wir haben festgestellt, dass wir über die letzten Jahre sehr erwachsen und reif geworden sind und mehr reife Musik machen. Der Slogan des Radiosenders würde daher auch ganz gut zu unser Band passen…
Marco:
… aber wir haben ja schon einen: „Wir machen reife Musik. Reife Musik von reifen Menschen.“ Den hat unser Produzent Zebo Adam bei der Albumaufnahme installiert.
»Für mich ist Therapie wie Staubsaugen. Ich räume ein bisschen auf und kann dann besser atmen.«
MYP Magazine:
Ein Zeichen menschlicher Reife ist es auch, offen über das Thema Therapie zu sprechen – dem habt Ihr sogar einen eigenen Song gewidmet. In dem eben erwähnten Spiegel-Artikel hast Du, Marco, die Psychotherapie als „die größte geisteswissenschaftliche Errungenschaft des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet. Wie nehmt Ihr die Debatte darüber in der österreichischen Gesellschaft wahr?
Manu:
Das ist eine Generationsfrage. Je jünger die Menschen sind, desto weniger Tabus und Stigmata sind mit dem Thema verknüpft. Gleichzeitig ist Therapie für viele immer noch etwas, das man machen muss, wenn man krank ist oder irgendwie kaputt. Für mich persönlich ist das eher wie Staubsaugen. Ich räume ein bisschen auf und kann dann besser atmen.
Marco:
Dabei erlebt das Thema Therapie in seinem Etablierungsmomentum aber auch eine grenzenlose Übersteigerung – was meiner Meinung nach verdammt wichtig ist. Wir alle wissen, dass etliche gesellschaftliche Themen und Strömungen gibt, die auch mal übersteigert auftreten müssen, damit sie am Ende bei zwei Prozent der Leute ankommen.
Dennoch ist Therapie natürlich nicht die Lösung, Therapie allein reicht nicht. Sie ist nur ein Tool von vielen, um als Mensch zu wachsen oder eine Krise zu bewältigen. Lustigerweise gibt es Gesellschaften, die so etwas wie Therapie gar nicht kennen. Auf den Seychellen zum Beispiel, wo wir unser Video zu „Jeder kann es sein“ gedreht haben. Ich habe mich dort mit sehr vielen Menschen unterhalten und es scheint tatsächlich so zu sein, dass es auf den Seychellen keinen einzigen Therapeuten gibt. Das ist eine Gesellschaft vollkommen ohne Therapie. Irgendwie faszinierend.
Ray:
Das habe ich auch gehört. Die Therapie der Menschen dort besteht einfach darin, am Strand zu sein, das Meeresrauschen zu hören und in die Ferne zu schauen. Und das scheint zu wirken. Die Leute, mit denen wir dort in Kontakt gekommen sind, wirkten wirklich sehr aufgeräumt.

»Vor der Band hatte ich keine Verantwortung – und damit habe ich sehr schlecht gelebt.«
MYP Magazine:
Auch Eure Musik hat für viele eine gewisse therapeutische Wirkung. Nach zwölf Jahren Wanda sind Eure Songs bei unzähligen Menschen mit ganz besonderen Momenten, Situationen und Erinnerungen verknüpft. Erwächst daraus eine gewisse Verantwortung?
Marco:
Seit es uns gibt, hören wir immer wieder sehr persönliche Sätze wie: „Hey, eure Musik hat mir wirklich geholfen in einer schweren, existenziellen Krise.“ Dementsprechend haben wir diese Verantwortung schon sehr früh gespürt – allerdings nicht auf der Bühne, wo alles immer sehr ekstatisch ist. Sondern eher hinter den Kulissen, wenn wir unseren Fans persönlich begegnen.
MYP Magazine:
Wie geht Ihr mit dieser Verantwortung um? Kann einen das nicht schnell mal überfordern, vor allem, wenn man selbst gerade in einer existenziellen Krise steckt?
Marco:
Ich bin für diese Verantwortung zu einem gewissen Grad dankbar, weil sie meinem Leben auch eine höhere Sinnhaftigkeit verleiht. Vor der Band hatte ich keine Verantwortung – und damit habe ich sehr schlecht gelebt. Mit einer Verantwortung zu leben, ist deutlich besser.

»Das neue Album allein macht uns nicht aus.«
MYP Magazine:
Zu Beginn unseres Gesprächs habt Ihr erklärt, dass Ihr „Ende nie“ als Debütalbum begreift. Wie blickt Ihr auf die vielen „alten“ Songs, mit denen Ihr bekannt und berühmt geworden seid? Entwickelt man nicht automatisch eine Distanz zu dem, was mal vor zehn, zwölf Jahren war?
Ray:
Das sind ja trotzdem immer noch wir! Klar, das neue Album ist eine große musikalische Weiterentwicklung. Aber das allein macht uns nicht aus. Sondern die Summe dessen, was wir in all der Zeit zusammen geschaffen haben.
Manu:
Ich freue mich auch jetzt schon auf den ersten Anschlag von „Bologna“, wenn wir wieder auf Tour gehen. Das spielt sich einfach nicht tot.
Mehr von und über Wanda:
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Maximilian König
instagram.com/studio.maximilian.koenig
maximilian-koenig.com
double-t-photographers.com (Repräsentanz)
Angus & Julia Stone
Interview — Angus & Julia Stone
»Das Leben verändert sich permanent, darin liegt eine gewisse Melancholie«
Mit ihrem sechsten Studioalbum »Cape Forestier« haben Angus & Julia Stone gerade eine Platte veröffentlicht, die alles andere ist als business as usual: ein wundervoll empathisches, anschmiegsames und tiefgreifendes Stück Musik, mit dem die beiden Geschwister auf ihre gemeinsame künstlerische Reise zurückblicken. Im Interview sprechen sie mit uns über seltene Momente des Innehaltens, einen alten tasmanischen Fischkutter als Inspirationsquelle und die Frage, warum Hochzeiten immer auch etwas Melancholisches haben.
12. Mai 2024 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

„Angus & Julia Stone, omg. 2010-2012 rauf und runter gehört, so viel Rotwein und Kippen auf der Fensterbank und Tränen, haha“, reagiert ein Leser vor ein paar Wochen auf unsere Instagram-Story, als wir ein Video von unserem Treffen mit dem berühmten australischen Geschwister-Duo posten. Und mit dieser Erinnerung ist er wahrscheinlich nicht alleine.
Seit fast zwei Jahrzehnten streicheln die heute 40-jährige Julia und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Angus mit ihren einfühlsamen Folk- und Indie-Pop-Songs die musikalische Seele der ganzen Welt. Aufgewachsen in Newport, einer beschaulichen Küstenstadt im Norden Sydneys, haben die beiden im Laufe ihres Lebens nicht nur unzählige Clubs, Hallen und Stadien auf der Nord- und Südhalbkugel bespielt, sondern auch Streaming-Zahlen im dreistelligen Millionenbereich erzielt.
Natürlich ist Quantität noch kein Beweis für Qualität. Doch solche Zahlen machen sichtbar, wie viele Menschen das Bedürfnis nach einer Musik zu haben scheinen, die sich um sie legt wie eine warme Decke, ohne dabei einen auf heile Welt zu machen. Ganz im Gegenteil: Unter jedem einzelnen Song von Angus & Julia Stone liegt immer auch eine gewisse Melancholie, mit der sie einem das Gefühl geben, emotional verstanden zu sein, ohne dass das irgendwo konkret artikulieren werden müsste.
Das ist bei den zwölf Stücken von „Cape Forestier“ nicht anders. Das sechste Studioalbum der Geschwister, das am 10. Mai erschienen ist, strahlt erneut jene musikalische Empathie und Vertrautheit aus, die wir von den beiden spätestens seit ihrer wunderbaren Platte „Angus & Julia Stone“ aus dem Jahr 2014 gewohnt sind.
Doch „Cape Forestier“ ist alles andere als business as usual. Das neue Album wirkt – etwa bei Stücken wie „Losing You“ oder „Wedding Song“ – spürbar nachdenklicher, tiefer und emotional verbindlicher als frühere Werke. Gleichzeitig strahlt „Cape Forestier“ eine unverrückbare Zuversicht und Gelassenheit aus, die sagt: Hier ist jemand ganz bei sich.
Stellvertretend hierfür ist der gleichnamige Song, zu dem die Geschwister Stone Anfang März ein ganz besonderes Video veröffentlicht haben. Mit einer Zusammenstellung aus etlichen privaten Filmaufnahmen blicken die beiden auf ihre gemeinsame musikalische Reise zurück – ein kurzes Verschnaufen und Innehalten, das große Lust macht auf das, was da in den nächsten zwei, drei oder vier Jahrzehnten noch so kommen mag.

»Wer so ein Leben führt, nimmt sich eher selten die Zeit, kurz Luft zu holen und zurückzublicken.«
MYP Magazine:
In dem Video zu Eurem neuen Song »Cape Forestier« blickt Ihr mit unzähligen kleinen Clips auf die vielen Jahre Eurer gemeinsamen Karriere zurück. Welche Gefühle hat es in Euch ausgelöst, als Ihr diese alten Aufnahmen gesichtet und zusammengestellt habt?
Angus:
Darüber haben Julia und ich erst gestern gesprochen. Für uns ist dieses Video – mit all seinen kleinen Erinnerungen – eine ganz persönliche Hommage an eine wirklich gute Zeit, die wir zusammen hatten und immer noch haben. Auch wenn es bis zu dem Punkt, an dem wir heute stehen, ein langer und oft auch schwieriger Weg war: Alles in allem war und ist es doch eine wirklich wundervolle Reise.
Julia: (nickt)
Solche Momente des Innehaltens sind für uns etwas ganz Besonderes, denn wir stehen eigentlich permanent unter Strom – nicht nur, weil wir sehr viel unterwegs sind und überall auf der Welt Shows spielen. Sondern auch, weil wir dabei gleichzeitig den Drang haben, immer neue Musik zu schaffen. Wer so ein Leben führt, nimmt sich eher selten die Zeit, kurz Luft zu holen, zurückzublicken und sich darüber auszutauschen, was man gemeinsam erreicht und erlebt hat. Dementsprechend hat uns die Arbeit an diesem Video auch erst mal emotional überwältigt, weil in der Unmenge an Footage, die wir gesichtet haben, so viele schöne Erinnerungen konserviert sind.
Wie Angus schon gesagt hat: Diese Reise war nicht immer leicht für uns, es gab viele herausfordernde Momente und Situationen. Aber ich bin echt stolz darauf, dass wir das alles bewältigt haben und als Geschwister, Musiker und Freunde daran gewachsen sind. Die Zeit hat uns beide stärker und resilienter gemacht – und ich finde, das wird in dem Video sehr deutlich.
MYP Magazine:
Haben diese alten Clips auch nostalgische oder sogar melancholische Gefühle in Euch ausgelöst?
Julia: (lacht)
Klar, total – ganz so wie unsere Musik.

»Manchmal schreibe ich einen Song und verstehe erst viele Jahre später, was ich damit emotional ausdrücken wollte.«
MYP Magazine:
Angus, in den ersten Sekunden des Videos hören wir Dich sagen: »Als wir angefangen haben, gemeinsam Musik zu machen, hatten wir keinen Plan oder eine Karte, die uns gezeigt hätte, in welche Richtung wir laufen müssen. Ich glaube, die Musik war schon immer das Einzige, mit der man es schafft, durch all das zu navigieren.« Und dann fügst Du hinzu, dass es etwas Magisches habe, wenn man durch die Musik erforsche, was man zu sagen habe. Was genau macht diesen Prozess für Dich so magisch?
Angus:
Für mich persönlich ist das Besondere am Songwriting, dass es meinem Unterbewusstsein erlaubt, Dinge zu erzählen oder Gefühle zu äußern, über die ich sonst nicht bewusst nachdenken würde. Manchmal schreibe ich einen Song und verstehe erst viele Jahre später, was ich damit emotional ausdrücken wollte. Ich finde, das gibt dem Musikmachen eine ganz besondere Schönheit – zumindest dann, wenn man dadurch in der Lage ist, Teile seiner eigenen Gefühlswelt freizulegen, die sonst verborgen blieben.

»Für uns hat es sich über all die Jahre immer wieder bestätigt, dass es das Richtige ist, unserem Instinkt zu folgen.«
MYP Magazine:
In Deutschland gibt es ein Sprichwort: keine Zukunft ohne Herkunft. Erinnert Ihr euch an bestimmte Momente in Eurer Vergangenheit, bei denen Ihr sofort wusstet, dass sie Euren gemeinsamen Weg entscheidend beeinflussen würden?
Julia:
Hmm… ich kann mich nicht erinnern, dass es in unserer Karriere solche Schlüsselmomente gab. Vielleicht habe ich sie auch einfach nicht erkannt. Natürlich erlebe auch ich in meinem Leben immer wieder Momente, die sich ganz besonders und außergewöhnlich anfühlen. Aber ich hatte bisher nie den Eindruck, dass eine bestimmte Situation zu einer völlig anderen Entwicklung geführt hätte; oder dass eine bestimmte Handlung die Saat für das Geschehen in einer weit entfernten Zukunft gelegt hätte.
Ich würde die Frage daher gerne anders beantworten: Für Angus und mich hat es sich über all die Jahre immer wieder bestätigt, dass es das Richtige ist, unserem Instinkt zu folgen und uns auf unser Bauchgefühl zu verlassen. Waren wir in jungen Jahren vielleicht noch etwas unsicherer in unseren Entscheidungen, wissen wir heute, dass wir unserer Intuition voll und ganz vertrauen können. Diese Intuition ist es, die uns an all die wunderbaren Orte geführt hat. Und jede einzelne unserer Entscheidungen, egal ob gut oder schlecht, hat uns am Ende an einen Punkt gebracht, an dem wir wie heute mit Euch über unsere Musik sprechen dürfen.

»Wir fanden, dass dieses abenteuerliche Dasein eine schöne Metapher für unser eigenes Leben ist.«
MYP Magazine:
Wie ich mit Hilfe von Google Maps herausgefunden habe, ist Cape Forestier ein kleines Kap im äußersten Osten von Tasmanien. Was ist das Geheimnis dieses Ortes?
Angus: (lächelt)
Das ist schwer zu erklären. Cape Forestier strahlt einfach eine ganz besondere Energie aus…
Julia:
… es ist aber auch der Name eines Bootes, genauer gesagt eines kleinen Fischkutters – ihm und seinem Kapitän haben wir unseren Song gewidmet. Seit vielen Jahren sind die beiden Tag für Tag auf den antarktischen Gewässern südöstlich von Tasmanien unterwegs, ganz egal, wie gut oder schlecht das Wetter ist und wie hoch sich die Wellen über ihnen auftürmen. Wir fanden, dass dieses abenteuerliche Dasein eine schöne Metapher für unser eigenes Leben ist: konstant auf der Reise zu sein, ohne jemals zu wissen, ob ein heftiger Sturm aufkommt oder man eher in ruhigen Gewässern segelt.
MYP Magazine:
Weiß der tasmanische Fischer, dass Ihr ihm einen Song gewidmet habt?
Julia:
Ja, er hat sich darüber sehr gefreut, auch weil der alte Fischkutter seit Jahrzehnten in Familienbesitz ist.

»Das, was man als Kind hört, beeinflusst, wie man sich als Erwachsener in der Welt bewegt.«
MYP Magazine:
Apropos Familie: Im Pressetext zum Song »Losing You« heißt es, dass Euch die Emotionalität des Liedes an die Musik erinnert, die in Eurer Kindheit immer im Auto Eurer Eltern lief. Glaubt Ihr, dass die musikalischen Begegnungen, die wir als Kinder machen, letztendlich auch unsere Persönlichkeiten im Erwachsenenalter definieren?
Angus:
Unser Vater war ein sehr gefragter Hochzeitssänger und hat uns Kinder oft zu seinen Auftritten mitgenommen. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, habe ich immer wieder das Bild vor Augen, wie wir an festlich gedeckten Tischen saßen und irgendwann einschliefen – umgeben von einer sanften Geräuschkulisse aus klirrenden Sektgläsern, netten Gesprächen und unzähligen Coversongs, die unser Vater auf der Bühne performte. Sein Repertoire reichte von den Beatles über die Beach Boys, Neil Young, Joni Mitchell bis zu Janis Choplin. All das hat sich wie eine wärmende Decke über uns schlafende Kinder gelegt – und ich glaube, dass das Gemisch aus unterschiedlichsten musikalischen Stilen und der künstlerischen Qualität dieser vielen Songs mit der Zeit ein Teil unserer eigenen DNA wurde. Wenn man klein ist, saugt man alles um sich herum auf wie ein Schwamm, vor allem Musik. Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was man als Kind hört, beeinflusst, wie man sich als Erwachsener in der Welt bewegt.
Julia: (lächelt)
Das heißt aber auch: Wenn unsere Eltern auf Heavy Metal gestanden hätten, wären wir beide heute wahrscheinlich Heavy-Metal-Künstler.
Aber im Ernst: Folkmusik ist einfach perfekt geeignet, um Geschichten zu erzählen. Dieses Genre hat uns in besonderer Weise geprägt. Unsere Eltern legten damals ständig Musik von Fleetwood Mac, Stevie Nicks oder Bob Dylan auf. Und auch wenn das natürlich mystische und unerreichbare Ikonen waren, hatte ich immer das Gefühl, dass diese Menschen fest zu unserer Familie gehörten – einfach, weil wir fast täglich zu Hause von ihren Stimmen umgeben waren. Daher hat es sich auch extrem verrückt angefühlt, als wir vor ein paar Jahren mit Fleetwood Mac auf Tour gegangen sind und die Band tatsächlich mal persönlich kennengelernt haben.


»Wenn man sich seinen Ängsten nicht stellt, wird man mit ihnen nie richtig umgehen können.«
MYP Magazine:
»Losing You«, so beschreibt Ihr es im Pressetext, handelt »vom Tanz zwischen Entdeckung und Verlust, vom Wesen der Liebesreise, von Momenten des Findens und Verlierens«. Ändern wir mal kurz die Perspektive: Welchen Vorteil könnte es haben, sich selbst von Zeit zu Zeit zu verlieren?
Angus:
Ich sage es in der Bildsprache von eben: Manchmal, wenn man allein auf hoher See ist, fühlt man sich einfach nur verloren. Und wenn dann noch ein Sturm aufzieht, Chaos ausbricht und man vielleicht sogar kentert, findet man sich plötzlich in einer Situation wieder, in der man nur noch versucht, den Kopf über Wasser zu halten. Aber diese Momente haben auch ihr Gutes – nicht nur, weil sie die eigene Widerstandsfähigkeit sichtbar machen. Sondern auch, weil sie viele unbearbeitete Probleme und Konflikte an die Oberfläche spülen. Daher ist es wichtig, dass man – sobald sich der Sturm gelegt hat und man wieder in ruhigen Gewässern segelt – in Ruhe reflektiert, was da zu Tage getreten ist und wie man damit in Zukunft umgehen will.
Julia:
Stimmt. Nur an solchen Situationen kann man persönlich wachsen. Wenn man sich seinen Ängsten nicht stellt, wird man mit ihnen nie richtig umgehen können. Das ist, wie wenn man als Treuzeugin auf der Hochzeit eine Rede hält. Zuerst fühlt man sich total verloren, weil man sich mit seinen Gedanken und Emotionen so vielen Leuten aussetzt. Man bekommt plötzlich weiche Knie und fängt an zu stottern. Aber wenn man die Rede erst einmal gehalten hat, fühlt man sich viel größer und glücklicher. Ich finde, man muss sich solchen Momenten viel öfter aussetzen, um zu verstehen: Am Ende wird alles gut.

»Die Liebe ist das Licht, das wir brauchen, um zu verstehen, dass alles nicht so schlimm, dunkel und beängstigend ist, wie es sich anfühlt.«
MYP Magazine:
Vielleicht braucht man in seinem Umfeld auch einfach mehr Menschen, die einem sagen, dass alles gut wird – und dass es okay ist, sich hin und wieder zu verlieren.
Julia:
Ja, und genau darum geht es in »Losing You«. Der Song sagt nichts anderes, als dass wir Menschen einander brauchen – egal, ob wir freundschaftlich, familiär oder romantisch miteinander verbunden sind. Diese Verbindung, oder mit anderen Worten Liebe, ist das Licht, das wir brauchen, um zu verstehen, dass alles nicht so schlimm, dunkel und beängstigend ist, wie es sich anfühlt. Es ist der eine Funken, der uns realisieren lässt, dass es auch noch eine andere Perspektive auf unsere scheinbar ausweglose Situation gibt; dass wir nicht in einem großen dunklen Wald sitzen, sondern nur in einem kleinen Raum, in dem das Deckenlicht nicht funktioniert und man nur mal die Glühbirne auswechseln muss. Aber das ohne eine menschliche Verbindung zu verstehen, ist oft sehr schwer.
»Jener magische Moment, in dem man sich entscheidet, eine Verbindung fürs Leben einzugehen, ist plötzlich vorbei.«
MYP Magazine:
Euer gesamtes Album ist von einer wunderbaren und herzerwärmenden Melancholie durchzogen, auch der »Wedding Song«. Sind Hochzeit und Melancholie nicht ein Widerspruch in sich?
Julia: (grinst)
Ich hoffe, ich darf das so sagen, auch wenn wir beide unverheiratet sind: Das Melancholische an einer Hochzeit ist doch die Tatsache, dass die Sekunde, in der man sich das Jawort gibt, im nächsten Augenblick schon Vergangenheit ist. Jener magische Moment, in dem man sich entscheidet, eine Verbindung fürs Leben einzugehen, ist plötzlich vorbei und die gemeinsame Liebe muss sich über die nächsten zehn, 20 oder 40 Jahre beweisen. Das Leben verändert sich permanent, darin liegt eine gewisse Melancholie – und davon handelt unser Song.

»Der Prozess, bestimmte Gefühle zu erkennen, mit ihnen umzugehen und sie dann gehen zu lassen, hat etwas sehr Befreiendes.«
MYP Magazine:
Der Dichter Rainer Maria Rilke hat mal gesagt: »Ein Kunstwerk ist gut, wenn es aus Notwendigkeit entstand.« Aus welcher Notwendigkeit heraus macht Ihr beide Musik?
Angus:
Das Wichtigste im Leben ist doch, seine Gefühle ausdrücken zu können. Für mich persönlich hat die Musik da eine absolut existenzielle Bedeutung, denn sie gibt mir die Möglichkeit, meine Emotionen in einem Song niederzuschreiben, ihn aufzunehmen und zu veröffentlichen. Dieser Prozess, bestimmte Gefühle zu erkennen, mit ihnen umzugehen und sie dann gehen zu lassen, hat etwas sehr Befreiendes – als würde man all seine Ängste auf ein Blatt Papier schreiben und dann ins Feuer werfen.
Julia:
Für mich hat das Musikmachen ebenfalls etwas Rituelles. Aber eher, weil es ein Bedürfnis stillt, das ich als menschliches Wesen verspüre: Musik bringt mich in Verbindung zu etwas Tieferem – zu etwas Wahrhaftigem. Es gibt auf dieser Welt so viel Schönes und Gutes, aus dem man schöpfen kann. Ich finde es großartig, das in Musik zu verpacken, auch weil man damit die unterschiedlichsten Menschen erreichen und in Verbindung zueinander bringen kann…
MYP Magazine:
… und Ihr erreicht mit Eurer Musik mittlerweile Millionen von Menschen.
Angus:
Das stimmt. Ich freue mich auch immer wieder, wenn uns die Leute spiegeln, wie sehr sie sich auf ihrer ganz persönlichen Reise in unserer Musik wiedergefunden haben. Aber ich bleibe dabei: In erster Linie schreibe ich die Songs nur für mich selbst – um mit meinen eigenen Gefühlen umzugehen.

Mehr von und über Angus & Julia Stone:
instagram.com/angusandjuliastone
angusandjuliastone.ffm.to/bio
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Maximilian König
instagram.com/studio.maximilian.koenig
maximilian-koenig.com
double-t-photographers.com (Repräsentanz)
Maeckes
Interview — Maeckes
»Wenn ich mich selbst preisgebe, öffnen sich andere auch«
Mit seinem »gitarren album« hat Maeckes gerade eine Platte veröffentlicht, die einem sehr schnell sehr eng ans Herz wachsen kann – wenn man sie nur lässt. In 20 liebevollen Tracks erzählt der Rapper, Sänger und Produzent viele kleine und große Geschichten, die uns nicht nur einen tiefen Blick in seine eigene Seele gestatten, sondern uns auch vor die Frage stellen, wie wir uns selbst auf dieser Welt verorten wollen. Ein Interview über das Worst-of des Lebens, ein ultrakapitalistisches Liebeslied und den besonderen Charme von Kleinbuchstaben.
29. April 2024 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Frederick Herrmann

Ach, diese Feststelltaste. Im Jahr 1875 von Christopher Sholes als Teil der modernen Tastatur erfunden, hatte sie auf mechanischen Schreibmaschinen noch einen echten Mehrwert. Denn wenn man per Umschalttaste von Klein- auf Großschreibung wechseln wollte, war das immer mit einem gewissen Kraftaufwand verbunden. Die Feststelltaste ließ die schwere Umschalttaste komfortabel einrasten – was für ein Service!
Knapp 150 Jahre später ist das fleißige Helferlein von einst ziemlich in Verruf geraten. Vor allem in den „sozialen“ Netzwerken gilt die Feststelltaste heute als verbales Megafon. Wer seiner Meinung besonderen Nachdruck verleihen will, schaltet kurzerhand auf „Caps Lock“ – und feuert los. Garniert wird dieses lautlose Gebrüll gerne mit etlichen Ausrufe- und Fragezeichen. Was für ein Augenschmaus!
Höchste Zeit also, die Feststelltaste in Rente zu schicken? Zumindest in den letzten Jahren wurde das immer wieder mal gefordert.
Doch während die Fachwelt noch diskutiert, hat Markus Winter alias Maeckes der Feststelltaste gerade ein Sabbatical bewilligt. Auf seinem neuen „gitarren album“, das am 26. April erschienen ist, kommt der 41-jährige Rapper, Sänger und Produzent völlig ohne Großbuchstaben aus – ganz anders übrigens als bei den Alben davor.
Typografisch sieht das „gitarren album“ irgendwie niedlich, leicht und ungefährlich aus. Und auch die Songtitel – „happy heart syndrom“, „der brand nach dem feuerwehrfest“ oder „die parties der eltern als man noch kind war und schon im bett lag“ – suggerieren auf den ersten Blick eher Easy Listening als Existenzialismus. Doch der Schein trügt.
Zwar ist dieses „gitarren album“ mit seinen 20 kleinen und großen Tracks auch wirklich easy anzuhören. Aber gleichzeitig lässt uns Maeckes mit dieser Platte derart tief in seine Seele blicken, dass man manchmal gar nicht weiß, wie man mit diesem Vertrauensvorschuss umgehen soll; und ob er gerade sich selbst meint oder uns, die voyeuristischen Zuhörenden. Etwa im Song „bucketlist“, in dem er etliche Herausforderungen auflistet, die einem das Leben so vor die Füße wirft, ob man nun will oder nicht. Oder in „orangerot“, ein Lied, das sich mit unserer persönlichen Verortung inmitten der Krisen dieser Welt auseinandersetzt, von Klimakatastrophe über Wohlstandsgefälle bis Demokratieermüdung.
Vor vier Jahren durften wir Maeckes schon mal zusammen mit seiner lebhaften Band „Die Orsons“ interviewen, jetzt haben wir ihn erneut zum Gespräch getroffen – ganz entspannt und in einer fast andächtigen Atmosphäre: an einem Freitagnachmittag im Studio des Fotografen und Videokünstlers Frederick Herrmann, der hier in den Stunden zuvor das Musikvideo zu Maeckes’ Song „nichts“ gedreht hat.

»Wenn man aus dem Rap kommt, stellt man viel schneller mal ein Mixtape zusammen, als ein komplettes Album zu konzipieren.«
MYP Magazine:
Maeckes, Dein Song „happy heart syndrom“ startet mit der Zeile „Mir geht es gerade gut“. Wir hoffen, diese Gefühlslage ist noch aktuell.
Maeckes:
Lasst mich kurz überlegen… Ja, doch, es geht mir immer noch gut. Danke der Nachfrage.
MYP Magazine:
Als wir Dich vor vier Jahren zum Interview mit den Orsons getroffen haben, hast Du Folgendes gesagt: „Beim Musikmachen gibt es manchmal Phasen, die so inspiriert sind, dass alles aus einem herausquillt. Dann wiederum erlebt man Phasen, die eher etwas ruhiger und nachdenklicher sind. In diesen Momenten braucht man immer den richtigen Vibe, um weiterzukommen – das ist wie klassisches Rätsellösen.“ In welcher dieser Phasen ist Dein „gitarren album“ entstanden?
Maeckes:
Die Herangehensweise an das neue Album war total frei und gelöst. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich es eher als ein Gitarren-Mixtape betrachtet habe. Wenn man wie ich aus dem Rap kommt, stellt man ja viel schneller mal ein Mixtape zusammen, als ein komplettes Album zu konzipieren und dafür die richtigen Songs zusammenzusuchen. Klar, am Ende ist auch mein „gitarren album“ ein echtes Album geworden, aber längere Kopfgeburten gab es dabei nie. Ich habe immer nur das gemacht, was mir gut von der Hand ging – und das spiegelt sich in den 20 Tracks auf der Platte wider.

»Von all den Liedern, die ich zehn Jahre lang auf der Bühne gespielt habe, ist letztendlich kein einziges auf dem Album gelandet.«
MYP Magazine:
Diese 20 Tracks sind eine Essenz der geheimnisvollen Gitarrenkonzerte, die Du in den letzten zehn Jahren gespielt hast und zu denen es keine Aufzeichnungen gibt. Hattest Du mit diesem Album auch das Ziel, für Dich und Deine Fans einige Erinnerungen aus dieser Zeit zu konservieren?
Maeckes:
Die 20 Tracks sollten eine Essenz aus dieser Zeit sein. Das Lustige ist aber, dass von all den Liedern, die ich zehn Jahre lang auf der Bühne gespielt habe, letztendlich kein einziges auf dem Album gelandet ist. Ganz am Anfang hatte ich noch die Intention, die besten Songs meiner Gitarrenkonzerte auf einer Platte zu verewigen. Aber dabei habe ich gemerkt, dass diese Songs eher für den jeweiligen Moment bestimmt waren, in dem ich sie gespielt habe, und dass sie heute dieser Magie nicht mehr gerecht werden – jedenfalls nicht, wenn ich versuche, sie nachträglich zu recorden. Dazu kommt, dass ich auch immer wieder neue Songideen hatte, die sich irgendwie frischer angefühlt und mehr und mehr durchgesetzt haben gegenüber den mittlerweile zehn Jahre alten Dingern.
»Du wurdest gerade vom Kapitalismus gefickt, hier auf meinem Konzert.«
MYP Magazine:
Aber ist „dein name“ nicht auch ein Song, den Du immer wieder vor Publikum gespielt hast?
Maeckes:
Ja, allerdings ist dieses Lied nicht mal ein Jahr alt. Ich hatte es für die Konzertreihe „Maeckes und das Experiment“ geschrieben, die Ende April 2023 startete.
MYP Magazine:
Bei diesen Shows hast Du die Leute immer wieder aktiv in die Entwicklung Deiner Songs eingebunden. Welche Erfahrungen hast Du dabei gemacht?
Maeckes:
Die wichtigste Erkenntnis war, dass der Kapitalismus auf meinen Konzerten seine hässlichste Fratze zeigt. Das hätte ich nie gedacht. Mein Ziel war immer, mir mit dem Publikum einen gemeinsamen Spaß zu machen und den Kapitalismus auf den Arm zu nehmen. So jedenfalls ist das Lied „dein name“ angelegt…
MYP Magazine:
… ein Song aus der Reihe „Kapitalistische Liebeslieder“. Die Idee dabei ist: Zahlt jemand aus dem Publikum einen gewissen Betrag, baust Du den Vornamen dieses Menschen in den Text ein – und suggerierst damit, dieses Lied sei ganz allein für ihn geschrieben.
Maeckes:
Genau. Aber was war passiert? Die Leute haben sich gegenseitig überboten! Kaum hatte zum Beispiel eine Svenja zehn Euro gezahlt, zahlte ein Peter zwanzig – und Svenja, die „nur“ einen Zehner gegeben hatte, hörte keine einzige Zeile von mir. Das tat mir wahnsinnig leid. Überhaupt habe ich immer wieder in enttäuschte Gesichter blicken müssen – mit dem Wissen: Du wurdest gerade vom Kapitalismus gefickt, hier auf meinem Konzert. Das war hart, vor allem, weil der Preis manchmal richtig in die Höhe schoss. Bei dieser ganzen Sache habe ich viel gelernt. Wir haben aber auch viel gelacht über den Kapitalismus. Und darum ging es ja auch in erster Linie.

»Einen differenzierten, rationalen Blick darauf, welche Kritik in dem Song verpackt sein könnte, hatten eher wenige.«
MYP Magazine:
„dein name“ funktioniert im Grunde wie ein Werbespot, der einem das Gefühl vermitteln soll, ganz persönlich angesprochen zu sein. Hat Dein Publikum nicht reflektiert, dass auch dieses Lied den versprochenen Individualismus nur vorgaukelt und persifliert?
Maeckes:
Nein, ich hatte eher den Eindruck, dass in den meisten das kapitalistische Feuer entfacht wurde, als sie gecheckt haben, dass sie sich für zwei, vier, zehn oder zwanzig Euro einen scheinbar personalisierten Song schießen können. Einen differenzierten, rationalen Blick darauf, welche Kritik in dem Song verpackt sein könnte, hatten eher wenige.
MYP Magazine:
Es gibt Künstler*innen, die betreiben das Verkaufen pseudo-individueller Songs oder Videos sogar hauptberuflich.
Maeckes:
Frank Zander!
MYP Magazine:
Stimmt, der hat bereits in den Neunzigern TV-Werbung für CDs mit personalisierten Geburtstagswünschen gemacht: „Hallo Ingeborg! Jetzt kommt der absolute Knaller, denn dieses Lied ist nur für dich.“
Maeckes:
Frank Zander ist auf jeden Fall der Original Gangster der Namenssongs.

»Es passiert in meinem Leben nur noch ganz selten, dass ich alkoholtechnisch so richtig der Sonne entgegen reite.«
MYP Magazine:
Als wir uns vor vier Jahren zum Interview mit den Orsons trafen, haben wir auch darüber gesprochen, was es Dir und den anderen bedeutet, gemeinsam Konzerte zu spielen. Was gibt es Dir, solo unterwegs zu sein?
Maeckes: (ohne zu zögern)
Ruhe!
MYP Magazine:
Dann passt die andächtige Stimmung hier in Fredericks Studio gerade ja ganz gut.
Maeckes:
Ja, absolut. Ich freue mich immer wieder, wenn ich der Action des Alltags entfliehen und in etwas total Ruhiges eintauchen kann – so wie heute. Mir reicht es aber auch schon, ganz gechillt in einer anderen Stadt zu sein und dort ein Konzert zu spielen. Und da ich vor allem in den größeren Städten viele Freunde habe, freue ich mich immer, die bei der Gelegenheit mal wieder zu sehen. Es gibt mir viel mehr, nach einem Konzert noch ein paar Stunden mit Leuten, die ich mag, zusammenzusitzen und ausgiebig zu quatschen, als mich wie früher einfach über den Haufen zu trinken. Seit Corona ist das bei mir ohnehin viel ruhiger geworden. Es passiert in meinem Leben nur noch ganz selten, dass ich alkoholtechnisch so richtig der Sonne entgegen reite.

»Ich kam an der Location an und hing mit irgendwelchen Leuten ab, die ich noch nie zuvor gesehen hatte.«
MYP Magazine:
Hast Du für Deine Solo-Auftritte auch ein eigenes Ritual entwickelt – wie damals bei den Orsons das gemeinsame Schnapstrinken vor dem Gang auf die Bühne?
Maeckes: (lächelt)
Manchmal trinke ich immer noch einen Schnaps vor dem Auftritt, aber dann halt mit den Veranstaltern. Es gab in den letzten Jahren etliche Konzerte, bei denen ich wirklich komplett allein war – ohne Tourmanagement, ohne Crew, ohne gar nichts. Ich kam an der Location an und hing mit irgendwelchen Leuten ab, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. In solchen Momenten ist es schwer, so etwas wie ein Ritual zu entwickeln und auch zu pflegen.

»Ich spüre ich in mir schon so etwas wie die Energie eines politischen Liedermachers.«
MYP Magazine:
Kommen wir zurück zu Deinem „gitarren album“. In unserer Gesellschaft gibt es zum einen das romantisierte Bild des „Jungen mit der Gitarre“, dem alle zu Füßen liegen. Und zum anderen gibt es das des ernsthaften, oft politischen Liedermachers in Gestalt etwa eines Reinhard Mey oder Wolf Biermann. Hast Du dich selbst jemals in einem dieser Bilder wiedergefunden?
Maeckes: (überlegt einen Moment)
Hmm… einerseits habe ich mich nie als einen Gitarristen oder Gitarrenmusiker gesehen. Das sind höchstens Kostüme, die ich mir versucht habe anzuziehen – die aber nie genau gepasst haben.
Andererseits spüre ich in mir schon so etwas wie die Energie eines politischen Liedermachers, die vor allem damals zum Vorschein kam, als ich noch Rap-Shows und keine Gitarrenkonzerte gespielt habe. Es gibt ja auch etliche Orsons-Songs und -Skizzen, die sehr politisch sind und eine wichtige Message haben. Da komme ich also schon irgendwie her… Aber dass ich einfach nur Musik machen möchte, bei der man mir zuschmachten kann, ist eine mindestens genauso große Wahrheit. (lacht)
MYP Magazine:
Dabei kann man Deine Songreihe „der brand nach dem feuerwehrfest“ durchaus als kleine Persiflage auf den musikalischen Stil alternder Gitarrenbarden verstehen.
Maeckes:
Ja, allerdings hat mein Anfang eher was von Rolf Zuckowski.
»Die Bühne war für mich nie ausschließlich für die Musik da.«
MYP Magazine:
Diese fünfteilige Serie wirkt auf dem „gitarren album“ wie eine Geschichte innerhalb der Geschichte. Wäre ein Job am Theater für Dich nicht auch eine Option gewesen?
Maeckes:
Theater war ja nie keine Option. Als ich vor vielen, vielen Jahren angefangen habe, Musik zu machen, war die Bühne für mich nie ausschließlich für die Musik da. Ich habe zwar nie klassisches Theater gespielt, aber bei meinen Auftritten gab es schon immer irgendwelche Mischformen und Performance-Krempel. Und auch mit meinem Orsons-Kollegen Bartek habe ich im Laufe der Jahre immer wieder Stücke geschrieben, die wir vor Publikum performt haben. Das heißt, in irgendeiner Weise komme ich schon aus dieser Welt – nur, dass ich dem Ganzen meine ganz eigene Form gegeben habe.

»So etwas wie eine Bucketlist zu haben, empfand ich schon immer als etwas merkwürdig Dummes.«
MYP Magazine:
Einer der persönlichsten Songs auf Deinem neuen Album ist „bucketlist“. Darin lässt Du uns tief in Dein Innerstes blicken. Wie geht es Dir damit, Dich emotional so nackt zu machen?
Maeckes:
Diesen Song habe ich zum ersten Mal bei „Maeckes und das Experiment“ gespielt. Dabei habe ich gemerkt: Wenn ich mich selbst preisgebe, öffnen sich andere auch. Klar, es ist vielleicht ein bisschen weird, diese Dinge mal so klar auszusprechen, auch weil normalerweise alles, was ich so schreibe, super chiffriert und in Metaphern verstrickt ist. Aber bisher hat es sich richtig angefühlt, das mit den Menschen zu teilen.
MYP Magazine:
Am Anfang des Song erzählst Du uns von den vermeintlichen Highlights Deines Lebens, die Du erfolgreich abgehakt hast. Dann aber gibt es eine Wende hin zu Deiner „Nicht-Bucket List“, in der Du „ganz viel Scheiße“ auflistest, die Du nie erleben wolltest. Wie ist dieses Lied entstanden?
Maeckes:
So etwas wie eine Bucketlist zu haben, empfand ich schon immer als etwas merkwürdig Dummes. Interessant wird das Ganze erst, wenn man mal versucht, die andere Seite der Medaille zu beleuchten: nicht das Best-of des Lebens, sondern das Worst-of. Heutzutage versuchen doch alle, die Idealseite ihres Daseins möglichst attraktiv in Szene zu setzen, vor allem auf Social Media. Das nervt so hart. Daher dachte ich, es passt vielleicht mal ganz gut, einen Song über dieses Thema zu schreiben, der aber einen U-Turn in sich hat. Denn diese Kehrseite gibt es nicht nur in meinem Leben, sondern auch in dem aller anderen Menschen.
»Es hat sich wahnsinnig gut angefühlt, mal die doppelten Böden sein zu lassen.«
MYP Magazine:
Wenn man selbst noch nie einen Baum gepflanzt, ein Auto gekauft, eine Aktie besessen und ein Haus gebaut hat, fühlt man sich mit diesem Lied sehr verstanden – ebenso, wenn man ein paar Jahre nicht mit seinem Vater gesprochen hat, in einer Wohnung ohne funktionierende Heizung lebt oder an einer Depression erkrankt ist. Es tut gut, wenn sich jemand in seiner Musik so nackt macht.
Maeckes:
Das geht mir bei Musik allgemein auch so. Gleichzeitig hat es sich auch wahnsinnig gut angefühlt, das selbst mal so klar auszusprechen und die doppelten Böden sein zu lassen. Und ganz ehrlich: Das war vor allem am Anfang noch eine ziemliche Challenge. Denn es geht ja nicht nur darum, mit dem Song einem anderen Menschen Mut zu machen, indem ich sage: Wenn du denkst, du bist der einzige Depp auf der Welt, schau dir Maeckes an, der ist auch so ein Depp. Ich habe dieses Lied auch einfach nur für mich geschrieben, um mich mal was zu trauen – um mich zu öffnen.

»Meine Stars sollen herumschweben und eine Silhouette sein, auf die ich alles projizieren kann, was ich will.«
MYP Magazine:
Darüber hinaus macht „bucketlist“ deutlich, dass ein Mensch, der im Rampenlicht steht, am Ende die gleichen Sorgen und Probleme hat wie jeder andere auch. Vielleicht hilft das ja all denen, die ihre Musik-, Schauspiel- und Instagram-Stars auf einen Sockel stellen und sich selbst dadurch kleinmachen.
Maeckes:
Ich glaube nicht, dass mein Song das durchbrechen kann – denn auch auf das, was ich da singe, kann man im Endeffekt wieder etwas projizieren. Vielleicht ist es für einen selbst sogar gesund, wenn so ein Künstler, den man gut findet, irgendwo herumschwebt und nicht mehr ist als eine Projektionsfläche. Man will doch nicht wirklich sehen, wie der in seinem Alltag Wäsche wäscht, oder? (lacht)
Ich jedenfalls will das nicht sehen. Meine Stars sollen herumschweben und eine Silhouette sein, auf die ich alles projizieren kann, was ich will. Auf diese Weise kann man mich auch gerne verwenden.
»Man selbst ist zwar nicht derjenige, der die Welt angezündet hat, aber man wärmt sich trotzdem gerne an ihr.«
MYP Magazine:
Ein weiterer Song, der sich im wahrsten Sinne ins Gedächtnis brennt, ist „orangerot“: erstens, weil der Titel Assoziationen an den Film „Blade Runner 2049“ weckt, der nicht nur in dieser Farbwelt gehalten ist, sondern auch in einer dystopischen Zukunft nach der Klimakatastrophe spielt. Und zweitens, weil der Titel die Bilder aus dem Jahr 2020 zurück ins Gedächtnis ruft, als der Himmel über San Francisco infolge der Waldbrände in ein tiefes Orangerot gefärbt war – ein Moment, in dem die Realität mit der Fiktion gleichgezogen ist. Waren solche dystopischen Bilder die Vorlage für Deinen Song?
Maeckes:
Thematisch würde das auf jeden Fall passen. Tatsächlich ist der Song aber schon ein bisschen älter und definitiv vor den Bildern aus San Francisco entstanden, vielleicht sogar schon vor „Blade Runner 2049“. Ursprünglich war der Song mal als Skizze für die Orsons gedacht, die in dem Zusammenhang aber nie weiterentwickelt wurde. Dennoch hat mich die Idee dahinter nie ganz losgelassen: Man selbst ist zwar nicht derjenige, der die Welt angezündet hat, aber man wärmt sich trotzdem gerne an ihr – und nutzt wie selbstverständlich das wütende Feuer als Lichtquelle. Dieses Bild konnte ich nie ganz über Bord werfen. Und da Feuer eh das Hauptthema des ganzen Albums ist, dachte ich, ich lasse es am Ende noch so richtig schön orangerot brennen.

»Das Leben ist eine einzige Verarsche. Aber das ist auch okay.«
MYP Magazine:
Mit Deinem Song „die parties der eltern als man noch kind war und schon im bett lag“ widmest Du dich einem ganz anderen Thema: dem Aufwachsen. Fühlst Du dich vom Leben betrogen, weil sich die romantische Idee, die Du als Kind vom Erwachsensein hattest, am Ende nicht bewahrheitet hat?
Maeckes:
Immer! Das Leben ist eine einzige Verarsche. Aber das ist auch okay, denn es zwingt einen dazu, immer wieder ein Update zu machen. Ich finde, das ist wirklich das Einzige, was man auf seiner Bucketlist haben sollte: ein regelmäßiges Update seiner Perspektive auf das Leben und die Welt.
MYP Magazine:
Das ist oft leichter gesagt als getan.
Maeckes:
Total! Und eines der schwierigsten Updates ist es, wenn man lernen muss, wie Beziehungen funktionieren. Als Kind hält man es für eine eisenharte Wahrheit, dass die Art und Weise, wie die Eltern ihre Beziehung führen, die einzig richtige ist. Aber wenn man dann irgendwann groß und erwachsen ist, muss man mit Erschrecken feststellen: Fuck! Die Eltern haben es genauso wenig gecheckt wie man selbst. Für mich persönlich war das eine der ersten großen Verarschen des Lebens. Wenn man sich in dem Moment kein Riesen-Update verordnet, bleibt man auf der Strecke. Und diese Situation wird es immer und immer wieder geben – „Till The Day I Die“, wie 2Pac gesagt hat.
»Der Stuhl knarzt und die Stimme ist nicht ideal, aber für mich war es der beste Moment.«
MYP Magazine:
Ihr habt heute hier im Studio das Video zu Deinem Song „nichts“ gedreht. Wie schwierig ist es, ein Lied über nichts zu schreiben?
Maeckes:
Überhaupt nicht schwierig! Dieser Song kam ganz locker-flockig zu mir. Ich war letztes Jahr eine Woche lang im Chiemgau, um dort im Studio eines Freundes – Grüße gehen raus an Lukas – super viele Gitarrenlieder aufgenommen habe. Und wenn ich mal nicht aufgenommen habe, hing ich einfach rum, hab‘ mir neue Sachen überlegt oder war draußen in der Natur. Die Idee zu „nichts“ entstand, als ich einen ganzen Tag lang einfach wandern war. Die Melodie des Songs hatte ich bereits im Kopf und als ich dann stundenlang in dieser schönen Landschaft herumgelaufen bin, hatte ich immer wieder mal eine Idee für eine Zeile, die ich dann in mein Handy getippt habe.
Gleich am nächsten Morgen habe ich das Lied dann aufgenommen – in einem einzigen Take. Man hört es ja auch ein bisschen: Der Stuhl knarzt und die Stimme ist nicht ideal, aber für mich war es der beste Moment. Ich saß am offenen Fenster, die Vögel zwitscherten und alles fühlte sich irgendwie richtig an.
»Wie die meisten Leute schaue auch ich mir auf YouTube lieber noch ein Video mehr an, bevor da nichts mehr ist.«
MYP Magazine:
Viele Menschen können gar nicht so gut damit umgehen, wenn um sie herum gerade nichts ist – kein Geräusch, kein Termin, keine anderen Menschen. Wie gehst Du selbst mit so einer Situation um?
Maeckes:
Ich liebe nichts! Ich liebe es, wenn das Papier noch weiß ist, bevor ich darauf schreibe – oder besser gesagt: bevor ich überhaupt eine Ahnung davon habe, was ich schreiben will. Für mich fühlt sich so etwas sehr befreiend an, weil es mir noch alle Möglichkeiten offen lässt. Gleichzeitig merke ich, dass ich immer schlechter darin werde, diese besonderen Momente zu genießen. Wie die meisten Leute schaue auch ich mir auf YouTube lieber noch ein Video mehr an, bevor da nichts mehr ist. Schade eigentlich.

»Jeder Mensch versucht, sich eine kleine Bühne einzurichten, auf der er mit der Welt klarkommt und sich selbst irgendwie akzeptieren kann.«
MYP Magazine:
Im Outro des Albums singst Du: „Ich bin nur sicher auf der Bühne / Ich bin nur sicher nach Applaus / Und bin ich nicht mehr Bühne / Dann gehen die Lichter plötzlich aus“. Fühlst Du dich in der Situation gerade jetzt, abseits der Bühne, sicher oder unsicher?
Maeckes:
Ich bin mitten in einem Interview. Das heißt, ich stehe gerade auf der Bühne.
MYP Magazine:
Hast Du eine Strategie, mit der es Dir gelingt, Dich im Alltag ohne den Applaus fremder Menschen sicherer zu fühlen?
Maeckes: (lächelt)
Der Song ist ein bisschen als Scherz gedacht. Ich will damit klarmachen, dass wir alle diese Bühne haben, nicht nur ich als Musiker. Wir alle haben bestimmte Komfortzonen, in denen wir uns sicher wähnen und wissen: Okay, wenn ich diese Hose anziehe, fühle ich mich halbwegs wohl. Oder aus diesem Blickwinkel finde ich mein Gesicht gar nicht so scheiße.
Jeder Mensch versucht, sich eine kleine Bühne einzurichten, auf der er mit der Welt klarkommt und sich selbst irgendwie akzeptieren kann. Und wenn man diese Bühne verlässt, kann es eben passieren, dass man von den einfachsten Dingen überfordert ist, sich in scheinbar harmlosen Situationen unwohl fühlt oder sich den Kopf zerbricht, weil man glaubt, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben.
»Vielleicht ist Applaus nicht das Wichtigste im Leben.«
MYP Magazine:
Du drohst am Ende des Lieds damit, Dich umzubringen, wenn Du keinen Applaus bekommst.
Maeckes: (das Lächeln geht in ein Grinsen über)
Damit sage ich mir selbst, dass ich vielleicht mal einen anderen Umgang damit finden sollte, wenn ich keinen Applaus bekomme. Vielleicht ist Applaus nicht das Wichtigste im Leben. Das habe ich aber noch nicht herausgefunden.
MYP Magazine:
Dabei ist es leider keine Seltenheit, dass Menschen im Showbusiness in ein tiefes Loch fallen, sobald der Vorhang fällt.
Maeckes:
True.

»Ich kann so ein Album nicht im luftleeren Raum schaffen und dann einfach ein goldenes Ei scheißen, das ohne Dialog funktioniert.«
MYP Magazine:
Durch deine Suizid-Drohung ganz am Ende des Albums entlässt Du uns nicht nur mit einem Cliffhanger, sondern auch mit einem ziemlichen Klos im Hals. Immerhin legst Du die Verantwortung für Deine emotionale Erlösung und Dein physisches Überleben in unsere Hände.
Maeckes:
Ich wette, Ihr habt zu Hause applaudiert.
MYP Magazine:
Ja, natürlich. Wir wollten Dich retten. Wie kommen wir als Dein Publikum aus dieser Verantwortung nur wieder heraus?
Maeckes:
Genau darum geht es ja. Ihr als Zuhörer wollt ein Album von mir – ein Album, das Euch ablenkt, in dem Ihr euch aber auch wiederfinden könnt und so weiter und so fort. Aber das funktioniert eben nicht ohne Euch. Das bedeutet, dass Ihr leider auch eine gewisse Verantwortung bei der Sache tragt, ob Ihr wollt oder nicht. Ich kann so ein Album nicht im luftleeren Raum schaffen und dann einfach ein goldenes Ei scheißen, das ohne Dialog funktioniert. Mir bleibt nichts anderes übrig, als Euch Zuhörer dazu zu bringen, Euch die Frage zu stellen, welche Rolle Ihr selbst bei all dem spielt. Habt ich die Platte nur nebenbei gehört und Euch wie in einer WhatsApp-Gruppe einfach durch den Verlauf gescrollt, ohne selbst etwas zu schreiben? Habt Ihr einfach einen auf stumm gemacht, wolltet aber trotzdem alles lesen?
MYP Magazine:
Jetzt fühlen wir uns ein bisschen ertappt.
Maeckes: (lacht)
Keine Sorge, es gibt ja eine Lösung. Versucht mal, wenn Ihr das Album noch mal hört, die Songs nicht auf mich, sondern auf jedes andere Leben zu beziehen und Euch zu fragen: Wie ist es, persönliche und intime Geschichten preiszugeben? Wie verändert sich das Gefühl, wenn man nicht mehr Kind, sondern erwachsen ist und man vielleicht selbst Kinder hat?
MYP Magazine:
Und wenn man „die Partys, und zwar als Eltern“ feiert.
Maeckes:
Genau. Ich glaube, dass mein Outro da einfach mal den Ball zurückspielt.
»Alle meine Alben bestanden immer nur aus Großbuchstaben, da musste sich mal ändern.«
MYP Magazine:
Eine letzte, aber profane Frage: Warum sind der Albumtitel sowie alle Songtitel kleingeschrieben?
Maeckes:
Weil es ein kleingeschriebenes Album ist. Weil das alles kleine Zeilen sind. Weil mein Gitarrenspiel sehr klein ist. Weil es einfach keine Großbuchstaben verlangt hat. Alle meine Alben bestanden immer nur aus Großbuchstaben, da musste sich mal ändern.
MYP Magazine:
Reicht ja, wenn die Gedanken groß sind.
Maeckes: (lächelt)
Ja, aber es sind auch viele kleine dabei.
Maeckes „Live 2024“ Tour:
02.11.24 – Rostock, M.A.U. Club
03.11.24 – Hamburg, Uebel & Gefährlich
04.11.24 – Hannover, MusikZentrum
05.11.24 – Bremen, Tower
07.11.24 – Dortmund, FZW Club
08.11.24 – Köln, Stollwerck
10.11.24 – Zürich, Papiersaal
11.11.24 – Stuttgart, Im Wizemann
12.11.24 – Frankfurt, Das Bett
13.11.24 – München, Hansa 39
15.11.24 – Nürnberg, Z-Bau
16.11.24 – Wien, Flex Café
18.11.24 – Leipzig, Moritzbastei
19.11.24 – Dresden, Ostpol
20.11.24 – Berlin, Columbia Theater
Mehr von und über Maeckes:
Interview & Text: Jonas Meyer
Fotografie: Frederick Herrmann
Creative Direction, Styling & Set Design: Sarah Schurian
Fred Roberts
Interview — Fred Roberts
»It takes a personal story to help someone else«
The British singer-songwriter Fred Roberts is an exceptional phenomenon for two reasons. Firstly, the 21-year-old creates music that simply sticks in the ear and sounds as though he has been doing nothing else for decades. And secondly, with his unflinching openness about his own emotional world, he serves as a role model for many queer kids around the world. We met him for a very personal interview about living in disguise, the power of Troye Sivan, and an artistic vision that is much more than writing self-help songs.
11. April 2024 — Interview & text: Jonas Meyer, Photography: Steven Lüdtke

What is a role model? The term, which today seems to be a natural part of our linguistic usage, was first coined by the sociologist Robert Merton back in the 1950s. Merton described role models as individuals who serve as examples for others to emulate, and he proposed that they play a crucial role in the socialization process, particularly in the formation of aspirations and goals among individuals.
One of these individuals is certainly Fred Roberts. The 21-year-old singer-songwriter from England has been a beacon of hope for many queer teenagers around the world, at least since he gave them a deep insight into his inner self with Disguise, only the third single he’s ever released and part of his debut EP Sound of My Youth. In his own words, he addressed this song to the boy who said he’d love him—if Fred were a girl.
However, this description is somewhat narrow for two reasons. Firstly, Fred’s role model appeal is not just limited to the younger generation. In general, he offers an emotional refuge to all those who have experienced the need to disguise themselves, hiding who they truly are and who they love. And secondly, even more importantly: at the age of 21, Fred Roberts can already be regarded as a serious artist who makes damn good music—music that wants to stay in your ears once you’ve heard it.
And so, we make the same mistake here, as many others do, which should be avoided at all costs when approaching an artist journalistically: we put the sexuality aspect first, not the music. And at the same time, it has never been more important to have queer individuals who use their art and outreach to provide more visibility for a group of people, many of whom are still socially stigmatised, persecuted and marginalised today.
A few weeks ago, our publisher Jonas Meyer met Fred Roberts in Berlin for a very personal conversation.

»This song is about one of the most vulnerable experiences I ever had.«
Jonas:
Disguise, the latest single you released, is a song “for the boy who said he’d love you if you were a girl.” You said on Instagram that you’d wanted to tell the story of this song for a long time. How do you feel, now that the story has finally become public?
Fred:
Even though the first two singles, Runaway and Say, also draw from personal experiences, Disguise was a big step further of being very specific: this song is about one of the most vulnerable experiences I ever had. The fact that this story is now out in the world feels exciting, because the reason why I make music is to let people who are going through the same shit know that they’re not the only ones who feel this way. In my opinion, it really takes a personal story to help someone else. It can make people feel less scared. Music is so transformative, you know? The flip side is: I feel that the story is not owned by me any more. That’s very weird, but that’s also what makes the song so special.

»Everyone in the world now knows what happened.«
Jonas:
Don’t you feel somehow exposed, telling the world this very intimate story?
Fred:
Kind of, yeah… especially with being so vulnerable in the lyrics. Everyone in the world now knows what happened. Even though the whole song is an artistic product, which means that I’ve slightly stepped away from who I am as a person, it’s still my name on it in the end; it still reveals my very own experiences and intimate feelings. But what would the alternative be? I guess it’s easier to not hide behind the fact that I’m the one who’s actually lived through it.
Jonas:
Luckily, this story only provides a very small insight into your personal life and uncovers 0.1 per cent of who you actually are…
Fred: (smiles)
But I’ll keep writing to fill in the gaps!

»The full picture of what I want to be as an artist is yet to be drawn.«
Jonas:
Do you sometimes get the impression that people who listen to your music think they know you 100 per cent? Especially now that they think they can follow you every step of the way on Instagram.
Fred:
Isn’t that what we all do when we like someone’s music? I think it’s nice that so many people are interested enough in getting to know me and my music, and it’s lovely to see that they’re connecting with the songs and everything… I mean, I’ve only released three singles, and my first EP is in the starting blocks!
But I’ve got so many other songs I’ve been writing for probably two years now, which means that I’ve got this backlog of different paths I’ve gone down. So, yeah, there is definitely a lot more to build, the full picture of what I want to be as an artist is yet to be drawn. Until then, this whole situation is like a new world for me.

»I’m basically saying: I wish I was somebody else that you could love—but I’m not, unfortunately.«
Jonas:
Some of your fans find that Disguise sounds like a song that could accompany the final scenes of a coming-of-age-film. What images did you yourself have in mind when you wrote the song?
Fred:
I’ve always been a storyteller, I really enjoy that. The way I got into songwriting was literally like this: I would have an experience, I would write about it, and then I’d sit in front of a piano and just play some chords, literally speaking the story. That has always been my process.
My favourite film is Call Me by Your Name—with its landscape, all its nostalgic elements and the dark nights—and I feel that the sound of Disguise evokes that same imagery. When I think of the end of the film, when Elio’s sitting by the fireplace after he got off the phone with Oliver who told him that he’s getting married—that’s definitely the world Disguise comes from. In the part where I sing, “Do I wish I was somebody else?”, I’m basically saying: I wish I was somebody else that you could love—but I’m not, unfortunately. I think that’s the emotion that relates to the one expressed in the film, the image of crying in front of the fireplace.
»I feel that the nature of a slower song allows me to tell more stories.«
Jonas:
After two up-tempo singles, Disguise shows a more thoughtful and dreamy side of you. Would you say that this aspect reflects your personality more? Or is it the other way around?
Fred:
Both sides reflect my personality, I’d say! I just love throw-yourself-around songs like those by my favourite band, The Killers. I’m totally into the anthemic nature of music. So that side of it is definitely one half of me. But then, there’s a song like Disguise, and I’ve got a few other guitar ballads coming up. That just gives me the opportunity to be more real with the lyrics. I feel that the nature of a slower song, with atmospheric, intertwined sounds, allows me to tell more stories.
But even though you’re getting more of me in Disguise than you’re probably going to get in Say or Runaway, these two other songs are also extremely important for me in building the world in which I want my music to exist.

»If I were to produce it myself, it wouldn’t sound anything like this.«
Jonas:
Your songs have a very high production quality and sound like you’ve been making music for decades. But you only released your debut single in April 2023. Would you say you are a perfectionist? Or is it the people you work with?
Fred: (smiles)
I’m a perfectionist, but I’m not the one who produces the music. I’m very lucky to have Andrew Wells by my side: he’s like my anchor in the projects, even though he lives overseas. I met Andrew during lockdown through other people and we connected, but the only music I had were some rough demos I’d done on a Zoom recorder. That didn’t put him off and he still wanted to work with me. He was so passionate about building a soundscape and finding the right vibe, it was just incredible. And this guy is still pure magic. Even when we write a song over the course of a day, he often finishes it at the end of the same day. As much of a perfectionist as I am, he surpasses me by far. And if I were to produce it myself, it wouldn’t sound anything like this.

»It’s hard keeping true to yourself when you want as many people as possible to listen to your music.«
Jonas:
How important is it to create a brand around your music nowadays? Is there a danger of losing your own edginess and personality in the process?
Fred:
I think I’d be stupid if I always tried to write songs with a goal in mind. But of course, I’m aware of why certain songs exist. Runaway, for example, was quite big on the radio in Germany. That’s pretty cool, but I didn’t write the song to be successful in a specific market and in a specific medium. I was just lucky that it appealed to people’s tastes. Something like that just happens, or it doesn’t. But whatever—it doesn’t influence the music I love to make.
It’s hard keeping true to yourself when you want as many people as possible to listen to your music. If you really want to be successful, at least in a commercial sense, you have to write songs that reach out. But the second you write a song with a specific purpose, like going viral or taking off as a massive radio hit, that’s when the magic disappears.
For me, writing a song is only for the sake of writing it. When I come to the studio, it’s important for me to bring a story I really care about. Then Andrew and I elaborate it together, just knowing that we’ve got certain influences and certain songs that we want it to sound like, and then it turns into whatever it turns into. That’s all.
»Something deep inside me also wanted me to make music, but I wondered: How do I actually do that?«
Jonas:
When in your life did you realize that making music is a vital outlet for your emotions?
Fred:
During lockdown. I mean, I was already on a TV show in the UK just before the first lockdown; that’s how I got a little bit of a platform and how I made a few connections in the industry. But I hadn’t written a song before. I had just sung for a little bit, including in a school choir. But nothing serious. After lockdown happened, I found myself playing Xbox for the first six months. I was still at school at the time and about to finish it up. Something deep inside me also wanted me to make music, but I wondered: how do I actually do that? My mum just said: “You got to write your own stuff, you know?”

»If no one in the world existed, I think I would still feel the need to document my emotions in a song.«
Jonas:
Your mother used to be a performer, your dad’s a graphic designer. What influence did the creative professions of your parents have on your own artistic development?
Fred:
My mum was the one that got me started and playing piano, she was one that pushed me to get into music in the first place, and she’d sit over me while I practised and so on. Without her, I probably wouldn’t be able to write a song.
Overall, having two parents that both understood the need for a creative outlet was really important. I think it might be more difficult if they’d work in finance, for example. Not that it’s a worse job, but I think if you’re a parent working in the creative field, you have a finer instinct for when your child develops a quiet voice in their head that asks them more and more often: do you want to be a singer? Honestly, this wasn’t a big dream I had from a young age. But there was this constant voice that got louder and louder, and my parents instinctively understood. Their message was: “When there’s something inside of you that you want to let out, just do it and see what happens.”
Jonas:
Isn’t that the essence of art?
Fred:
I guess it is! And in this context, it doesn’t matter whether anyone is listening to you. If no one in the world existed, I think I would still feel the need to document my emotions in a song, like other people do in a diary, for example—although I would be a bit upset by now if absolutely nobody listened. (smiles)
It still feels kind of weird. There’s nothing more special to me than making a song about a specific experience and then getting home after a session, just being in bed, putting my headphones on and being instantly taken back to what I was feeling in the moment it happened.

»The song triggered something deep inside of me.«
Jonas:
A few weeks ago, when the whole world seemed to be posting their Spotify Wrapped, including you, it turned out that you and I have something very important in common: Last year, we both spent endless hours listening to Ryan Beatty’s new album, Calico. What do you like about it?
Fred:
This whole record is just perfect! I’m surprised it’s not being promoted more. Maybe it’s because Ryan Beatty is no longer perceived as a traditional artist like he was a few years ago. He was something of a pop star, and he was releasing music that’s far different to what he’s creating now.
For me, Calico kind of soundtracked my entire summer last year. This record is just beautiful from beginning to end, its soundscape is phenomenal, and it’s been a long time since I skipped any songs on an album. I’m absolutely sure that this record will stay with me for a very long time… What’s your favourite song on it?
Jonas:
It’s Ribbons. I remember sitting on the bus to our office early in the morning and listening to it. Suddenly I started crying—but I couldn’t understand why it touched me so much.
Fred:
Oh, I definitely know what you mean. Ribbons is just brilliant. I had the same experience with Black Friday by Tom Odell. I guess that was my top song of the year 2023—the way it builds up just blew me away. When it came out, I was in Hamburg playing my third show ever. I’d been through a breakup a few months ago, and I remember lying in bed after going out on the Reeperbahn. It was 2 a.m. and I had the song on full blast, absolutely the same experience as yours. I didn’t know why I was feeling any of this, it triggered something deep inside of me.

»Watching Troye Sivan’s music videos, it was the first time I’d seen two boys or men be with each other.«
Jonas:
Even more than Ryan Beatty, another music artist—a certain Troye Sivan—has changed your life. Can you tell how?
Fred:
My first contact with his music was when I discovered him on YouTube, watching the videos of his Blue Neighbourhood Trilogy. It was the first musical discovery of my life that wasn’t through a friend or my parents or someone else recommending me any music. I was hooked from the very first second. I saw this amazing Australian boy who was making wonderful music, and I was like, who is this? From that moment, I literally absorbed his songs.
At that time, I was 14 or maybe 15 years old, going through a period of my life figuring out who I was. Watching Troye Sivan’s music videos, it was the first time I’d seen two boys or men be with each other…
Jonas:
… and that was something so new for you?
Fred:
Not that I wasn’t aware of this beforehand—I had already seen it in my personal life—but until then, it had never appeared in the media that I was actively consuming. Or, to put it differently, I had never immersed myself in the storyline of a gay couple.

»The confusion or loneliness that comes with being gay was something no one had ever talked to me about before.«
Jonas:
What effect did that have on you?
Fred:
That specific experience was very important for me to find my own identity as a gay man. Of course, I knew already what it meant to be gay, and I already knew that I liked boys, but that was it. Everything else that comes with that—the confusion or loneliness, for example—was something no one had ever talked to me about before. Troye Sivan was the first one who, through his music and videos, spoke openly about all the emotions and experiences I personally could relate to. He showed me that I wasn’t the only person in the world who had fallen unhappily in love with a boy. That was magical.
I guess knowing that there’s an artist out there that is being so open and vulnerable about certain issues kind of paved my own artistic way. Apart from that, he broke so many boundaries of what can be talked about today, especially with his new album and the visuals. I mean, obviously, being queer is more accepted in the world now than it was just a couple of years ago, but there’s still a long way to go.

»My sexuality isn’t my whole life. There are so many different parts of me that define who I am as an artist.«
Jonas:
Absolutely. I myself grew up as a gay kid in a small town, and I always thought my generation would have been the last one growing up without any queer role models or a public conversation about people who do not conform to the heteronormative ideal. Then, preparing for today’s interview, I learned that you when you realized that you were gay, you also didn’t know who to tell or how to articulate it because the conversation still didn’t seem to exist at that age. How do you perceive the situation for queer kids in our society today? What do you hear from people who get in touch with you?
Fred:
When I released the first two songs, before Disguise, it wasn’t obvious what I’m talking about. And to be honest, I also didn’t want to explain…
Jonas:
You don’t have to explain anything either.
Fred:
I know. My sexuality isn’t my whole life. There are so many different parts of me that define who I am as an artist. But then the moment came, with Disguise, when I thought that telling my story was kind of important. I started to talk about my life and to explain what the song was about, which also changed the perspective of my past songs, I think.
The people’s reactions were just overwhelming. I’ve received so many messages from people saying, “You’ve put into words how I’m feeling”, “You express something I didn’t know how to express”, or just “Thank you for sharing this story”. When that comes from someone older than me, it’s particularly touching. I’m in a place right now where it’s okay to be gay. Many older people weren’t allowed to experience that in their youth.

»I’m aware that just because I’m personally doing well, it doesn’t mean that all queer kids are in a good situation.«
Jonas:
Many teenagers today are still not allowed to do that.
Fred:
Right, especially those who live in smaller towns or villages and not in big, diverse cities. I’m aware that just because I’m personally doing well, it doesn’t mean that all queer kids are in a good situation. It’s often quite the opposite. Many of them are going through a lot of shit right now, especially when I think of trans kids in the UK these days. Listening to their stories is heartbreaking for me because they are still subject to a lot of stigma. But at the same time, knowing that I’m able to connect with them through my music is more than heartwarming. I never had a same-age role model when I was growing up, and it didn’t feel okay to be gay until I came across Troye Sivan. If there’s even one teenager I can do something similar for or give a voice to, that would be also magical and make me happy.
»In environments where someone might have something against gay people, I tend to hold back from shouting it out.«
Jonas:
Interestingly, there isn’t just one coming-out for queer people. Rather, it is an ongoing process with many coming-outs almost every day. For example, telling you in a question a few minutes ago that I grew up as a gay kid was a conscious decision to come out to you.
Fred:
I totally agree. I’ve been in a few writing sessions where I met some people I haven’t worked with before. This is just a very small thing to tell, but when they were suggesting lyrics including the word “her”, I had to say: “Oh, sorry guys, I can’t sing that, I’m gay.” But sometimes I don’t say it and just change the lyric, you know? This is also a conscious decision in favour of or against coming out—because when you’re in a room with other people, you can’t just leave. (laughs)
But seriously—it still doesn’t feel natural at all having to announce your sexual preference in front of other people. It’s such a weird thing. But at the same time, it’s very important, because it adds context and it allows other people to understand you better. But it remains a conscious decision. And in environments where someone might have something against gay people, I tend to hold back from shouting it out. In an ideal world, everyone would get along with everyone else and it would be okay for us all to love each other.

»In our society, talking about their emotions is still not a thing for men.«
Jonas:
Four years ago I had the chance to talk with your colleague Sam Fender about his song Dead Boys. He said: “We still think it’s bullshit for boys to cry. We still try to emasculate them by saying, ‚Don’t be a fag‘ or ‚Don’t be a little girl‘, and simultaneously we accuse others of being sexist. Isn’t that ridiculous? I spent an entire life around that kind of bullshit bravado that people haven’t got rid of.” Is that still the case, in your experience?
Fred:
Dead Boys is a very sad song because it deals with the high suicide rate among young men in the UK. However, when it comes to my personal experience with toxic masculinity, the saying “Men don’t cry” is one that I’m very familiar with. I went to an all-boys school and for a lot of the time that I was there, it was a progressive school. Nevertheless, through my teenage years, I masked certain elements: my behaviour, for example, or the way I dressed. I just wanted to fit in. And even though I was in this progressive place, I personally experienced that that language still exists and that boys aren’t used to talking about their emotions with each other. In our society, this is still not a thing for men, and it seems to have been buried in them for generations.

»Troye Sivan’s achievement is to push the boundaries of what is usually thought of as a male pop star.«
Jonas:
I’d like to come back to Troye Sivan and Ryan Beatty, because they both play artistically with the topic of toxic masculinity: Troye in his video for the song Rush, Ryan in his album artwork, which is designed around the photography by Peter de Potter. Would you say that an artistic approach is the only way to change something when it comes to that outdated idea of being a real man?
Fred:
I don’t think it’s the only way but it’s one of the possible ways. Troye Sivan, for example, is pushing the boundaries on what a male pop figure can wear. When I was growing up, the idea of a male pop star was pretty clear. And today, the image you have in your head when you picture Shawn Mendes or Justin Bieber is a cool guy wearing hoodie and trousers and singing songs…
Jonas:
… nothing against comfy hoodies!
Fred: (laughs)
No, no, of course not, I like wearing hoodies myself. By the way, that’s another stigma: that all gay kids like flamboyant clothes. But Troye Sivan’s achievement is to push the boundaries of what is usually thought of as a male pop star. He’s stepping outside of the male stereotype and the role ascribed to male musicians. The same goes for Ryan Beatty’s album artwork. I think what they do is really important because their message is: “Don’t be afraid!” When someone sees artists like them talking openly and being vulnerable, they might also find the courage to do so personally—maybe even if they’re a straight man.
»My artistic vision is much more than writing self-help songs.«
Jonas:
I found the following quote from you: “I write songs with the specific intent of helping someone who is going through the same experience.” Do you sometimes feel a certain responsibility that comes with such a promise?
Fred: (ponders for a moment)
I’m still very early on in making music and plan to do this for a long time, but according to the messages I get, it seems that I’ve already impacted some people’s lives. But I don’t know if I feel a special responsibility here, because that’s exactly why I make music: I want to help people. But that’s not the only reason: I also just want to play concerts and get people dancing. Sure, I’m still telling my personal stories with the songs, and when someone can connect with that, it’s brilliant. But if someone just likes the sound and the energy of my music, that’s just as good. My artistic vision is much more than writing self-help songs.

»When I put that in my headphones, it feels like everything’s good.«
Jonas:
From my point of view, there is almost nothing more intimate than entrusting another person with the music in which you find your own emotional refuge. Is there a song or a band that you only recommend to someone if you really like them?
Fred:
Black Friday by Tom Odell, which I have already mentioned, is perhaps a little too melancholy. That’s why I recommend another song that you certainly haven’t heard of in Germany. It’s called Dakota by Stereophonics, a song that has been massive in the UK. I played it in a really slow version at my first live show and it’s also the song I usually listen to before playing a show. It’s like a warm-up: I put on my headphones, go to a private room, and just jump around.
The message in it is actually really sad. It’s about not understanding what the hell happened with a relationship. But it resolves and the song ends with countless repetitions of the line, “Take a look at me now.” It’s just euphoric, in a sense. When I put that in my headphones, it feels like everything’s good—at least for the moment.
More from Fred Roberts here:
Photography by Steven Lüdtke:
Interview and text by Jonas Meyer:
Copy editor: Jem Nelson









