Der Assistent
Interview — Der Assistent
»Ich habe keine Ahnung, ob man jemals wirklich weiß, wer man ist«
Mit seinem Debütalbum »Der Assistent« stellt sich »Fotos«-Frontmann Tom Hessler nun auch als Solokünstler vor. Die Platte ist für den 39-Jährigen der bisher größte Akt von Selbstfürsorge. Denn erstens hat er mit seinem groovigen Dub-Sound genau die Musik erschaffen, die er selbst immer hören wollte. Und zweitens verarbeitet er damit eine Zeit, die zu den dunkelsten seines Lebens gehört. Ein Gespräch über die Bürde der Pubertät, eine Messerattacke auf sich selbst und die Sorge, aus finanzieller Not Stadionrock-taugliche Musik machen zu müssen.
28. April 2023 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Niklas Soestmeyer

„Die schönste Sprache der Welt ist ein Lächeln“, „Warte nicht auf große Wunder, sonst verpasst Du die kleinen“, „Vergiss nicht, glücklich zu sein“ – es ist scheinbar ein beliebter Trend geworden, die eigene Wohnung mit motivierenden Holz- oder Metallschildchen zu dekorieren, vor allem, wenn sie in Vintage-Optik und mit schwungvoller Handschrift gestaltet sind.
Was für die einen die spießbürgerliche Krone des Kitsch, ist für die anderen ein willkommener Stimmungsheber – und vielleicht sogar ein notwendiger. Denn vielen Menschen fällt es gar nicht so leicht, mit einem gewissen Grundoptimismus durchs Leben zu gehen und sich um die Gesundheit der eigenen Seele zu kümmern. Und so ist es – ganz egal, ob pro oder contra Motivationsschild – für uns alle nicht das Schlechteste, hin und wieder ein kleines bisschen Selbstfürsorge zu betreiben.
Das gilt auch für den 39-jährigen Musiker und Produzenten Tom Hessler. Seit fast zwei Jahrzehnten ist er Frontmann der Hamburger Indie-Band „Fotos“, gerade hat er unter dem Namen „Der Assistent“ sein erstes und gleichnamiges Soloalbum veröffentlicht. Und diese Platte, das darf man so sagen, ist in Toms Leben nicht weniger als der bisher größte Akt von Selfcare – musikalisch wie privat.
Denn erstens hat sich Tom mit seinem kuscheligen Dub-Sound, in dem er feine Jazzelemente mit unaufdringlichen Elektrobeats und entspannten Retromelodien mischt, den großen Traum erfüllt, genau die Musik zu machen, die er selbst am liebsten hören würde – insbesondere, wenn er zuhause auf dem Sofa liegt und die Gedanken kreisen lässt. Und zweitens, und das ist vielleicht der noch viel wichtigere Aspekt, verarbeitet „Der Assistent“ mit diesem Album eine Zeit, die zu den dunkelsten seines Lebens gehörte, wie er uns im Interview verraten wird.
Wer sich über die Jahre ein bisschen mit den „Fotos“ beschäftigt hat, für den dürfte es keine Neuigkeit sein, dass Tom Hessler ein richtig guter Musiker und Texteschreiber ist. Trotzdem lohnt auch für diese Menschen ein akustischer Blick in das Soloalbum, denn diese Platte – und damit wollen wir uns weder anbiedern noch in irgendeiner Form übertreiben – ist einfach verdammt gut. Oder besser gesagt: tut verdammt gut. Und das einerseits, weil sie uns Hörer:innen auf der Textebene von vorne bis hinten das Gefühl gibt, sie in der Tiefe ihres Herzens zu verstehen. Und andererseits, weil sie uns musikalisch in eine große Portion Zuckerwatte packt, ohne dabei jemals ins Kitschige oder Oberflächliche abzudriften.
In einem Akt großer kulinarischer Selbstfürsorge haben wir Tom Hessler vor kurzem in seiner Berliner Wohnung zum Interview bei Kaffee und Sahnetorte getroffen. Ein Schild mit Motivationsspruch haben wir dort übrigens nicht entdeckt.

»Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ein großes Interesse daran haben, noch mal jung zu sein.«
MYP Magazine:
Tom, vor einigen Monaten hast Du auf Instagram ein Kinderfoto von Dir gepostet, dazu folgenden Hinweis: „Der Assistent hat gut lachen: Nach einem mysteriösen Kuraufenthalt kehrt er auffällig erholt zurück ins digitale Rampenlicht. Seine vierte Singleauskopplung ist eine demütige Verneigung vor den Filmmusik-Meistern der siebziger und achtziger Jahre.“ Bist Du jemand, der gerne in der eigenen Vergangenheit schwelgt?
Tom Hessler: (lacht)
Dieses Foto ist mir begegnet, als ich letztes Jahr zu Besuch bei meiner Familie in Bayern war. Ich fand es lustig, das auf Insta zu posten, denn das Bild hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Cover meines neuen Albums. Daraus habe ich die Story gesponnen, dass ich einen verjüngenden Kuraufenthalt hinter mir habe.
Generell gehöre ich aber nicht zu den Leuten, die ein großes Interesse daran haben, noch mal jung zu sein. Meine Kindheit und Jugend waren alles andere als die Highlights meines Lebens. Ich war immer ein sehr introvertierter Junge und fand es irgendwie bedrückend, auf einem bayerischen Dorf aufzuwachsen. Und auch später auf dem Gymnasium habe ich nie zu den coolen, sportinteressierten Zeitgenossen gehört. Vielmehr war ich ein Sensibelchen mit Nerd-Interessen, dem es schwerfiel, sich da einzugliedern. Alles in allem war das eine unangenehme Lebenszeit. Wenn ich heute Kinderfotos von mir sehe, denke ich daher immer: Wie gut, dass das vorbei ist.

»Mein kleiner Finger war hin. Wenn man professionell Musik macht, ist das eine ziemlich harte Diagnose.«
MYP Magazine:
Dein Debütalbum „Der Assistent“ ist ebenfalls in einer schwierigen Zeit Deines Lebens entstanden. Dürfen wir fragen, was genau passiert ist?
Tom Hessler:
Klar! Ist doch schön, wenn man was zu erzählen hat und nicht nur den Pressetext runterrockt. Passiert ist Folgendes: Mitte 2020 habe ich mir selbst – in einem Anflug von Wahnsinn – mit einem Messer eine schwere Handverletzung zugefügt, nachdem sich meine Freundin nach elf Jahren von mir getrennt hatte. Was folgte, war nicht nur emotional eine katastrophale Zeit, sondern auch körperlich. Ich musste mich mehreren OPs unterziehen, hatte wahnsinnige Schmerzen und musste über Monate zur Ergotherapie. Doch weder die Operationen noch die Krankengymnastik haben am Ende etwas gebracht. Mein kleiner Finger war hin und damit die vollständige Funktionsfähigkeit meiner Hand nicht mehr herzustellen. Wenn man professionell Musik macht, ist das eine ziemlich harte Diagnose. Und on top kam in meinem Fall noch ein extremes Einsamkeitsgefühl dazu, mitten im Corona-Winter in Berlin. Das war wirklich keine gute Zeit. Das Einzige, was mir blieb, war die Idee, eine sehr traurige und reflektierende Platte über das alles zu schreiben – die aber erst mal niemand haben wollte…

»Das, was man in extremen Trauer- und Umbruchphasen fabriziert, ist selten etwas, mit dem man sich später noch identifizieren will.«
MYP Magazine:
Inwiefern?
Tom Hessler:
Ich hatte mein Debütalbum ursprünglich ganz anders angelegt, vor allem die Musik war viel poppiger. Doch dieses Konzept fiel bei etlichen Labels durch, ich kassierte nur Absagen. Das brachte mich zu der Erkenntnis, das Ganze noch mal grundsätzlich zu überdenken. Natürlich hätte ich das Album auch einfach so rausbringen können. Aber ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben wichtig sein könnte, eine Ehrenrunde zu drehen und erneut in mich zu gehen. Denn das, was man in extremen Trauer- und Umbruchphasen fabriziert, ist selten etwas, mit dem man sich später noch identifizieren will.
Zuallererst habe ich den Song „W“ überarbeitet und da eine Art Bruch reingebracht – ein Dementi, das durch die Luftigkeit in der Musik auf der einen Seite und die schweren Texte auf der anderen Seite entsteht. Damit hatte ich plötzlich eine Vision vor Augen, wie auch der Rest der Platte klingen könnte. Und so habe ich nicht nur alle neuen, sondern auch die bereits existierenden Songs durch den Dub-Wolf gejagt. Das war genau das, was der Platte gefehlt hatte…
MYP Magazine:
… und womit Du dich auch sehr stark vom „Fotos“-Sound löst.
Tom Hessler:
Na, Gott sei Dank! Ich dachte immer: Wenn ich mal eine Soloplatte mache, dann will ich gerne raus aus diesem „Fotos“-Ding – nicht nur, weil mir das musikalisch guttut. Wenn man Teil einer Band wie „Fotos“ ist, die gleich zu Beginn einem riesigen Hype ausgesetzt war, der sich aber nie kommerziell erfüllt hat, gilt man in der Musikbranche mehr oder weniger als verbrannt. Entweder, man ist Bono, der seine goldene Zeit hatte und dafür von der Masse geliebt wird. Oder man schafft es eben nicht und ist der, bei dem alle denken: „Oh Gott, das ist der Typ, der 2006 mal dieses „Giganten“ gesungen hat. Lass mich damit bloß in Ruhe!“
»Das Letzte, was ich machen will, ist eine kommerzielle, Stadionrock-taugliche Version von mir selbst zu erschaffen.«
MYP Magazine:
Hey, nichts gegen die erste „Fotos“-Platte!
Tom Hessler: (lacht)
Nein, natürlich nicht. Trotzdem wollte ich mich persönlich davon schon seit vielen Jahren emanzipieren. Aber mir war immer klar: Das Letzte, was ich machen will, ist eine kommerzielle, Stadionrock-taugliche Version von mir selbst zu erschaffen und mit Songs von etablierten Hitschreiber:innen noch mal Karriere zu machen – und das am besten noch unter meinem Klarnamen: „Tom Hessler macht jetzt erdigen Rock für alle.“ So etwas kann ich einfach nicht, auch wenn ich ein paar Mal darüber nachgedacht habe. Aber ich persönlich habe es am Ende immer bereut, wenn ich in meiner „Karriere“ solche Gedanken zugelassen habe. Stattdessen hat sich mir der Satz eines Freundes eingebrannt, der bereits vor vielen Jahren meinte: „Mach doch mal was, was du dir selbst anhören würdest.“

»Die Frage ist nicht, was mich am meisten inspiriert hat in dieser Zeit. Sondern, was mir am meisten Trost gespendet hat.«
MYP Magazine:
Was hörst Du dir selbst denn so an? Welche Musik hat Dich zu Deinem Soloalbum inspiriert?
Tom Hessler:
Tatsächlich gab es dieses eine Album, das ich 2020 ständig gehört habe, als ich in einer Art Notfall-Modus war und nicht wusste, wie ich mir helfen sollte – im dunklen Dezember ganz allein zuhause sitzend, mit dieser halb aufgeschnittenen Hand und all den Schmerzen. In dieser Zeit habe ich oft nichts anderes getan, als stundenlang die „The Keyboard King“-Platte von Jackie Mittoo zu lauschen, jenem legendären Keyboard-King des ebenso legendären Plattenlabels Studio One. Auf dem Album gibt es einen Song, der mich total mitnimmt: „You’ll never find“. Jackie Mittoo spielt da eine Hammondorgel als Fundament, darunter liegen ein paar weiche, leichte Dub-Grooves und ab und zu kommt eine zarte Stimme angeflogen und verschwindet wieder. Zu diesem Song habe ich immer wieder ganz allein in meiner Wohnung geschwoft. Und auf genau diese emotionalen Momente habe ich mich beim Schreiben meines eigenen Albums besonnen. Die Frage ist daher nicht, was mich am meisten inspiriert hat in dieser Zeit. Sondern, was mir am meisten Trost gespendet hat. Und das war definitiv dieses Lied.
»Für mich ist Musik immer der letzte Zufluchtsort.«
MYP Magazine:
Man unterschätzt doch allzu oft, welches Trostpotenzial Musik haben kann.
Tom Hessler:
Ich unterschätze das nicht. Für mich ist das der Grund, warum ich überhaupt Musik mache. Denn in meiner dunkelsten Zeit vor dieser dunkelsten Zeit, also während meiner Pubertät auf dem Dorf, da hat Musik das für mich zum ersten Mal geleistet und lässt mich seither nicht mehr los. Für mich ist Musik immer der letzte Zufluchtsort, in den ich mich fallen lassen kann, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Und das ist auch der Grund, warum ich mein Leben der Musik widme, denn damit kann ich anderen genau das zurückgeben, was ich selbst dadurch erfahren darf.

»Je mehr Zeit und Aufmerksamkeit den Menschen genommen wird, desto weniger aufnahmefähig sind sie für die guten Dinge.«
MYP Magazine:
Auch dieses Zurückgeben ist Dir bereits mit etlichen „Fotos“-Songs gelungen – wir hoffen, Du kannst das Kompliment annehmen.
Tom Hessler:
Vielen Dank! Aber egal, ob es um „Fotos“, „Der Assistent“ oder andere Künstler:innen geht: Für uns alle wird es nicht einfacher, unsere Musik in die Welt hinauszutragen, denn der Umgang mit Kunst oder künstlerischem Schaffen hat sich mit den Jahren grundlegend verändert. Heute buhlen im Wesentlichen große Tech-Konzerne um die Zeit und Aufmerksamkeit der Menschen, um damit schnell viel Geld zu verdienen. Und je mehr Zeit und Aufmerksamkeit den Menschen genommen wird, desto weniger aufnahmefähig sind sie für die guten Dinge: für gute Fotografie, gute Musik, gute Filme – oder kurz gesagt für alles, was ein bisschen langsamer erzählt ist und mehr Muse braucht. Großen Namen wie Bob Dylan oder den Rolling Stones fällt es da natürlich einfacher, die Leute bei sich zu halten. Aber Künstler:innen, die nicht diesen Bekanntheitsgrad haben und trotzdem gute, ernsthafte Musik machen, rennen da mehr oder weniger gegen die Wand.
MYP Magazine:
Apropos gute Musik: Was genau hat Dich musikalisch am Dub gereizt?
Tom Hessler:
Man muss wissen: Dub wurde in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren in Jamaika erfunden. Damals gab es Block-Partys, mit fetten Soundsystemen. Die eher poppigen, radiotauglichen Reggae-Produktionen jener Zeit waren für diese Partys allerdings eher unpassend. Dub-Legenden wie King Tubby und Lee „Scratch“ Perry haben daher einfach die existierenden Reggae-Bänder genommen und das alles deutlich dancier und trippier abgemischt. Diese simplen, aber effektiven psychedelischen Klangbearbeitungs-Ideen, die damals entwickelt wurden, sind bis heute fresh geblieben – und holen mich total ab.
»Das Letzte, was ich sein will, ist ein mittelalter, weißer, aus Bayern stammender Musiker, der jetzt irgendwie Dub-Reggae macht.«
MYP Magazine:
Deinem Kollegen Peter Fox wurde letztes Jahr kulturelle Aneignung vorgeworfen, nachdem er in seinem Song „Zukunft Pink“ Beats benutzt hatte, die aus dem afrikanischen Genre Amapiano stammen. Hattest Du Sorge, Dich mit Deinem neuen Album ebenfalls angreifbar zu machen?
Tom Hessler:
Auf jeden Fall. Ich habe mich mit dieser Thematik sehr intensiv auseinandergesetzt, denn das Letzte, was ich sein will, ist ein mittelalter, weißer, aus Bayern stammender Musiker, der jetzt irgendwie Dub-Reggae macht. Aus diesem Grund habe ich mich erstens sehr langsam und vorsichtig jenen Tools genähert, die in der Dub-Musik verwendet werden. Und zweitens war es mir immer wichtig, mit meinem eigenen Sound sowie der Art, wie ich mit Musik umgehe, ein entsprechendes Gegengewicht zu schaffen. Ganz am Ende erst habe ich mich tatsächlich getraut, diese Reggae-Offbeats auf den Keyboards einzubinden, weil ich lange dachte, das dürfe man auf keinen Fall. Doch als ich diese Technik bei „W“ angewendet habe, hat es plötzlich klick gemacht, und ich wusste: Fuck, genau das hat es gebraucht.
In meinem speziellen Fall denke ich daher, es ist okay. Der Dub in meinen Songs ist in erster Linie ein Groove-Element, das wie ein Zitat funktioniert. Das Dubbing ist – ohne die performativen Inhalte jamaikanischer Roots- und Rastafari-Culture – vor allem eine Produktionstechnik. Es geht hier um den Prozess, Einzelspuren bestehender Produktionen mit gewissen Studio-Tricks umzugestalten und dadurch neue Horizonte zu öffnen. Und das ist erst mal Creative Commons, wie es so schön heißt.

»Musik kann im besten Fall etwas bedeuten. Zumindest mehr als einfach nur massives Frequenz-Massaker aus KissFM.«
MYP Magazine:
Der Song „W“ wurde auf Spotify schon über 130.000 Mal gespielt, Du scheinst damit einen gewissen Nerv zu treffen. Wie geht es Dir damit?
Tom Hessler:
130.000 Plays sind nicht viel. 130 Millionen sind viel auf Spotify. 130.000 Mal gespielt entspricht in dem Fall etwa 200 Euro Einnahmen, denn Spotify vergütet all jene Plays noch schlechter, die im sogenannten „Discovery-Mode“ generiert werden – also Musik, die dir Spotify auf Basis deiner individuellen und algorithmisch erfassten Hörgewohnheiten automatisch kredenzt. Wenn meine Musik dagegen im Radio läuft, erhalte ich pro gespielten Song Geld von der GEMA, da meine Arbeit kommerziell genutzt wird. Würde ein Radiosender so funktionieren wie Spotify, würde er einen Teil meiner Einnahmen zurückverlangen – mit dem Argument, dass ich durch häufigere Plays ja ein breiteres Publikum erreichen würde. Gleichzeitig erhalte ich selbst aber nichts dafür, dass der Sender Geld mit Werbung oder aus Rundfunkbeiträgen verdient. Als Monopolist kann Spotify die Regeln selbst gestalten.
MYP Magazine:
Ok, davon kann man sich nichts kaufen.
Tom Hessler:
Doch, doch! Für 200 Euro kann man ein Drittel der Miete zahlen in einer nicht ganz so teuren Wohnung. Aber ich will darüber gar nicht nachdenken, das macht mir nur noch mehr Angst. Ich kenne die Situationen allzu gut, in denen man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Oder in denen man sich fragt, ob man beim Arbeitsamt nicht doch eine Umschulung beantragen sollte. Solche Gedanken tun weh, vor allem, wenn Musik das Heiligste ist, was man im Leben hat – und man versucht, diese Musik vor jeder Form von Kommerzialisierung zu beschützen. Denn genau darum geht’s ja: Musik kann im besten Fall etwas bedeuten. Zumindest mehr als einfach nur massives Frequenz-Massaker aus KissFM, während man im Uber sitzt.
»Für mich war es am schwierigsten, nicht selbstmitleidig zu sein.«
MYP Magazine:
Würde Deine Musik nichts bedeuten, wärst Du vor Kurzem kaum bei den geschätzten Kolleg:innen von „Radio 1“ zu Gast gewesen, wo Du ausführlich Dein neues Album vorstellen durftest. In der Anmoderation zum Interview sagte die Moderatorin über Deine Platte: „Ich habe eine Welt betreten, die aus Melancholie und Einsamkeit ein ganz, ganz eigenes Gefühl kreiert und einen Soundtrack macht. […] Das ist sehr, sehr besondere Musik.“ War genau das Deine Intention?
Tom Hessler:
Dass sie das so beschrieben hat, hat mich sehr berührt. Und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. Aber wie gut so etwas am Ende gelingt, kann man sich als Musiker nicht wirklich vornehmen. Interessanterweise passt die Beschreibung auch gut zu dem, was während des Arbeitsprozesses passiert ist: Denn für mich war es am schwierigsten, beim Schreiben nicht selbstmitleidig zu sein. Das war ich schon viel zu oft in meinen „Fotos“-Songs, wenn ich mal wieder versucht habe, meine narzisstischen Leiden zu vertonen. Diesmal ging es aber vielmehr darum, mir selbst zuzuhören und meine eigenen Gefühle wahrzunehmen, um daraus einen ganz persönlichen Sound zu kreieren.

»Der Text kann genauso gut bedeuten, dass man einfach nur zu wenig Sport macht. Oder zu viel säuft. Oder ständig mit jemanden ins Bett geht, der nicht gut für einen ist.«
MYP Magazine:
Im Song „W“ sprichst Du auf Textseite von Selbstverletzung und mangelnder Selbstfürsorge, musikalisch packst Du dieses schwere Thema dagegen in Zuckerwatte. Ist das für Dich eine besondere Form, um Deine Messerattacke auf Dich selbst zu verarbeiten?
Tom Hessler:
Nein. Als ich den Text geschrieben habe, wollte ich mich etwas ganz anderem nähern – nämlich meiner Wut. Ich habe super lange gebraucht, um überhaupt herauszufinden, dass ich wütend bin, weil ich das immer so arg in mich hineingefressen habe. Diese Wut hat ihren Ursprung in entscheidenden Phasen meiner Kindheit und Jugend, in denen ich das Gefühl hatte, nicht gesehen oder gehört zu werden. Dass sich diese Wut am Ende auch gegen mich selbst richtet, war eine logische Konsequenz, die eher zufällig zu den eher allgemein gehaltenen Lyrics passt. Der Text kann genauso gut bedeuten, dass man einfach nur zu wenig Sport macht. Oder zu viel säuft. Oder ständig mit jemanden ins Bett geht, der nicht gut für einen ist. Um all das geht es in dem Lied.
Trotzdem habe ich gemerkt: Wenn man dieses Thema so direkt adressiert, finden viele Leute das immer noch ganz schön cringe – das ist einfach etwas, das einem ganz schön nahegehen kann. Selbst bei mir persönlich konnte ich diesen Text überhaupt erst durchbekommen, als die Musik dieses Lässige und Chillige bekommen hat. (singt die Zeile „Ich war nicht gut zu mir“) Das ist so soulig und berührend leicht!
»Ich wollte einfach nicht verraten, worum es inhaltlich geht, bevor man nicht die Musik gehört hat.«
MYP Magazine:
Warum hast Du den Songtitel codiert, indem Du dem Weh das e und h gestohlen hast?
Tom Hessler:
Die Musik sollte ein Gegengewicht schaffen zu der Schwere des Textes. Und das Gleiche ist dem Titel passiert. Ich wollte nicht verraten, worum es inhaltlich geht, bevor man nicht die Musik gehört hat. Es ist ja auch wirklich lustig, man sieht den Buchstaben und denkt sich: Hä?! Und dann geht das Lied los, irgendeiner singt „W“ und man weiß überhaupt nicht, was hier passiert – bis die erste Zeile kommt, bei der es dann plötzlich um heftigen Stoff geht.
MYP Magazine:
In dem Video zum Song „W“ erweiterst Du den Weh-Begriff teils auf lustige, teils auf sarkastische, teils auf nachdenkliche Art und Weise: Wadenkrampf, Work-Life-Balance, Warteschlange, Wutbürger, Waffenlieferung.
Tom Hessler: (lacht)
Das war nicht meine Idee, sondern die des genialen Regisseurs Christopher Marquez, der mit dem Video eine zusätzliche Polarisierungsebene eingezogen hat. Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die den Song wirklich sehr berührend finden und eigentlich mit Ironie recht gut umgehen können, aber sich in dem Fall nicht sicher waren, ob das Video nicht viel zu distanziert ist zum eigentlichen Thema. Aber ich finde, der Clip hat genau die richtige Balance aus Schwere und Leichtigkeit.

»Wenn ich an damals zurückdenke, sehe ich braunes Eichen-Furnier und Flokati-Teppiche.«
MYP Magazine:
Dein Album erinnert mit seinem dahinplätschernden Sound ein wenig an die Gemütlichkeit und Spießigkeit der alten Bundesrepublik. Was hat Dich als Kind und Jugendlicher popkulturell geprägt? Mit welchen Filmen, Serien und mit welcher Musik bist Du aufgewachsen?
Tom Hessler:
Als ich klein war, gab es im Fernsehen nur drei Kanäle und nachmittags irgendwie zwei, drei Formate. Wenn ich an damals zurückdenke, sehe ich braunes Eichen-Furnier und Flokati-Teppiche. Und ich erinnere mich an Serien wie „Wickie und die starken Männer“ oder „Es war einmal das Leben“ – und natürlich ganz viel Easy-Listening-Library-Musik.
MYP Magazine:
Und James Last.
Tom Hessler:
Ja, den gab es auf jeden Fall auch. Ich finde, gerade deshalb funktionieren auch meine Dub-Reggae-Zitate so gut, weil ihnen diese verbrämten Library-Harmonien entgegengesetzt werden – wodurch klar ist, dass da keiner ernsthaft Reggae-Musik machen will. Die ganze Klangwelt ist super assoziativ und erinnert an einen trippy Traum, aus dem man plötzlich erwacht und sich denkt: What the fuck?!
MYP Magazine:
In den letzten Jahren haben unzählige TV- und Streaming-Formate die siebziger und achtziger Jahre wiederaufleben lassen. Gibt es zurzeit Filme oder Serien, bei denen Du dich in Deiner eigenen Nostalgie emotional abgeholt fühlst?
Tom Hessler:
Ja, aber keine neuen. Ich schaue gerade zum wiederholten Mal „Kir Royal“ und „Monaco Franze“. Diese Serien von Helmut Dietl beziehungsweise Patrick Süskind von Anfang, Mitte der Achtziger sind einfach richtig gut und irgendwie immer noch aktuell, denn dort werden Themen behandelt, die uns auch heute noch als Gesellschaft lähmen und belasten.
»Es wäre für mich ein großer Fortschritt, wenn ich gewisse Graustufen zulassen würde.«
MYP Magazine:
Du hast Dich in den letzten Jahren in Deinen Texten – auch bei Fotos – immer wieder mit existenziellen Fragen auseinandergesetzt. Zum Beispiel in der Bridge von „Melodie des Todes“:
Wer weiß schon, dass er glücklich ist?
Ob Liebe stärker als das Sterben ist?
Vergangenheit nicht mal vergangen ist?
Ich weiß, dass du mich nie vergisst
Auch auf Deinem Soloalbum stellst Du solche Fragen, etwa im Song „Mann ohne Vergangenheit“, in dem Du fragst: „Wer bin ich?“ Hast Du darauf im Laufe der Jahre eine Antwort gefunden, vielleicht sogar mit dieser Platte?
Tom Hessler:
Ich habe keine Ahnung, ob man jemals wirklich weiß, wer man ist. Mir würde es schon reichen, wenn ich nicht jedes Mal, wenn ich eine neue Platte herausgebracht habe, wieder alles komplett in Frage stellen würde. Und es wäre für mich auch ein großer Fortschritt, wenn ich gewisse Graustufen zulassen würde, im Sinne von: Ja, okay, das war sicherlich nicht großartig. Aber vielleicht war es auch nicht scheiße und in Ansätzen gut. Ich habe in solchen Situationen viel zu oft die Kettensäge oder das Beil angelegt. Allein der Satz „Es hat nicht funktioniert“, was heißt das denn überhaupt? Dass ich gescheitert bin, weil ich keinen Grammy bekommen habe? Ich habe so oft in meinem Leben die Dinge einfach über den Haufen geworfen und alles damit noch schlimmer gemacht. Dementsprechend ist die Tatsache, dass ich mit meinem Soloalbum eine freiwillige Ehrenrunde gedreht habe, ein riesiger Schritt für mich – mal ganz davon abgesehen, dass ich überglücklich bin mit dem Endergebnis. Diese Erfahrung kann ich definitiv mitnehmen für das nächste Mal, wenn ich mir mit etwas nicht sicher bin oder das Gefühl habe, Ablehnung zu erfahren. Oder wenn ich mir Fragen stelle wie: Will ich das? Wer bin ich eigentlich?
Ich glaube, mittlerweile habe ich gelernt, in diesen Momenten einfach zu sagen: Lass dir doch noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Luft. Wenn du es jetzt noch nicht weißt, weißt du es sicher irgendwann anders. Es muss nicht jetzt entschieden werden.

»Ich habe mich fast mein gesamtes Leben lang an der Frage aufgehängt, was die Leute sagen.«
MYP Magazine:
In „Das süße Leben“, dem letzten Track des Albums, schaust Du sehr weit nach vorne, genauer gesagt auf Deinen Lebensabend…
Tom Hessler:
Nein, zum vermeintlichen Ende des Assistenten. Das ist eine Filmszene! Man sieht da richtig, wie die Kamera rauszoomt und der Assistent im Treibsand versinkt. Und man denkt sich: Ist das jetzt wirklich das Ende des Assistenten? Oder kommt er nochmal wieder?
MYP Magazine:
Du singst:
Am Ende bin ich körperlos,
ich weiß, dass mir die Stunde schlägt,
doch es hat sich gelohnt
Dazu hören wir ein sanftes Meeresrauschen, zu dem man auch verdammt gut einschlafen könnte, wenn man nachts mal wieder wachliegt. Ist dieses Album am Ende für Dich der bisher größte Akt von Selbstfürsorge in Deinem bisherigen Leben?
Tom Hessler: (lächelt)
Ja, das kann man tatsächlich so sagen, wenn man mal von dem enormen finanziellen Risiko absieht, das ich mit der Realisation dieser Platte eingegangen bin. Aber dass ich überhaupt den Mut habe, mir das zu gönnen und dabei einfach zu sagen: Es sind doch eh verrückte Zeiten, wer weiß schon, wie lange man so etwas noch machen kann, also warum nicht noch mal sich gönnen? Das für mich selbst zu formulieren und alles andere hintanzustellen, war mir einfach wichtig. Ich habe mich fast mein gesamtes Leben lang an der Frage aufgehängt, was die Leute sagen. Oder warum ich nicht die Aufmerksamkeit bekomme, die anderen Künstler:innen zuteilwird. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, ich mache das wirklich für mich.
»Dieser Assistent ist jetzt dein Begleiter, er macht es möglich, dass du frei agieren kannst.«
MYP Magazine:
Bleibt zum Schluss die Frage, was eigentlich hinter dem Namen „Der Assistent“ steckt.
Tom Hessler:
Aus Therapieprozessen kennt man es vielleicht, dass man manchmal unbewusst einen guten Gedanken hat und den beiläufig im Gespräch formuliert. Wenn die Therapeutin oder der Therapeut dann direkt nachhakt und fragt, woher das gerade kam, ist es oft so, dass man absolut blank ist und keine Ahnung hat. Mit dem Namen „Der Assistent“ war das ähnlich. Ich glaube, da wollte mir mein Unterbewusstsein etwas sagen. Und zwar: Du brauchst hier gerade einen eigenen Assistenten, der das Problem wirklich löst und dir hilft, einen neuen Kanal zu öffnen. Einen Assistenten, der dich dabei unterstützt, diese Musik zu machen, auf die du einfach gerade Lust hast. Egal, wo du herkommst. Egal, welche Musik du vorher gemacht hast. Und egal, was die Leute sagen und denken. Dieser Assistent ist jetzt dein Begleiter, er macht es möglich, dass du frei agieren kannst. Ich finde, das ist ein wunderbarer Gedanke.
Mehr von und über Der Assistent:
Interview und Text: Jonas Meyer
Fotografie: Niklas Soestmeyer
Simon Morzé
Interview — Simon Morzé
»Dieser Film schafft es, dass man intensiv über seine eigene Familie nachdenkt«
Das Drama »Der Fuchs« erzählt die wahre Geschichte von Franz Streitberger, Jahrgang 1917, der als Kind an einen reichen Bauern verkauft wurde und sich als Soldat im Zweiten Weltkrieg rührend um einen verletzten Fuchswelpen kümmert. In der Hauptrolle des bewegenden Films ist der 27-jährige Simon Morzé zu sehen. Mit seinem einfühlsamen, nahbaren und mitreißenden Spiel hat er in Österreich bereits 120.000 Menschen ins Kino gelockt, nun ist der Film auch in Deutschland gestartet. Ein Interview über Füchse am Set, die Kraft von Vergebung und unzählige Kinderschicksale, die heute weitestgehend in Vergessenheit geraten sind.
15. April 2023 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Steven Lüdtke

Kindersklaven mitten in Europa? Gibt’s nicht! Doch, gibt es – beziehungsweise gab es, etwa im Alpenraum und keine hundert Jahre her. War eine Familie in wirtschaftliche Not geraten, kam es immer wieder vor, dass sie eines oder mehrere ihrer Kinder weggeben musste, wenn sie diese nicht mehr ernähren konnte.
Die sogenannten Annehmkinder – auch Ziehkinder genannt – landeten meist bei reichen Bauern in der Umgebung. Diese konnten ihnen zwar eine warme Mahlzeit und ein Dach über dem Kopf bieten, aber sie ließen die Minderjährigen auch oft unter härtesten Bedingungen schuften. Dabei erlitten die Kinder nicht nur massiven körperlichen Missbrauch, sondern auch schwerste psychische Traumata.
Eines dieser Annehmkinder war Franz Streitberger, Jahrgang 1917, aus dem österreichischen Pinzgau, einer landwirtschaftlich geprägten Region im heutigen Bundesland Salzburg. Franz war das jüngste Kind einer 13-köpfigen, bitterarmen Bergbauernfamilie, die – zusätzlich zu ihrer ohnehin schon prekären Lage – mit der wirtschaftlichen Not in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zu kämpfen hatte. Wie in vielen anderen Regionen Österreichs herrschten damals auch im Pinzgau Arbeitslosigkeit, Elend und Hunger – und die Streitberges wussten nicht mehr, wie sie ihre zehn Kinder durchbringen sollten. So wurde der kleine Franz im Alter von nur sieben Jahren weggegeben, seine Familie sah er nie wieder.
Die wahre Geschichte von Franz Streitberger hat sein Urenkel, Regisseur Adrian Goiginger, nun verfilmt. Im Drama „Der Fuchs“, das Mitte Januar in den österreichischen Kinos gestartet ist und seit dem 13. April auch in Deutschland läuft, zeichnet er das Leben seines Urgroßvaters nach:
Mitte der 1930er Jahre meldet sich Franz freiwillig beim Österreichischen Bundesheer und dient dort als Motorradkurier. Nach dem „Anschluss“ an das Deutsche Reich wird er in die Wehrmacht eingegliedert und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs an der Westfront stationiert. Dort findet der introvertierte junge Soldat einen verwundeten Fuchswelpen, den er wie sein eigenes Kind versorgt und mit in das besetzte Frankreich nimmt. Durch diese sonderbare Freundschaft mit dem Tier holt ihn seine eigene Vergangenheit als verstoßener Bergbauernsohn langsam ein, vor der er fast sein ganzes Leben lang davongelaufen ist.
Verkörpert wird der fiktionale Franz Streitberger von Simon Morzé. Der vielfach ausgezeichnete Wiener Schauspieler hat sich monatelang auf die Rolle vorbereitet und beschreibt mit seiner einfühlsamen, nahbaren und mitreißenden Darstellung den vorläufigen Höhepunkt seiner noch jungen schauspielerischen Karriere. Wer den Film gesehen hat, weiß, dass das keine Übertreibung ist. Und gesehen haben ihn viele: 120.000 Menschen in den ersten zwölf Wochen, für die Kinolandschaft in Österreich eine beachtliche Zahl.
Doch nicht nur das. Der Film habe auch endlich eine Debatte über ein Thema in Gang gesetzt, das in der österreichischen Gesellschaft bisher kaum diskutiert worden sei: die tragische Geschichte der Annehmkinder, die zu Tausenden von ihren Familien getrennt wurden – oder vielleicht zu Zehntausenden, genaue Zahlen gebe es nicht. So jedenfalls berichtet es Historiker Rudolf Leo, der die Dreharbeiten wissenschaftlich begleitet hat. Er sagt, „Der Fuchs“ sorge aktuell in Österreich dafür, dass viele Menschen angefangen hätten, Ahnenforschung zu betreiben. Sie wollten herausfinden, ob es auch in ihrer Familie ein solches Schicksal gegeben habe. Eine Suche, die nicht selten zur Neubetrachtung der eigenen Identität führe.
Auch für Hauptdarsteller Simon Morzé hat der Film eine neue Perspektive auf die eigene Familiengeschichte eröffnet, wie er uns im folgenden Gespräch erzählen wird. Mitte Februar haben wir den 27-Jährigen in Berlin zum Interview und Fotoshooting getroffen.

»Für mich war es goldwert, den realen Franz auf diesem Wege kennenzulernen.«
MYP Magazine:
Simon, Du bist für den Film „Der Fuchs“ in die Rolle des Urgroßvaters von Regisseur Adrian Goiginger geschlüpft. Was weißt Du über das Leben des realen Franz Streitberger?
Simon Morzé:
Franz wurde am 2. April 1917 geboren und musste schon von klein auf – wie seine zehn Geschwister – auf dem Hof der Eltern mitarbeiten. Das war für die damalige Zeit zwar nichts Ungewöhnliches, aber für so einen kleinen Jungen dennoch ein überaus karges und brutales Umfeld, in dem er aufgewachsen ist. Da die Familie Franz kaum ernähren konnte, entschied sich sein Vater dazu, ihn im Alter von sieben Jahren an einen reichen Bauern abzugeben – er hat ihn regelrecht verkauft. Bei diesem Bauern hat er den Rest seiner Kindheit und Jugend verbringen und als Knecht arbeiten müssen. Auch das war damals kein seltenes Schicksal.
Mitte der 1930er Jahre meldete sich Franz freiwillig zur Armee und kämpfte dann als Soldat im Zweiten Weltkrieg. 1940, als er an der Grenze zu Belgien stationiert war, fand er im Wald einen verletzten Fuchswelpen, den er an sich genommen hat – und von dem er sich wieder trennen musste, als er ein Jahr später an die Ostfront versetzt wurde.
MYP Magazine:
Wie hast Du dich auf diese Rolle vorbereitet?
Simon Morzé:
Da Franz Streitberger tatsächlich existiert hat, gab es sehr viel Material über ihn – unzählige Fotos, aber auch O-Töne, denn Adrian hat schon als 14-Jähriger damit begonnen, mit seinem Urgroßvater über dessen Kindheit, Jugend und die Zeit im Krieg zu sprechen. Diese Gespräche hat er von Anfang an mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Für mich war es goldwert, den realen Franz auf diesem Wege kennenzulernen. Darüber hinaus habe ich viele Tagebücher aus der damaligen Zeit gelesen und mir diverse Dokumentationen angeschaut, um mich auch dem spezifischen historischen Kontext zu nähern.

»Ich finde, diese authentische Sprache ist für die Rolle essenziell.«
MYP Magazine:
Der Urgroßvater, der 2017 verstorben ist, hat einen sehr starken österreichischen Dialekt gesprochen…
Simon Morzé: (lacht)
Das ist Pinzgauerisch, ein alter, vor allem in der Region um Salzburg gesprochener Dialekt.
MYP Magazine:
Diesen Aspekt wollte Adrian Goiginger in seinem Film ebenfalls auf die fiktionale Figur Franz Streitberger übertragen. Wie hast Du dich mit dieser Sprache vertraut gemacht?
Simon Morzé:
Ich selbst komme aus Wien, daher war mir dieser Dialekt erst mal fremd. Aus diesem Grund habe ich viereinhalb Monate auf einem Bergbauernhof im Pinzgau verbracht, um mir diese Sprache anzueignen. Ich habe einfach dort im Betrieb mitgearbeitet und mich sehr viel mit den Menschen unterhalten, dadurch habe ich am Ende ganz gut in den Dialekt hineingefunden. Es war mir wichtig, das Pinzgauerisch so gut wie möglich zu beherrschen, denn ich finde, diese authentische Sprache ist für die Rolle essenziell.

»Ich portraitiere einen Menschen, der all das erlebt hat, was wir im Film zeigen.«
MYP Magazine:
Hast Du es als Bürde empfunden, dieser realen Person durch Dein Spiel gerecht zu werden?
Simon Morzé:
Nicht als Bürde, aber als eine gewisse Verantwortung, denn ich portraitiere einen Menschen, den es tatsächlich gegeben hat und der all das erlebt hat, was wir im Film zeigen. Adrian hat mir aber gleich zu Beginn des Projekts die Angst genommen und gesagt, er könne mir zwar viel vom echten Franz erzählen, aber es sei wichtig festzuhalten, dass es hier um einen fiktionalen Film gehe – und ein gemeinsames Projekt. Das hat mir sehr geholfen und mich bestärkt.
MYP Magazine:
Wie blickst Du insgesamt auf die Zusammenarbeit mit Regisseur Adrian Goiginger?
Simon Morzé:
Für mich war die Arbeit mit Adrian die beste, die ich je hatte. Ich habe bei diesem Projekt irrsinnig viel gelernt. Das Tolle an Adrian ist, dass er für seine Filme alles gibt. Das steckt das gesamte Team an und alle gehen an ihre Grenzen. Außerdem legt er sehr viel Wert auf Proben und auf eine intensive Vorbereitung – das ist weder in Österreich noch in Deutschland selbstverständlich. Für mich als Schauspieler war das ein Traum und eine enorm wichtige Erfahrung.

»Franz habe ich immer als eine Figur gesehen, die viel mit sich zu kämpfen hat.«
MYP Magazine:
Apropos Vorbereitung: Wie hast Du deinen Franz Streitberger angelegt? Was ist das für ein Charakter?
Simon Morzé:
Franz habe ich immer als eine Figur gesehen, die sehr in sich gekehrt ist und viel mit sich zu kämpfen hat. Immerhin stecken in ihm einige unverarbeitete Traumata, die immer wieder sein Handeln bestimmen. Daher habe ich ihn als einen Charakter angelegt, der keinen oder nur sehr beschränkten Zugang zu seinen Gefühlen hat. Mit Menschen tut sich Franz sehr schwer, er hält sie auf Abstand und vertraut ihnen nicht – wegen der vielen Verletzungen, die andere Menschen ihm im Laufe seines jungen Lebens zugefügt haben. Erst der kleine Fuchs bietet ihm eine Möglichkeit, wieder zu seinen Gefühlen zu finden. Durch die Fürsorge für das Tier entdeckt er, dass er überhaupt so etwas wie Zuneigung zeigen kann.

»In dem Moment, in dem er vom Vater weggegeben wird, wird Franz zutiefst an seiner Seele verletzt.«
MYP Magazine:
Die Figur macht über den gesamten Film eine enorme emotionale Entwicklung durch. Dabei scheint Franz vor allem eine große Wut in sich zu tragen.
Simon Morzé:
In der Tat! Am Anfang des Films ist Franz ein Kind, das mit positiven Gefühlen durch seine kleine Welt geht, auch wenn das Leben auf dem Bergbauernhof hart und karg ist. Doch in dem Moment, in dem er vom Vater weggegeben wird, bricht seine kleine Welt in sich zusammen und er wird zutiefst an seiner Seele verletzt. Durch die innere Verhärtung, die er daraus entwickelt, kommt ihm der Zugang zu seinen Gefühlen fast vollständig abhanden. Das, was in seiner Seele übrigbleibt, ist Wut. Und diese Wut ist die einzige Emotion, mit der er auf seine Umwelt reagieren kann, vor allem in Stresssituationen. Nur durch den kleinen Fuchs kann er letztendlich wieder sein Herz öffnen und zurück zu einer Gefühlswelt finden, die er nur aus frühen Kindertagen kennt, bevor er vom eigenen Vater weggegeben wurde.

»Sobald ein Fuchs am Set ist, ist es nicht leicht.«
MYP Magazine:
Der kleine Fuchs ist der heimliche Hauptdarsteller des Films. Wie hast Du den Dreh mit diesem Wildtier erlebt?
Simon Morzé: (lächelt)
Sobald ein Fuchs am Set ist, ist es nicht leicht. Füchse sind sehr scheu, daher war es immer besonders wichtig, das Set so klein wie möglich zu halten und vor allem laute Geräusche zu vermeiden. Beim Dreh hat sich so gut wie alles nach dem Fuchs gerichtet. Wenn er gerade gut drauf war, haben wir sofort die Kamera gepackt und losgelegt. Und wenn er eine Pause brauchte, haben auch wir pausiert. Man kann sagen, der Fuchs hat den Ton angegeben.

»Ich dachte mir: Die Szenen mit dem Fuchs muss man eigentlich animieren, anders geht das nicht.«
MYP Magazine:
Wie bereitet man sich als Schauspieler auf die Arbeit mit einem Fuchs vor?
Simon Morzé:
Als ich das Drehbuch zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir: Die Szenen mit dem Fuchs muss man eigentlich animieren, anders geht das nicht. Das Tier muss im Film ja nicht nur die unterschiedlichsten Dinge tun, sondern wird auch noch in verschiedenen Altersstufen gezeigt. Aber Adrian ließ mich ganz trocken wissen: „Nein, das wird ein echter Fuchs sein.“ Oder besser gesagt Füchse, denn wir haben für diesen Film mit insgesamt sechs Tieren gearbeitet, mit vier Welpen und zwei großen Füchsen.
Um mit diesen scheuen Tieren von Anfang an eine enge Verbindung aufbauen zu können, habe ich sie bereits wenige Tage nach ihrer Geburt beim Tiertrainer besucht – zu einem Zeitpunkt, als ihre Augen noch geschlossen waren. Ich habe sehr viel Zeit mit ihnen verbracht, sie gefüttert, mit ihnen gespielt und bin sogar Motorrad mit ihnen gefahren. Nur so hat es für mich überhaupt funktionieren können, später am Set mit ihnen zu arbeiten und sie in mein Spiel mit einzubeziehen. Daher waren die schönsten Momente auch die Szenen mit dem jeweiligen Fuchs, denn allein für mich als Darsteller ist es ein absolutes Glücksgefühl, wenn eine komplexe Szene mit so einem Wildtier funktioniert – und man es schafft, das auch auf Kamera festzuhalten.

»Der kleine Fuchs ist vor laufender Kamera in meinen Armen eingeschlafen.«
MYP Magazine:
Apropos Glücksgefühl: Gab es andere besondere Momente, an die Du dich gerne zurückerinnerst?
Simon Morzé:
Ich muss gerade an eine Szene denken, in der Franz den verletzten Fuchs ins Sanitätszelt bringt, weil er seine Pfote verbinden lassen will. In diesem Moment ist der kleine Fuchs tatsächlich vor laufender Kamera in meinen Armen eingeschlafen. Das war ein wunderschönes Gefühl und hat so toll gepasst in dem Augenblick, daran erinnere ich mich sehr gerne zurück.
Eine weitere Szene, die mir in besonderer Erinnerung geblieben ist, ist der Moment, in dem Franz zum ersten Mal das Meer sieht. Diese Szene haben wir auf Amrum gedreht. An dem Tag hatte auch ich plötzlich das Gefühl, zum ersten Mal das Meer zu sehen, denn in den vielen Wochen davor haben wir uns fast permanent im Wald oder an der Location des besetzten Schlosses aufgehalten. Und auf einmal steht man am Strand und blickt aufs Meer. Das war ein ganz, ganz toller Moment für mich.

»Franz beschützt den Fuchs auf exakt die Art und Weise, wie er selbst als Kind hätte beschützt werden müssen.«
MYP Magazine:
Die Szene am Meer ist auch deshalb eine besondere, weil Franz dort wieder auf seinen Kameraden Anton Dillinger trifft. Ihn hatte er Tage vorher im Stich gelassen, weil er lieber den kleinen Fuchs in Sicherheit bringen wollte. Welche Bedeutung hat diese menschliche Freundschaft für den fiktionalen Franz Streitberger?
Simon Morzé:
Die Tatsache, dass Franz und Anton eine Freundschaft verbindet, ist insofern ungewöhnlich, dass Franz ja sonst keine Freundschaften zu Kameraden pflegt. Diese freundschaftliche Beziehung zu Dillinger ist nur möglich, weil Franz von ihm als der akzeptiert wird, der er ist. Er fordert von ihm weder, sich zu verändern, noch sich in irgendeiner anderen Weise zu verstellen. Dillinger lässt Franz einfach Franz sein. Ich glaube, das ist für die beiden Männer die einzige Möglichkeit, miteinander auszukommen.
Dennoch wirft Franz die Freundschaft weg – für den Fuchs. Dieses Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen zieht sich durch den ganzen Film. Er verlässt all jene, die ihm die Hand reichen. Das Wohl des Fuchses geht für ihn immer vor – als wäre das Tier sein eigenes Kind. Er beschützt sein „Fichsei“, wie er den Fuchs liebevoll auf Pinzgauerisch nennt, auf exakt die Art und Weise, wie er selbst als Kind hätte beschützt werden müssen. Diese inhaltliche Analogie hat mir wahnsinnig geholfen, meine Figur zu formen.

»Ich werde es glücklicherweise nie wirklich verstehen können, wie es sich anfühlt, einen Krieg zu erleben.«
MYP Magazine:
Das Schicksal von Anton Dillinger und all den anderen Kameraden lässt der Film am Ende offen – und macht damit auf eine besonders stille Art und Weise deutlich, dass auch das zu den Schrecken des Krieges gehört: die unzähligen jungen Männer, die nicht mehr nach Hause zurückkehren, weil sie als Soldaten auf dem Schlachtfeld gestorben oder in den Kriegswirren verschollen sind. Wie bist Du emotional damit umgegangen, eine Figur zu spielen, die in ihrem realen Leben mit all diesen Schrecken konfrontiert war – und das sogar in dem gleichen Alter, in dem Du heute bist?
Simon Morzé:
Mein Gedanke dazu war: Egal, wie sehr ich mich vorbereite, wie viele Zeitzeugenberichte ich lese, wie viele Dokumentationen ich schaue und wie sehr ich versuche, mich in diese Situation hineinzuversetzen – ich werde es glücklicherweise nie wirklich verstehen können, wie es sich anfühlt, einen Krieg zu erleben. Und ich hoffe, das muss ich auch nie. Aus diesem Grund habe ich einen riesengroßen Respekt vor einem Menschen wie Franz Streitberger, der in solchen schlimmen Zeiten – und nach den in der Kindheit erlebten Traumata – nicht die Hoffnung verloren hat.

»Ich wollte, dass man diesen schrecklichen Krieg in seinem Gesicht sieht.«
MYP Magazine:
Nicht mal ein Jahr nach Abschluss Eurer Dreharbeiten hat Russland die Ukraine überfallen und mitten in Europa einen brutalen Angriffskrieg entfacht. Wie hast Du den Kriegsausbruch emotional erlebt? Was macht diese Situation mit Dir ganz persönlich?
Simon Morzé:
Diese Ereignisse haben mich extrem aufgewühlt – und tun es immer noch. Und das nicht nur, weil ich mich für diesen Film so lange mit dem Thema Krieg beschäftigt habe. Es ist so unfassbar traurig, dass die Menschen nicht aus den grausamen Erfahrungen der Vergangenheit lernen und so etwas wie Krieg sich immer wieder ereignet.
MYP Magazine:
In einer der letzten Szenen des Films kehrt Franz von der Kriegsgefangenschaft zurück zu seinem Elternhaus – jenem Bergbauernhof, den er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat…
Simon Morzé:
Hier war es mir enorm wichtig zu zeigen, wie desillusioniert und niedergekämpft Franz ist. Ich wollte, dass man diesen schrecklichen Krieg in seinem Gesicht sieht; dass alles Leben in seinen Augen mehr oder weniger erloschen ist; dass er allein ist und man sich als Zuschauer unweigerlich fragt: Wo sind all die anderen? Was ist mit Dillinger und den Kameraden? Verschwunden sind sie, denn das macht Krieg mit den Menschen. Und dann betritt Franz das verlassene Haus, findet den Brief und auf einmal passiert wieder etwas in diesem so geschundenen Körper…

»In diesem Moment spürt Franz die Liebe, von der er gar nicht vermutet hatte, sie empfinden zu können.«
MYP Magazine:
Ein Brief, den der mittlerweile verstorbene Vater an ihn gerichtet, aber nie abgeschickt hat.
Simon Morzé:
Genau. Franz hatte seinem Vater während des Krieges selbst einen Brief geschrieben. Und als er da in der Hütte steht und einige Schriftstücke in der Kommode findet, begreift er, dass sein Vater mit bestimmten Lautsymbolen lesen gelernt hat, um den erhalten Brief entziffern zu können. Im nächsten Moment entdeckt er einen Antwortbrief, den der Vater an ihn gerichtet, aber nie abgesendet hat. Obwohl der Vater nicht mehr lebt, spürt Franz in diesem Moment die Liebe, von der er gar nicht vermutet hatte, sie empfinden zu können. Nachdem er den Brief an ihn gelesen hat, versteht er, warum ihn sein Vater damals weggegeben hat. Er hatte keine andere Wahl und tat es letztendlich aus Liebe, weil er wusste, dass der kleine Junge in der bitterarmen Bergbauernfamilie nicht überleben würde. Diesen Umstand kann er nur verstehen, weil er bei dem kleinen Fuchs gezwungen war, genauso zu handeln: Er hat ihn aus Liebe im Wald zurückgelassen, weil er wusste, dass er in Russland nicht überleben würde. So schließt sich der Kreis für ihn – ich persönlich sehe das als ein sehr hoffnungsvolles Ende.

»Das Einzige, was ich hatte, war dieser Brief.«
MYP Magazine:
Diese Szene ist emotional sehr aufgeladen, man kann auf Deinem Gesicht geradezu mitverfolgen, was Franz in dem Moment durch den Kopf schießt und was der Brief des Vaters mit ihm macht. Wie blickst Du auf den Dreh dieser Schlüsselszene zurück?
Simon Morzé:
Diese Szene zu spielen, war nicht leicht, weil ich kein Gegenüber hatte, keinen Anspielpartner. Das Einzige, was ich hatte, war dieser Brief. In dem Moment hat sich die intensive Vorbereitung ausgezahlt, denn ich hatte über viele Monate aus Franz‘ Perspektive Tagebuch geschrieben, um die Erlebnisse seiner Kindheit so konkret wie möglich fassen zu können. Dadurch habe ich es in der betreffenden Szene geschafft, eine spezifische und emotional greifbare Situation zu kreieren, auf die ich in meinem Spiel zurückgreifen konnte.

»Unser Film zeigt, wie wichtig es ist, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können.«
MYP Magazine:
Regisseur Adrian Goiginger sagt, der „Der Fuchs“ sei auch ein Film über Vergebung. Siehst Du das ähnlich?
Simon Morzé:
Absolut! Dadurch, dass Franz ein Lebewesen weggeben muss, das er liebt, versteht er seinen Vater und kann ihm verzeihen. So können die Wunden, die ihm in seiner Kindheit zugefügt wurden, endlich heilen. Doch „Der Fuchs“ ist nicht nur ein Film über Vergebung, sondern auch über Empathie, denn er zeigt, wie wichtig es ist, sich in andere Menschen und ihre Lebenssituation hineinversetzen zu können.
Ohnehin kann man sehr viel mitnehmen aus diesem Film, auch weil er sich mit einem historischen Zeitabschnitt Österreichs beschäftigt, in dem arme Bergbauernfamilien fast massenhaft Kinder weggegeben und verkauft haben, wenn sie sie nicht mehr ernähren konnten. Das ist ein Thema, das vielen Menschen gar nicht so bekannt ist.
Darüber hinaus schafft es dieser Film – zumindest ist es mir persönlich so ergangen –, dass man als Zuschauer intensiv über seine eigene Familie nachdenkt: über all die unnötigen Streitigkeiten und Verwerfungen, die es so gibt, aber auch über den Mangel an Empathie, vielleicht sogar bei sich selbst. Mir jedenfalls hat „Der Fuchs“ noch mal ganz neue Perspektiven auf meine eigene Familiengeschichte ermöglicht und die Begriffe Vergebung und Liebe in gewisser Weise neu definiert, möchte ich sagen. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Nach dem Kinostart in Österreich sind etliche Menschen auf mich zugekommen, die mir erzählt haben, dass ihnen unser Film einen anderen Blick auf ihre eigene Familiengeschichte verschafft hat, wodurch sie die Ereignisse der Vergangenheit reflektieren und wieder in Kontakt zu ihren Vätern und Müttern kommen konnten. Ich wünsche mir, dass „Der Fuchs“ das auch bei dem deutschen Publikum schafft.

Mehr über »Der Fuchs«:
Mehr über Simon Morzé:
Interview und Text: Jonas Meyer
Fotografie: Steven Lüdtke
Historische Beratung: Rudolf Leo
Fabian Grischkat
Interview — Fabian Grischkat
»Wir haben keine andere Wahl, als hoffnungsvoll zu sein«
Influencer und Aktivist Fabian Grischkat macht sich auf Instagram, TikTok und Co. fast täglich für Klimaschutz und die Rechte queerer Menschen stark. Dabei richtet sich der 22-Jährige nicht nur an die Generation Z. Auch viele ältere Semester zählen zu seinem Publikum, denn Fabians Content ist unterhaltsam, informativ und gut recherchiert.
Ein Interview über journalistische Verantwortung, die Definition von Männlichkeit und das Prinzip Hoffnung im Angesicht der sich abzeichnenden Klimakatastrophe.
6. April 2023 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Steven Lüdtke

„Früher war alles besser.“ Es steckt viel Sehnsucht in dem kleinen Satz, der, leicht dahingeseufzt, die vermeintlich guten alte Zeiten feiert. Zeiten, in denen die Welt – meist die eigene – irgendwie entspannter und geordneter schien als heute. Doch das romantisierte Bild, wer hätte es gedacht, ist schnell mit Fakten widerlegt. Vor allem gesellschaftspolitisch gab es in den letzten fünfzig Jahren die eine oder andere Errungenschaft, die man nicht mehr missen möchte.
In Bezug auf das Klima hat der Satz allerdings seine Berechtigung. Denn früher, genauer gesagt vor 250 Jahren, war hier tatsächlich alles besser. Denn erst mit Beginn der industriellen Revolution und dem massenhaften Einsatz fossiler Energieträger stieß der Mensch eine verheerende Entwicklung an, die bereits jetzt die Temperatur der Erdoberfläche um gut ein Grad Celsius erhöht hat – und die bis zum Ende des Jahrhunderts zu einer zivilisatorischen Katastrophe führen kann, wenn die Erderwärmung nicht auf maximal 1,5 Grad begrenzt wird.
Dass diese Katastrophe noch abzuwenden ist, wenn man sich nur mit aller Kraft und Vehemenz dagegenstemmt, erklärt Fabian Grischkat fast täglich seinem Publikum auf Instagram, TikTok und Co. Der 22-Jährige, der sich selbst als Influencer, Aktivist, Moderator und Filmemacher bezeichnet, hat es sich mit seinen Videos zur Aufgabe gemacht, für Aufklärung in Sachen menschgemachter Klimawandel zu sorgen – und das auf eine äußerst unterhaltsame, informative und fast gebetsmühlenartige Art und Weise.
Doch das Klimathema ist nur einer seiner Schwerpunkte. Mindestens genauso leidenschaftlich setzt er sich auch für die Rechte queerer Menschen ein, prangert gesellschaftliche und politische Missstände an und erklärt, was sich zum Beispiel hinter Begriffen wie Pinkwashing, Konversionstherapie oder Shadow Banning verbirgt. Denn für queere Menschen war zwar früher definitiv nicht alles besser. Das heißt aber noch lange nicht, dass heute alles gut ist.
Fabian definiert sich selbst als bisexuell. Als er im August 2000 geboren wurde, war es gerade einmal sechs Jahre und zwei Monate her, dass der Deutsche Bundestag den Paragraf 175 ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch gestrichen hatte. Dieses aus dem Kaiserreich stammende und in der NS-Zeit verschärfte Gesetz stellte „widernatürliche Unzucht“ zwischen Männern unter Strafe. An das Leid der nach dem „Hundertfünfundsiebziger“ verurteilten Männer – sowohl im Dritten Reich als auch später in der Bundesrepublik – erinnerte der Bundestag erst kürzlich mit einer bewegenden Gedenkveranstaltung.
Fabian, der aus dem beschaulichen Nettetal im Rheinland stammt, weiß um sein Glück, in deutlich liberaleren und toleranteren Zeiten aufgewachsen zu sein, wie er in einem Gastbeitrag für den SPIEGEL schreibt. Titel: „Mich hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben“. Doch er erzählt auch davon, wie unwohl und allein er sich damals als Teenager in seinem Ort gefühlt habe, denn queere Clubs, Bars oder Jugendtreffs habe es nicht gegeben. Gemobbt worden sei er zwar nicht, aber dennoch belächelt. Eine Lebensrealität, die auch heute noch, im Jahr 2023, unzähligen Jugendlichen vertraut vorkommen dürfte.
Mittlerweile lebt Fabian Grischkat in Berlin. In den Räumlichkeiten seines Managements, der Agentur We Are Era, haben wir ihn zu einem ausführlichen Interview getroffen.

»Kein Wunder, dass ich mich an Vorbildern wie David Bowie orientiert habe.«
MYP Magazine:
In einem Gastbeitrag für den SPIEGEL aus dem August 2022 erzählst Du von Deinem Aufwachsen in einem idyllischen Dorf am Niederrhein, wo Du dich oft wie Daffyd Thomas aus der Serie „Little Britain“ gefühlt hast: the only gay in the village. Welche role models gab es für Dich als queeren Teenager?
Fabian Grischkat:
Als ich mit 14, 15 gemerkt habe, dass ich möglicherweise nicht heterosexuell sein könnte, gab es vor allem im deutschsprachigen Raum so gut wie keine bisexuelle Menschen, die in der Öffentlichkeit standen. Klar, im Kunst- und Kulturbereich ist man immer wieder mal auf Leute gestoßen, die sich als bisexuell identifiziert haben. Aber in all den „normalen“ Berufen waren Bisexuelle so gut wie unsichtbar. Dasselbe galt für mein persönliches Umfeld. Dabei hätte ich mir als Teenager jemanden gewünscht, der einfach mal sagt: „Hey Fabian, ich kann dich verstehen, ich fühle genauso.“ Aber den gab es nicht. Kein Wunder, dass ich mich erst mal an Vorbildern wie David Bowie orientiert habe. Mehr geholfen hätte es mir, wenn sich jemand wie Felix Jaehn, der 2018 in einem ZEIT-Interview von seiner Bisexualität erzählt hat, schon ein paar Jahre früher offenbart hätte. Oder wenn damals schon jemand aus dem Bundestag öffentlich erklärt hätte, bisexuell zu sein. Für Menschen wie mich hat so etwas nach wie vor eine große Bedeutung, es gibt uns das Gefühl von Normalität.


»Allein die Tatsache, dass wir überhaupt einen Queer-Beauftragten haben, ist ein wichtiges Signal für alle queeren Menschen in Deutschland.«
MYP Magazine:
Nicht nur in der Politik hat sich in den letzten Jahren einiges getan, was die Sichtbarkeit von queerem Leben in der Breite unserer Gesellschaft angeht. Gleichzeitig erleben wir, vor allem in den sozialen Netzwerken, wie junge Menschen in antiquierte Rollenbilder zurückfallen. Daneben erfreuen sich Videos über „echte Männlichkeit“ scheinbar großer Beliebtheit. Und der Begriff „schwul“ wird von vielen nach wie vor als Schimpfwort benutzt. Ist unser gesellschaftlicher Fortschritt vielleicht doch nicht so groß, wie wir manchmal denken?
Fabian Grischkat:
Man muss gesellschaftlichen Fortschritt immer aus zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite gibt es die juristische Ebene, die regelt, welche Rechte queere Menschen in unserem Land haben. Und auf der anderen Seite steht die gesellschaftliche Akzeptanz – die im Idealfall mit den juristischen Errungenschaften einhergeht. Ich finde, rein rechtlich befinden wir uns auf einem guten, aber dennoch schleppenden Weg. Letztes Jahr hat die Bundesregierung ihren Aktionsplan „Queer leben“ vorgestellt, der unter anderem die Verabschiedung des sogenannten Selbstbestimmungsgesetztes als Ersatz für das Transsexuellengesetz vorsieht. Leider lässt dieses Gesetz – entgegen der im Vorfeld gemachten Versprechungen – immer noch auf sich warten. Entsprechend frustriert ist die queere Community, denn dieses Gesetz wäre ein großer Fortschritt für uns. Aber schon allein die Tatsache, dass wir mit Sven Lehmann überhaupt einen Queer-Beauftragten haben, ist ein wichtiges Signal für alle queeren Menschen in Deutschland.

»Es ist ein Trugschluss, dass die Gen Z durchgehend politisch ist und das Klima schützt.«
MYP Magazine:
Und wie sieht es mit der gesellschaftlichen Akzeptanz aus?
Fabian Grischkat:
Leider erlebe auch ich immer wieder, dass „schwul“ weiterhin als Schimpfwort benutzt wird, auch bei Teenagern. Das ist wichtig zu erwähnen, denn gerade ältere Generationen haben oft ein fast schon utopisches Bild von der Generation Z. Aber nicht alle von uns sind woke, hip und Generation Greta. Es ist ein Trugschluss, dass die Gen Z durchgehend politisch ist und das Klima schützt. Aus diesem Grund müssen wir dringend unsere Bildungsangebote nachschärfen, denn queere Themen werden in den Schulen weiterhin kaum behandelt.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass man vor allem mit jungen Männern sehr früh darüber sprechen muss, was eigentlich Männlichkeit bedeutet. Die Jungs sollen wissen, dass sie nicht stark sein oder eine teure Karre fahren müssen, um ein „richtiger“ Mann zu sein. Solange wir da nichts tun, wird „schwul“ auch in Zukunft ein Schimpfwort sein, da bin ich mir ganz sicher. Es darf in Deutschland keine Projektarbeit bleiben, über queeres Leben und Männlichkeit im 21. Jahrhundert zu sprechen.

»Männer können viel mehr, als sie denken. Sie begrenzen sich selbst nur allzu oft durch einen veralteten Männlichkeitsbegriff.«
MYP Magazine:
Hast Du für dich eine bestimmte Definition von Männlichkeit?
Fabian Grischkat: (grinst)
Ein guter Mann muss schlechte Witze beherrschen! Aber im Ernst: Ich glaube, dass der Begriff Männlichkeit äußerst wandelbar ist und verschiedenste Lebensrealitäten umfasst. Deswegen fällt es mir auch so schwer, heute, im Jahr 2023, eine konkrete Definition zu formulieren, denn die kann in fünf bis zehn Jahren schon wieder vollkommener Schwachsinn sein. Allerdings glaube ich, dass all die aktuellen Männlichkeits-Definitionen, die einem in merkwürdigen YouTube-Videos oder Coaching-Angeboten oder Kollegah-Büchern vermittelt werden, etwas ist, das wir schon jetzt nicht mehr brauchen. Es erzeugt bei jungen Männern einen enormen Druck, wenn sie versuchen, etwas zu sein, was sie nicht sein können. Auch deshalb liegt es mir fern, die eine, allumfassende Definition von Männlichkeit zu geben. Wenn ich sage, Männer tragen auch Kleider, dann will ich damit nicht sagen, dass Männer Kleider tragen müssen. Sondern, dass sie es können. Ich glaube ohnehin, dass Männer viel mehr können, als sie denken. Sie begrenzen sich selbst nur allzu oft durch einen veralteten Männlichkeitsbegriff.

»Ich habe innerhalb der queeren Community leider genauso oft Vorurteile gegenüber meiner sexuellen Orientierung erlebt wie außerhalb.«
MYP Magazine:
Auch die queere Community bekleckert sich nicht immer mit Ruhm, wenn es um die Akzeptanz bestimmter Lebensrealitäten oder auch Sexualitäten geht. Welche Erfahrungen hast Du persönlich in dem Zusammenhang gemacht?
Fabian Grischkat:
Wie in fast allen Gesellschaftsbereichen gibt es auch in der queeren Community patriarchale Strukturen, sie wird dominiert von älteren, meist weißen Männern – nur, dass es sich in dem Fall um schwule Männer handelt. Diese homosexuellen Männer haben es nie wirklich akzeptiert, dass ich mich persönlich als bisexuell definiere. Oft hieß es: „Du bist doch eigentlich schwul und stehst nicht dazu.“ In diesem Umfeld habe ich einige wirklich schwierige Erfahrungen gemacht. Daher kann ich auch definitiv nicht davon sprechen, dass die queere Community ein safe space für alle ist. Aber ich will die schwulen alten Männer auch nicht vor den Kopf stoßen…
MYP Magazine:
Mach doch mal.
Fabian Grischkat:
Gerade ältere schwule Männer haben in dieser Gesellschaft sehr viel bewegt in den letzten Jahrzehnten, daher möchte sie auch nicht verteufeln. Aber häufig müssen gerade diese Akteure erst mal vor der eigenen Haustür kehren und überlegen, ob sie möglicherweise selbst ein bisschen diskriminierend sind in ihrem Denken und Handeln. Ich habe innerhalb der queeren Community leider genauso oft Vorurteile gegenüber meiner sexuellen Orientierung erlebt wie außerhalb.
Übrigens: Man darf nicht vergessen, dass es in den letzten Jahrzehnten nicht nur viele schwule Männer, sondern auch zahlreiche lesbischen Frauen gab, die sich für mehr Toleranz und Gleichberechtigung engagiert haben – und teilweise noch härter ackern mussten als die Schwulen. Denn sie mussten sich nicht nur ihre Rechte als Homosexuelle erkämpfen, sondern gleichzeitig auch ihre Rechte als Frauen. Das geht leider allzu oft unter, ist aber genauso wichtig, erzählt und respektiert zu werden.
»Dieser alte weiße Mann schafft es sogar, wie das Sprachrohr einer jungen, rebellischen Generation zu klingen.«
MYP Magazine:
Apropos alte Männer: Für Deine Videos schlüpfst Du immer wieder mal in die Rolle eines alten weißen Mannes namens Alman Achim…
Fabian Grischkat:
Ich trage heute sogar seinen Pullover.
MYP Magazine:
Gibt es im Gegensatz zum fiktionalen Achim einen realen alten weißen Mann, auf den Du einen positiven Blick hast – und der Dich vielleicht sogar inspiriert?
Fabian Grischkat:
Eines vorab: Mir wird häufig vorgeworfen, dass ich mit dieser Figur einen Vaterkomplex abarbeiten würde. Das ist definitiv nicht der Fall… Also: Welcher alte weiße Herr inspiriert mich?
(überlegt sehr lange)
Es gibt vor allem in meinem privaten Umfeld viele Menschen, auf die das zutreffen würde. Aber wenn ich jemanden nennen müsste, der allgemein bekannt ist, würde ich sagen: Herbert Grönemeyer. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass ein 22-Jähriger von Herbert Grönemeyer schwärmt. Aber Herbert hat so eine frische und jugendliche Attitüde und einen so scharfsinnigen Blick auf die Welt, dass ich diesen Künstler echt toll finde. Ich bewundere sein Lebenswerk und die Tatsache, dass er sich selbst trotz zunehmenden Alters treu bleibt und nicht anfängt, irgendeinen Mist zu schwurbeln oder sich auf einmal über das Gendern aufzuregen. Oder dass er trans sein nicht versteht. Das alles kommt ja durchaus mal vor bei alten weißen Männern. Herbert aber ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch als ältere Person noch präsent sein kann, ohne dabei peinlich oder diskriminierend zu agieren. Und da er erst kürzlich mit seinem Song „Deine Hand“ die Proteste im Iran thematisiert hat, schafft es dieser alte weiße Mann sogar, wie das Sprachrohr einer jungen, rebellischen Generation zu klingen.
Außerdem wurde ich im Ruhrgebiet geboren, es liegt also in meinen Genen, dass ich Herbert Grönemeyer gut finde. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit hätte, fünf Minuten mit ihm zu sprechen – das wäre mein persönlicher Fan-Boy-Moment. Wir könnten ja mal auf eine gemeinsame Pommes. Oder eine vegane Currywurst.

»Jede private Information, die man ins Netz stellt, kann brandgefährlich werden.«
MYP Magazine:
Auch wenn Du selbst noch nicht so bekannt bist wie Herbert Grönemeyer, stehst Du dennoch in exponierter Weise in der Öffentlichkeit. Wie gehst Du mit dem großen Interesse an Deiner Person um? Schmeichelt es Dir? Oder beschränkt es Dich in Deinem Alltag, etwa beim Ausgehen, Daten oder Einkaufen?
Fabian Grischkat:
Weder noch. Es ist zu einer gewissen Normalität geworden – auch, weil ich ohnehin recht viel von meinem Leben mit der Öffentlichkeit teile. Aber selbstverständlich geht das auch mit einer gewissen Vorsicht einher. Bei jedem geposteten Foto denke ich vorher darüber nach, was das jetzt aussagen könnte.
MYP Magazine:
Wir sehen Dich online beim Sport treiben, beim Abendessen mit Freunden oder im Wartezimmer nach der Immuntherapie. Gibt es Momente, in denen Du das Gefühl hast, gerade zu viel von Deinem Privatleben preisgegeben zu haben?
Fabian Grischkat:
Es ist ein schmaler Grat. Auf der einen Seite will ich anderen zeigen, dass ich ein normaler Mensch bin – und nicht der High Performer, für den man mich vielleicht halten könnte. Auch ich habe kack Tage, vor allem im Winter in Berlin. Auf der anderen Seite weiß ich, dass jede private Information, die man ins Netz stellt, brandgefährlich werden kann. Es gibt nach wie vor Dinge, die ich niemals posten würde, weil es da um das Privateste vom Privaten geht. Das würde ich auch von anderen Menschen nicht erfahren wollen.


»Mir geht es am Ende des Tages darum, in den Spiegel zu schauen und stolz auf das zu sein, was ich tue.«
MYP Magazine:
Im Podcast „It’s All About“ hast Du vor kurzem erzählt, dass Du dich in Deiner Tätigkeit als Influencer auch für die reine Unterhaltungs- und Selbstdarstellungsschiene hättest entscheiden können. Warum hast Du dich dagegen entschieden?
Fabian Grischkat:
Mir selbst gefällt es doch auch nicht, wenn ich Instagram öffne und mein Feed voller oberkörperfreier Typen ist. Oder wenn mir dauernd irgendwelche Menschen mitteilen, warum sie heute schon 5.000 Euro verdient haben und wie ich das auch schaffen kann, wenn ich nur irgendeiner dubiosen WhatsApp-Gruppe beitrete. Ich glaube, viele Influencer:innen haben mittlerweile ein echtes Problem, weil sie mit dieser Arbeit nicht die enormen Summen an Kohle rechtfertigen können, die sie verdienen.
Mir persönlich geht es am Ende des Tages darum, in den Spiegel zu schauen und stolz auf das zu sein, was ich tue. Bestimmt würde ich deutlich mehr Geld verdienen, wenn ich nicht diese Politikschiene eingeschlagen hätte. Aber das war mir nie wichtig. Ich will auf die Frage, wie ich meinen Tag verbracht habe, nicht antworten, dass ich mal wieder zehn Kinder in eine sinnlose WhatsApp-Gruppe geholt und abgezogen habe. Für mich ist es ein Erfolgserlebnis, wenn wir mal wieder eine Demo organisiert haben, bei der alles geklappt hat. Dennoch müssen nicht alle Influencer:innen hochpolitisch sein. Auch ich folge einigen ganz banalen Accounts…
MYP Magazine:
Zum Beispiel?
Fabian Grischkat:
Zum Beispiel zwei Hunden auf Instagram, über deren Storys ich mich den ganzen Tag freuen kann.
»Ich würde erwarten, dass man zumindest so sensibel ist, keine Produktplatzierung an dem Tag zu posten, an dem gerade in Europa ein Krieg ausbricht.«
MYP Magazine:
Das erzeugt auch wesentlich bessere Stimmung, als permanent mit scheinbar perfekten Körpern konfrontiert zu sein.
Fabian Grischkat:
Ja, genau! Aber auch die perfekten Körper haben ihre Berechtigung auf dieser Plattform. Ich würde mir nur wünschen, dass sich diese Leute ihrer Verantwortung bewusst werden. Als zum Beispiel der Krieg gegen die Ukraine ausgebrochen ist, haben etliche Influencer:innen weiterhin ihre Produktplatzierungen gepostet. Hier würde ich mir ein Mindestmaß an Sensibilität erwarten. Man muss doch checken, dass das gerade der absolut falsche Zeitpunkt ist. Darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass man seine Reichweite vielleicht ein- oder zweimal im Jahr für etwas halbwegs Gutes zur Verfügung stellt. Danach kann man ja wieder tausend Mal den nackten Oberkörper posten.

»Ich folge zwar gewissen journalistischen Standards, aber auch nicht allen.«
MYP Magazine:
Bleiben wir kurz beim „It’s All About“-Podcast. Dort hast Du erwähnt, dass Du dich selbst nicht unbedingt als Journalist bezeichnen würdest, weil Du einen gehörigen Respekt vor der Arbeit „gelernter“ Journalist:innen hättest. Bist Du an dieser Stelle nicht etwas zu bescheiden? Immerhin scheinst Du dich konsequent an journalistischen Maßstäbe und Werten zu orientieren.
Fabian Grischkat:
Ich fände es nach wie vor anmaßend, mich als reinen Journalisten zu bezeichnen. Ich folge zwar gewissen journalistischen Standards, das stimmt, aber auch nicht allen. Zum Beispiel unterliege ich keiner journalistischen Sorgfaltspflicht, aber gerade das ist für mich der große Unterschied zwischen Influencer:innen und Journalist:innen – oder sagen wir guten Journalisti:innen. Wenn ich in meiner täglichen Arbeit einen Fakt in die Welt setze, bin ich nicht dazu verpflichtet, überhaupt eine Quelle anzugeben; oder die Quelle gegenzuchecken, die ich verwende. Ich mache das bei meinen Recherchen nur, weil ich selbst die Gewissheit haben will, ob die Info, die ich gerade irgendwo aufgeschnappt habe, wirklich der Wahrheit entspricht. Und solange ich das nur auf einer freiwilligen Basis tue, möchte ich mich nicht Journalist nennen. Vielleicht ist das in fünf Jahren anders, denn ich überlege mir gerade, noch ein Studium in diese Richtung anzustreben.

»Ich möchte nicht, dass Axel-Springer-Formate diesen Markt kapern.«
MYP Magazine:
Außerhalb des klassischen Journalismus gibt es mittlerweile diverse andere reichweitenstarke Player, die ebenfalls investigativ arbeiten und Missstände aller Art aufdecken – wie etwa Rezo oder Jan Böhmermann. Wie erlebst Du diese Entwicklung? Steckt der klassische Journalismus in der Krise?
Fabian Grischkat:
Eine Krise sehe ich aktuell nicht. Aber ich glaube, dass auch der Journalismus sich wandeln muss – wie fast alles in unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft. Wenn der Journalismus für junge Menschen attraktiv sein will, muss er sie dort erreichen, wo sie sind. Die Gen Z liest durchaus Artikel – ja, wir können lesen! Allerdings beziehen wir unsere Nachrichten nicht aus den Tageszeitungen unten am Kiosk, sondern von Plattformen wie Twitter, TikTok oder Instagram. Dem sogenannten Qualitätsjournalismus muss es daher irgendwie gelingen, seine Inhalte auch vertikal zu verpacken – und zwar so, dass sie innerhalb weniger Sekunden die Aufmerksamkeit der Gen Z auf sich ziehen.
So etwas fällt zum Beispiel der Bildzeitung mit ihren stark verkürzten Botschaften deutlich leichter als einem Medium wie etwa der ZEIT. Aber gerade, weil ich nicht möchte, dass Axel-Springer-Formate diesen Markt kapern, appelliere ich nachdrücklich an die Qualitätsmedien: Springt über euren Schatten, setzt euch mit jungen Leuten an einen Tisch und überlegt, wie ihr es schaffen könnt, als großes Medienhaus auf den großen sozialen Plattformen attraktiv zu werden. Die Tagesschau zum Beispiel zeigt seit Jahren, dass es möglich ist, eine klassische TV-Sendung in ein vertikales Kurzformat auf TikTok zu übersetzen.

»Wenn wir erst im Jahr 2100 verstanden haben, was ein Kipppunkt ist, ist das Klima längst gekippt.«
MYP Magazine:
Anfang des Jahres sorgte die Meldung für Aufsehen, dass Raphael Thelen, Mitbegründer des Netzwerks Klimajournalismus, seinen Job als Journalist an den Nagel gehängt hat und sich nun als Aktivist bei der „Letzen Generation“ engagiert. In einem Interview mit Übermedien beklagt er unter anderem, dass es bei Journalist:innen immer noch viel Unwissen über die Klimakrise gebe. Er sagt: „Ganz viele Menschen, auch in Redaktionen, wissen bis heute nicht, was ein Kipppunkt ist, was ein Feedback Loop ist. Die wissen nicht, dass drei Grad Erwärmung, die wir ja Ende des Jahrhunderts ungefähr haben werden, sechs Grad in Deutschland bedeuten. Das heißt, Berlin hat so ein Klima wie Toulouse.“ Dabei drohe bereits bei zwei Grad ein Zivilisationskollaps. Hat der klassische Journalismus an dieser Stelle versagt?
Fabian Grischkat:
Puh, ich würde nicht so weit gehen, gleich von Versagen zu sprechen. Und ich möchte auch nicht allen Journalist:innen und Medienhäusern in diesem Land pauschal vorwerfen, dass sie die Klimakrise nicht ausreichend thematisieren. Dennoch hat es zum Beispiel unglaublich lange gedauert, bis sich die meisten Medienschaffenden darauf geeinigt haben, nicht von Folgen des Klimawandels, sondern von einer Klimakatastrophe zu sprechen. Wenn Journalist:innen vorher diesen Begriff in ihren Text geschrieben hatten, kam der Chefredakteur und sagte: „Naja, das ist jetzt aber ein bisschen hart formuliert. Der Winter ist halt etwas wärmer, aber wir können doch hier nicht von einer Katastrophe reden.“ Solche frustrierenden Geschichten hört man immer wieder.
Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass sich das Bewusstsein zumindest ansatzweise geändert hat – auch wenn manche Medienhäuser immer noch glauben, es reiche aus, hier und da mal eine einzelne dpa-Meldung zu veröffentlichen – wie etwa zu den Protesten in Lützerath. Das Ziel für die nächsten Jahre muss sein, tagtäglich über die Klimakatastrophe zu berichten und dabei nichts zu beschönigen. Bei Themen wie Corona oder dem Ukraine-Krieg hat das ja auch funktioniert. Ich will jetzt nicht dystopisch klingen, aber wenn wir erst im Jahr 2100 verstanden haben, was ein Kipppunkt ist, ist das Klima längst gekippt.

»Mich als BILD-Leser würde das ärgern.«
MYP Magazine:
In dem BILD-Artikel „Schnee? Nee!“ vom 9. Januar 2023 berichtet die Autorin ausführlich über die hohen Januar-Temperaturen in Europa. Die Begriffe „Erderwärmung“, „Klimawandel“ oder „Klimakrise“ sucht man allerdings vergebens, geschweige denn das Wort „Katastrophe“. Beschleicht Dich nicht öfter mal ein Gefühl von Ohnmacht, wenn Du mit der medialen Realität in diesem Land konfrontiert bist?
Fabian Grischkat:
Was die Bildzeitung angeht, haben viele junge Menschen, die wie ich politisch aktiv sind, mittlerweile resigniert. Es sagt doch alles, wenn ein Blatt lieber über die „Klimakleber“ berichtet als über die Weltklimakonferenz letzten November in Ägypten. Das ist frustrierend. Dabei würde es der Bildzeitung guttun, ihre Leser:innen über die Relevanz der Klimakatastrophe aufzuklären. Man schreibt sich bei Springer doch auf die Fahne, besonders ehrlich zu seiner Leserschaft zu sein. Aber ist es nicht so, dass man die Leute belügt, zumindest indirekt, wenn man ihnen wichtige Informationen vorenthält? Mich als BILD-Leser würde das ärgern – und ich würde mich ein wenig verarscht fühlen von dieser Zeitung. (lächelt)

»Wer wäre ich denn als Teil der Gen Z, wenn ich sagen würde: Es ist doch eh alles verloren.«
MYP Magazine:
An den Lützerath-Protesten im Januar hat unter anderem auch die Band AnnenMayKantereit teilgenommen und vor Ort ein spontanes Konzert gegeben. Den Auftritt beschloss Sänger Henning May mit folgenden Zeilen: Und nur, weil andere mehr machen als ich / Ist die Welt nicht völlig fürchterlich / Und nur weil andere so stark sind und klug / hab‘ ich manchmal / Hoffnung und Mut / Hoffnung und Mut / tut gut. Welche Hoffnung hast Du, wenn Du in die Zukunft blickst?
Fabian Grischkat:
Ich glaube, dass vor allem die Generation Z einen sehr schwierigen Start hatte, was das Thema Hoffnung angeht. Es ist ja nicht so, dass wir das mit dem bisschen Erderwärmung nur in den Griff bekommen wollen, nur weil das irgendwie ganz cool wäre. Es geht hier um nicht weniger als um unsere Lebensgrundlage, und zwar die von uns allen. Dementsprechend sind unsere Hoffnungen und Wünsche mit konkreten Ängsten verbunden. Dennoch haben wir überhaupt keine andere Wahl, als hoffnungsvoll zu sein.
Was mich in meiner eigenen Hoffnung bestärkt – und da schließe ich mich gerne Henning May an – ist, dass ich nach wie vor so viele motivierte Menschen erlebe, die sich von ganzem Herzen engagieren: junge Leute, aber auch alte, denn nicht alle Boomer sind blöd. (grinst) Diese Hoffnung möchte ich gerne auch anderen geben. Auch wenn es auf dieser Welt viele Arschlöcher gibt – um mal Kurt Krömer zu zitieren – und diese Arschlöcher oft über viel Macht und sehr viel Kapital verfügen, gibt es auf der anderen Seite trotzdem viel mehr gute Leute: Wissenschaftler:innen, Forscher:innen, Aktivist:innen oder einfach nur Menschen wie meine Oma, die an Weihnachten vegane Plätzchen für mich macht; Menschen, die zumindest versuchen dazu beizutragen, unsere Gesellschaft zu einer besseren zu machen; Menschen, die nicht nur die Krisen ernst nehmen, sondern auch die Sorgen und Bedürfnisse junger Menschen. Wer wäre ich denn als Teil der Gen Z, wenn ich sagen würde: Es ist doch eh alles verloren. Vor allem gegenüber all den Leuten, die ich motiviert habe, auf Demos zu gehen – denen jetzt zu sagen, das sei doch eh alles Quatsch, fände ich ein bisschen respektlos.
Nein, es ist nichts verloren, wir können das noch schaffen. Das ist die erste wichtige Nachricht, die wir auch in der Klimagerechtigkeits-Bewegung immer wieder nach draußen senden. Es gibt gute Gründe, warum es sich weiter lohnt zu kämpfen. Wir müssen das vielleicht nur mit etwas radikaleren Mitteln tun. Und wir müssen uns da wirklich reinknien.

»Das mit dem Alleinsein verbundene Gefühl von Einsamkeit hat sich im Laufe der Zeit zu etwas Positivem verwandelt.«
MYP Magazine:
Du hast auf Deinem linken Unterarm den Begriff „Lonely Boy“ tätowiert. Bist Du einfach ein riesiger Fan von „The Black Keys“? Oder welche Geschichte verbirgt sich hinter dem Tattoo?
Fabian Grischkat: (lacht)
Ich finde diesen Song echt toll, das kann ich nicht abstreiten. Das Tattoo hat aber vielmehr damit zu tun, dass ich Einzelkind bin und vieles in meinem Leben allein stemmen musste. Ich gehe zum Beispiel stark davon aus, dass ich niemals angefangen hätte, Videos auf YouTube hochzuladen, wenn ich Geschwister gehabt hätte. Irgendwie musste ich mich ja mit mir selbst beschäftigen – masturbieren ging damals noch nicht. Also habe ich mir aus purer Langeweile ein paar Lego-Männchen genommen und meine Kamera darauf gehalten. Das Ganze habe ich nur auf YouTube veröffentlicht, weil ich wollte, dass das mehr Menschen sehen als meine Eltern und ich.
So ganz auf sich allein gestellt zu sein, hat mir aus heutiger Sicht also zu einem gewissen Erfolg verholfen. Und das mit dem Alleinsein verbundene Gefühl von Einsamkeit, das mir am Anfang noch so schrecklich vorkam, hat sich im Laufe der Zeit zu etwas Positivem verwandelt. Das Tattoo erinnert mich heute daran, dass dieses Alleinsein gar nicht so schlimm ist.
MYP Magazine:
Vielleicht bist Du selbst ja für viel mehr Menschen ein großer Bruder, als du denkst.
Fabian Grischkat:
Ja, das hoffe ich zumindest, denn ich hätte mir damals mit 14, 15 auch jemanden gewünscht, der all die Themen behandelt hätte, die mir in dem Alter durch den Kopf geschwirrt sind.
»Wenn ich fünf Prozent selbstbewusster wäre, würde ich da wahrscheinlich auch nackt rumlaufen.«
MYP Magazine:
In dem anfangs erwähnten SPIEGEL-Artikel schreibst Du über Deinen Heimatort Nettetal: „Es mag kurios klingen, aber ich merke sogar, dass ich mich anders verhalte, wenn ich dort zu Besuch bin, immer noch. Ich kleide mich nicht so grell, ich versuche auch sonst nicht aufzufallen, vermeide politische Diskussionen.“ Wie erklärst Du dir den Kontrast zwischen dem zurückhaltenden Fabian im analogen Nettetal und der selbstbewussten und meinungsstarken Person, die Du im Digitalen verkörperst?
Fabian Grischkat:
Ich würde durchaus behaupten, dass man mich mittlerweile kennt in Nettetal, daher verstecke oder verstelle ich mich da auch nicht. Trotzdem käme ich niemals auf die Idee, dort in meinem Netzshirt oder in einem anderen auffälligen Outfit rumzulaufen. Ich hatte immer das Gefühl, dass dieser Ort mich ein wenig einengt in meiner kreativen Freiheit. Vielleicht liegt das aber gar nicht an Nettetal, sondern einfach an einem Mangel an Selbstbewusstsein. Wenn ich fünf Prozent selbstbewusster wäre, würde ich da wahrscheinlich auch nackt rumlaufen.
Davon abgesehen trenne ich meine Besuche in der Heimat strikt von meinen anderen Projekten, alles Aktivistische lasse ich dann in Berlin. In Nettetal bin ich der ganz private Fabian, der nur da ist, um seine Familie und Freund:innen zu treffen. Doch wie ich in dem Artikel geschrieben habe: Irgendwann werde ich auch dort im Vorgarten die Regenbogenfahne hissen. Ich glaube, Nettetal ist bereit dafür.

Mehr von und über Fabian Grischkat:
Interview und Text: Jonas Meyer
Fotografie: Steven Lüdtke
Lorna Ishema
Kurzinterview — Lorna Ishema
»Mich interessieren Orte, an denen ich auf den ersten Blick nichts zu suchen habe«
Lola-Gewinnerin Lorna Ishema ist die erste Stipendiatin der Deutschlandstiftung Integration im Bereich Schauspiel. Wir haben die vielfältige und charismatische Darstellerin zu einem Photo Shoot getroffen und ihr dabei ein paar Fragen gestellt.
31. März 2023 — Fotografie: Frederike van der Straeten, Interview: Katharina Viktoria Weiß

Lorna Ishema, 1989 in Rubaga, Uganda, geboren, zog im Alter von fünf Jahren mit Ihrer Familie nach Hannover. Bereits in der Schule entdeckte sie ihre musischen Talente und erlernte in einem Orchester das Spiel der Querflöte. Nach dem Abitur studierte sie Schauspiel an der renommierten Otto Falckenberg Schule in München.
Bereits während ihres Studiums wurde sie von Luc Perceval für seine Inszenierung von J. M. Coetzees „Schande“ an die Münchner Kammerspiele engagiert. Es folgten Engagements ans Münchner Volkstheater und ans Deutsche Theater in Berlin sowie diverse Rolle in Film- und Fernsehproduktionen. So war sie etwa in der ARD-Serie „Polizeiruf 110“, der Amazon-Serie „You Are Wanted“ oder der Thriller-Serie „Breaking Even“ zu sehen.
Für ihre Rolle der „Naomi“ in Sarah Blaßkiewitz‘ Familiendrama „Ivie wie Ivie“, einem Film über die Identitätssuche zweier afrodeutscher Halbschwestern, gewann sie 2021 die Lola, den Deutschen Filmpreis für die beste weibliche Nebenrolle. Im Frühjahr 2022 war sie in der Fiction-Serie „Der Überfall“ als Polizistin Antonia Gebert zu sehen. Zuletzt beendete sie die Dreharbeiten für den neuen Netflix-Film „Paradise“, in dem sie an der Seite von Iris Berben und Kostja Ullmann spielt und der voraussichtlich in diesem Jahr bei dem Streamingdienst zu sehen sein wird.


»Ich empfinde eine Wertschätzung der Branche gegenüber meiner Arbeit.«
MYP Magazine:
Im Oktober 2021 hast Du den Deutschen Filmpreis gewonnen. Was hat sich seitdem für Dich verändert?
Lorna Ishema:
Ich fühle mich bestärkt und empfinde eine Wertschätzung der Branche gegenüber meiner Arbeit. Vielmehr hat sich aber nicht verändert. Ich achte weiter darauf, dass ich meine eigenen Wege und Ziele verfolge. Mir ist es wichtig, mir selbst treu zu bleiben.
MYP Magazine:
Wo stellt man so eine Lola hin?
Lorna Ishema:
Meine Nichte durfte sich einen Platz aussuchen. Die Goldene Lola steht jetzt in Kinderhöhe auf einer Ablage neben der Wohnzimmertür.


»Für mich war jede einzelne Vorstellung, die ich gespielt habe, wie eine Mutprobe.«
MYP Magazine:
Warum spielst du aktuell kein Theater mehr?
Lorna Ishema:
Zum einen habe ich schlimmes Lampenfieber. Für mich war jede einzelne Vorstellung, die ich gespielt habe, wie eine Mutprobe. Danach war ich unglaublich stolz auf mich. Zum anderen habe ich die Zeit am Theater als sehr einengend erlebt. Ich hatte so gut wie nie Menschen um mich herum, mit denen ich mich identifizieren konnte oder die für mich in irgendeiner Form eine Vorbildfunktion gehabt hätten. Auch wenn ich bewusst aufgehört habe, Theater zu spielen, vermisse ich es sehr. Und ich bin froh zu sehen, dass sich langsam etwas an den Strukturen dort ändert.


»Mir ist meine Angst egal, wenn mir meine Intuition sagt, ich soll etwas tun.«
MYP Magazine:
Bist du ein Mensch, der sich selbst mit eigenen Ängsten konfrontiert?
Lorna Ishema:
Ich drücke es etwas anders aus: Mich interessieren Orte, an denen ich auf den ersten Blick nichts zu suchen habe. Als Kind hatte ich ein Tennis-Stipendium, später habe ich über ein Förderprogramm der Schule in einem Blasorchester gespielt. Zum Theater bin ich gekommen, weil ich von einer Schauspielerin auf der Bühne inspiriert wurde, die nicht der gängigen Norm entsprach. Das Schauspielstudium zu Ende zu bringen, hat mich viel Kraft und Überwindung gekostet, auch weil es dort viele Parallelen zum Theaterbetrieb gab. Trotzdem ist mir meine Angst egal, wenn mir meine Intuition sagt, ich soll etwas tun.
MYP Magazine:
Wie bereitest Du dich auf eine Rolle vor?
Lorna Ishema:
Für größere Rollen arbeite ich oft mit einer Schauspielcoachin zusammen. In dieser Zeit kann ich ausloten, wo meine persönlichen Grenzen liegen und eine eigene Haltung zur Figur und zum Stoff entwickeln, um mich dann ganz frei auf den Dreh einlassen zu können.


»Ich würde gerne die Ariel in der neuen Disney-Verfilmung synchronisieren.«
MYP Magazine:
In was für einer Geschichte würdest Du gerne die Hauptrolle spielen?
Lorna Ishema:
Im „Black Panther“-Universum stattzufinden und Teil von etwas ganz Großem zu sein, würde mich instantly für immer stolz machen. Außerdem würde ich gerne die Ariel in der neuen Disney-Verfilmung synchronisieren. Auf diese Weise mit meiner Stimme zu arbeiten, wäre etwas völlig Neues für mich. Bis jetzt hatte ich dafür zwar noch kein Casting, aber es hat mich zumindest dazu gebracht, wieder Gesangsstunden zu nehmen. Und wenn ich noch einen Wunsch frei habe: Ich liebe die Texte von Sharon Dodua Otoo, einer britisch-deutschen Schriftstellerin, Publizistin und Aktivistin mit ghanaischen Wurzeln, die mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Ich würde liebend gerne mal in einem Film spielen, der auf einem Drehbuch von ihr basiert. Vor allem ihre Frauenfiguren, die oft komplex und anstrengend sind, reizen mich sehr.
MYP Magazine:
Vor kurzem hast du die Dreharbeiten zu dem Future-Thriller „Paradise“, einer Netflix-Produktion, beendet. Welche Abenteuer stehen sonst noch so an?
Lorna Ishema:
Ich belege aktuell ein Drehbuch- und Dramaturgie-Seminar an der Filmuniversität – ich möchte verstehen und lernen, warum es so schwierig ist, gute und komplexe Drehbücher zu schreiben.

Mit besonderem Dank
an die D59B Bar in Berlin.
Mehr von und über Lorna Ishema:
Fotografie: Frederike van der Straeten
Interview & Text: Katharina Viktoria Weiß
Alex Stoddard
Interview — Alex Stoddard
»I want my work to transcend time«
For more than a decade, American photo artist Alex Stoddard has been creating impressive visual worlds that deal with the reciprocal relationship between humans and nature. With his intimate, dreamy, and mostly surreal images, the 29-year-old has established a unique artistic style that fascinates people all over the world. With his latest project, INSEX, he explores the parallels between metamorphosis in the natural world and human coming-of-age. In an interview about not fitting in, the fascination of adolescence, and the attitude that there’s a place for all body types in art, Stoddard discusses his work.
16. März 2023 — Interview & text: Jonas Meyer, Photography: Osman Balkan

When people meet in Berlin, no matter when, no matter how, no matter where, the first minutes of the conversation often revolve around one all-important question: Were you born here, or did you move here?
While this question seems to be rather negligible for urban natives, it seems all the more relevant for those of group 2, especially if they have literally fled from the confinement and rejection they’ve experienced in their small towns and villages. Quite a few of them decided to throw themselves into the supposedly open arms of the metropolis, hoping to forget everything that happened in their lives before. So, it is not surprising that, in the end, their conclusion is simple. Big city: good. Small village: bad. And maybe you even agree.
Looking at Alex Stoddard’s images turns this equation completely on its head. The 29-year-old photo artist—who grew up in rural Georgia—describes with his art a form of desire that is pretty much the opposite of what you imagine a hip, fast-paced big-city life to be like. In intimate, dreamy, and mostly surreal motifs, he deals with the question of what place humans have in this world and how nature may reflect their emotions.
However, the young artist is not fighting against the urban—after all, he lives in Los Angeles himself. Rather, his impressive visual worlds open up a new perspective on the beauty and the inner peace that can be found in the great outdoors if only you let yourself discover it. Perhaps this is one of the reasons why he repeatedly shows himself as the protagonist of his photography.
With his latest project, INSEX, Alex goes one step further. In a comprehensive series of staged and highly stylized images—which are compiled in his debut book of the same name—he explores the parallels between metamorphosis in the natural world and human coming-of-age. He invites viewers into a colorfully dark world of budding sexuality and crawling insects.
We met the open-minded, reflective, and warm-hearted young artist for a personal interview and photo shoot, after he presented his newest book, in the rather unromantic, busy, and cold city center of Berlin.

»I don’t want my work to ever be nailed down to a particular period by outfit or location.«
MYP Magazine:
With your art, you’ve always focused on the interaction of the human body with nature. What is your personal desire behind this approach?
Alex Stoddard:
Pure nature is incredibly beautiful. I’ve also found so many connections between humans and nature in the very physical sense, but in a way that certain natural elements can elicit an emotion in me, which probably applies to other people as well. Flowing water, for example, can have a very calming effect on people. I think that humans and nature are tied intrinsically to each other. Apart from this, nature is always a very timeless place to shoot. I want my work to transcend time. I don’t want it ever to be nailed down to a particular period by outfit or location. So, I like to shoot with clothing that’s very simple and nondescript, and in locations where it could be any time or place. That’s ambiguous, and I feel like that gives it a more universal aspect.

»I want my pictures to hopefully give a more emotional tone to the fact that we are really destroying the planet.«
MYP Magazine:
Does the damage to nature caused by human-induced climate change affect your work in any way?
Alex Stoddard:
Absolutely! Something I explore in quite a few of my photos is the human impact on nature—topics like how we are affected by species extinction, deforestation, or pollution. Some of my photos, for example, show me with a dead fish washed up on a beach, or myself flying among a bunch of chopped-down trees in a very deforested area. That’s something I really want to dive into more with my work in the future, beyond just creating something that is beautiful. I definitely want to explore more the topics of climate change and human impact on nature with my images. I want them to have some real-world impact, to bring more awareness, and hopefully give a more emotional tone to the fact that we are really destroying the planet.

»In art, there’s a place for all body types and the diversity of humans.«
MYP Magazine:
You’ve been working as an artist for more than a decade. What did you learn about the human body in general in that time?
Alex Stoddard:
I’ve learned more of an appreciation for it, just through photographing myself and others often nude or in very revealing and intimate situations. That’s why I’ve been wanting to explore shooting more body types and bringing more representation to that. I think that’s important. In art, there’s a place for all body types and the diversity of humans.
MYP Magazine:
As you just said, in many of your pictures, you often show yourself completely nude. How has your art influenced your relationship with your body?
Alex Stoddard:
Honestly, no. I create my art in a very similar way to when I started. And I don’t think I’ve ever really been ashamed of my body and of showing it in that way. So, it’s remained largely the same. I’ve always tried to separate my view of myself from the view of the person I’m photographing. That’s why I see myself as a different person in my pictures. As a result, when I look in the mirror, I often see a character rather than myself. I use my body more as a tool to accomplish a task or to create a certain pose or look in the picture. And I try not to let it reflect on how I view myself outside of the images.

»I get a little annoyed when people use to water my work down to me being naked.«
MYP Magazine:
Only at first does the physical nudity in your photos seem to be a form of exposure. The second glance gives the impression of being confronted with a much more emotional form of exposure. Is that the actual definition of nudity for you?
Alex Stoddard:
Yeah, I guess I really do show more of my emotional life in the whole context, like being vulnerable, for example, than simply showing my skin. The physical aspect of nudity is such a tiny part of my work.
MYP Magazine:
Today, the human body often seems to be abused for pure self-expression, especially in social media. This influences many people’s relationship to their bodies because they believe their value is measured by their looks or fitness. Would you say that your images are a counter-position to this dangerous trend?
Alex Stoddard:
Not consciously. I don’t create my artworks intentionally against the sexualization of the body in the way it’s sold and commodified online. It’s just a lucky byproduct of it. But I do agree. I mean, the explore page on my personal Instagram account is also all about hot people with their shirts off. And to be honest, maybe it’s often exactly what I’m clicking on. It’s an instinct, in all of us, isn’t it?
But I kind of get a little annoyed when people use to water my work down to me being naked, using it as a sexual thing, and thinking that I’m being sexual about it or have a kink of exposing myself online with my photos, where I’m portraying myself or my subjects nude in an almost asexual way a lot of the time. It’s more about showing the natural form than looking attractive or trying to get clicks by showing the naked body. And, in fact, it usually works against me, because my posts are often flagged or taken down because they’re showing a little too much skin for certain platforms.

»People labeled me as different before I even knew that myself.«
MYP Magazine:
You were born and raised in rural Georgia. What memories do you have of your childhood and youth?
Alex Stoddard:
I actually had a really happy childhood, all things considered. I remember spending all of my time outside. I have many brothers and sisters, and my mom would always tell us that we can’t come in until the sun goes down. So we would spend all of our time outside, like in a spa in the forest and going to the rivers. I think a part of what formed my level of comfort in nature is spending so much time in it. Besides that, I had very supportive parents who were extremely encouraging when I started with photography—and they are still my biggest fans.
MYP Magazine:
In the year 1993, when you were born, President Clinton signed “Don’t ask, don’t tell” into law, which prohibited gay or bisexual people from serving openly in the military. How do you remember growing up as a queer kid in rural Georgia?
Alex Stoddard:
I honestly knew that I was different since I was very young, but I couldn’t really put my finger on it until adolescence. That was when being gay became a part of my life, and I just started to feel different and was kind of drawn to different things. In my later teenage years, I became more and more isolated because the environment where I grew up is very conservative and religious. I think people there labeled me as different before I even knew that myself. That made me retreat into my shell a bit more as I didn’t feel like I fit in. And I loved being alone. So it was kind of a perfect storm for just putting me into isolation.

»Going out into nature is like opening a book.«
MYP Magazine:
In the bio text on your website, we read: “Photography became a means of escape, allowing him to construct elaborate scenes and step into the role of different characters through costumes and posing.” What did you want to escape from?
Alex Stoddard:
Well, not so much anything that was happening to me. I wasn’t really bullied or abused in any way, so it wasn’t like a dark escape. It was more of an escape from the mundanity of life. Everyday life inside is depressing, just being connected to your phone, and staring at it all day long; or seeing what’s going on in the news and what tragic events are happening now. Going out into nature is like opening a book. You just forget about your daily life or the stresses and responsibilities that you have.

»I knew that I wouldn’t really have a career if I continued to live where I was.«
MYP Magazine:
Isn’t it counterproductive then to move from the countryside to Los Angeles as you did in 2012? It’s a place known more for traffic jams than for untouched nature.
Alex Stoddard:
A little bit. But I always knew that I had to move away one day because I never really fit into my surroundings there—and even more so for my work. I knew that I wouldn’t really have a career if I continued to live where I was. So, when I was 18, I moved to L.A., which was a week after I graduated from high school. It was actually half for work and half for love because I was in a long-distance relationship back then.
MYP Magazine:
In the countryside, there is usually a different social cohesion between people, and friendships also seem to function differently. How did you acclimate socially in Los Angeles?
Alex Stoddard:
The first weeks there were super overwhelming. I mean, I was coming from a place where there were two lanes, one going this way and one going that way. In L.A., I not only found ten-lane freeways. There are also people everywhere—and there’s almost no nature to escape to, which was always the place where I used to go to meditate or to feel a sense of peace. But socially, it was okay because I was in a relationship with someone who lived there, so I kind of just adopted all of their friends and family. It was like gaining a new set of people. That’s why I wasn’t completely alone. I don’t know if I would have had the courage to do that completely on my own if I didn’t know anyone there at such a young age. But I’m glad that I did. And I think it was necessary to enter a new place and immerse myself in something completely foreign and new. That made me much stronger.

»Adolescence is a time when a lot of different things are happening at once.«
MYP Magazine:
Has moving to Los Angeles changed your desires or artistic focus in any way?
Alex Stoddard: (pauses for a moment)
It’s hard to say if moving there did as much as just growing up because adolescence is a time when a lot of different things are happening at once. You can’t really pinpoint what is informing your creative decisions necessarily, but moving there did. That’s what still makes me want to travel more and seek out these smaller towns where there’s a lot of nature around. Where I live now is very urban. As a result, I no longer feel so comfortable in one place and feel the desire to expand and go outside.
MYP Magazine:
Your earlier works seem to be more bloody and violent. Did you get rid of some demons over time?
Alex Stoddard:
I’ve noticed that myself. I used to call my work dark, but I don’t think I’ve created a lot of dark work in the past couple of years. I think I did work through a lot of that and explored it visually. But now, I’ve put it to bed.
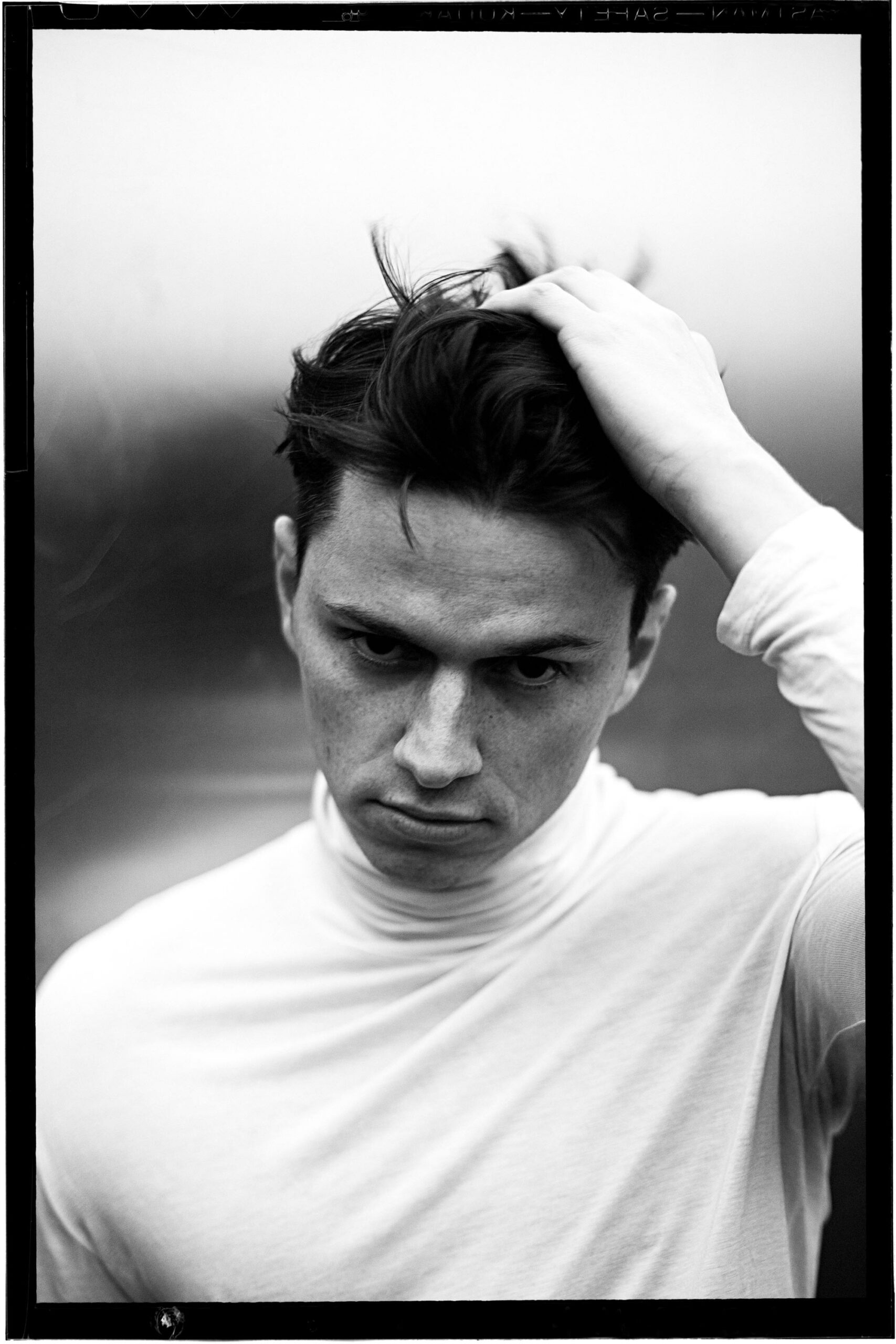
»I really wanted to focus on that very transformative, beautiful, and tumultuous period in my life.«
MYP Magazine:
In your recent INSEX series, you explore the parallels between metamorphosis in the natural world and human coming-of-age. You call it “a colorfully dark world of budding sexuality and crawling insects.” What inspired you to this topic?
Alex Stoddard:
Simply put: I wanted to create something very authentic. That’s why I tried to think back to my adolescence, which was a time in my life when I was feeling emotions the strongest; a time when things felt the most dramatic and emotional. I really wanted to focus on that very transformative, beautiful, and tumultuous period in my life, which encapsulated so many different emotions. I thought that would be a very good starting point for drawing visual ideas.
Interestingly, in my teenage years, I already created some photographic works that were about the topic of metamorphosis. When I was going back through some of my older work, I stopped on these because they really struck me. Then I thought about how I could expand on this world visually. That’s where the idea slowly started to come together. In this context, I must emphasize that I shot the INSEX series over about five years. I really took my time crafting this world and all its different parts I wanted to tell. When you look at the images, they also photographically play into the idea of transformation and change because I also went through a few different visual styles that I was interested in.

»Most languages are not really designed to include new gender identities.«
MYP Magazine:
In February 2022, we met director Jamie Sisley and actor Wyatt Oleff for an interview about their film “Stay Awake.” The movie tells the story of two teenage brothers in rural America who must deal with the prescription drug addiction of their mother. One of the main characters is played by Finn Argus, a person who is also featured in some of your INSEX artworks. When and how did you guys meet? What connects and unites you?
Alex Stoddard:
I met Finn the same way that I meet a lot of people that I work with: just through Instagram. That’s the beauty of social media – you can connect so easily with people. I reached out to Finn because, on the one hand, I was drawn to their appearance. I think they have a very painterly, almost angelic look that I love to photograph. And on the other hand, I loved what they were doing work-wise, including the way they’re embracing their identity of being non-binary and also being very vocal about that online.
MYP Magazine:
It is fortunate that the English language has the word “they” for people who don’t identify as “he” or “she.” Such a word does not exist in this form in the German language.
Alex Stoddard:
Most languages are not designed to include new gender identities.
MYP Magazine:
Are these identities actually new? Or are people just revealing their identities more often than in the past?
Alex Stoddard:
Yeah, good point.


»In America, the loudest voices are also the most extreme ones.«
MYP Magazine:
The United States seem to be in the midst of a culture clash with representatives of the “Don’t say gay” campaign in one corner and the demands of socio-political progress in the other. What are your concerns and hopes for the future of your country? Would you say that your work can build a bridge for conservatives to playfully approach more progressive ideas?
Alex Stoddard:
I’ve experienced that, when it comes to that discussion, most people are positioned more in the middle. I think you just hear so much about it because the two extremes are so vocal that it seems like that this is it. But I feel that in America, most people are kind of left-leaning middle. The loudest voices are also the most extreme ones. That gives us this false impression that there’s this tumultuous battle going on.
When it comes to my work, I think it’s not something that I necessarily strive to do or consciously think about, but maybe it’s a tiny piece of showing a person – who identifies as male – in situations that are not necessarily masculine or traditional. I think I mostly just create from what feels authentic to me, and I try to leave outside influences out of it.

»I’d like to explore how my worlds can be displayed in moving pictures.«
MYP Magazine:
More than 12 years ago, on April 25, 2010, you posted your very first photo on Flickr. It shows you with a Nikon camera in your hand, your face and one arm are all covered with tape. In the caption, you say: “I decided to take up a 365. Guess I’ll be attached to this camera for a while.”
Alex Stoddard: (smiles)
Little did I know I was predicting my future.
MYP Magazine:
What prediction would you make today in terms of your life and work if you were looking another twelve years into the future?
Alex Stoddard:
It’s hard to say. I think photography will be with me for the rest of my life. It’s something that has almost come to define a part of my identity in a way, but I’d like to expand beyond just being a photographer and explore more of myself as an artist in general. That also means exploring different mediums than photography. I think film will probably play a role in that. I’d like to explore how my worlds can be displayed in moving pictures rather than just still images and what that would look like. But overall, I hope to just continue to live in the same way. I have a very free and authentic life; I live according to what makes me happy. I don’t feel the need to follow any particular path, I just follow what I’m passionate about and what makes me happy. And when something stops making me happy, bringing me joy, or making me feel fulfilled, I have the freedom to go and change my situation.
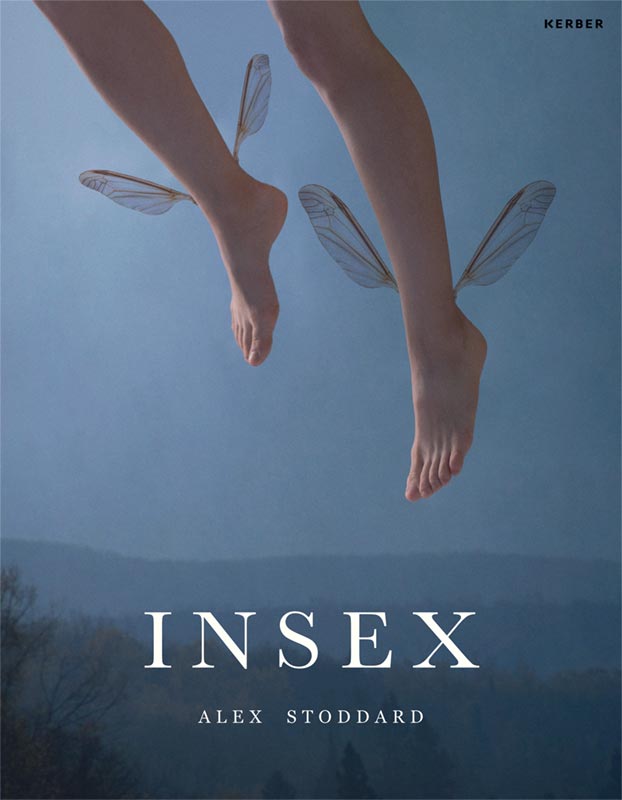
INSEX by Alex Stoddard:
Hardcover. 128 pages. 9.5 x 12 inches.
Published by Kerber Verlag and printed in Germany.
Available on alexstoddard.com/insex or at Kerber Verlag.
More about Alex Stoddard:
Photography by Osman Balkan:
Interview & text by Jonas Meyer:
Text editing by Caroline Tyka:
Aaron Hilmer
Interview — Aaron Hilmer
»Ich hatte den Anspruch, in den richtigen Momenten messerscharf zu werden«
Mit der Serie »Luden« lässt Amazon die wilden und vor allem brutalen Achtziger auf der Reeperbahn wiederaufleben. Im Mittelpunkt des opulenten Sechsteilers steht der junge Zuhälter Klaus Barkowsky, der sich im Milieu Stück für Stück nach oben kämpft. Gespielt wird Lude Klaus vom 23-jährigen Aaron Hilmer, der gerade auch im vielfach ausgezeichneten Kriegsdrama »Im Westen nichts Neues« zu sehen ist. Ein Interview über seltsam charmante Zuhälter, Gewalt gegen Frauen und eine ehemalige Kiezgröße, die heute auf St. Pauli vor allem durch Volksverhetzung auffällt.
2. März 2023 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

Prostituierte, Koks und schnelle Autos, dazu viel Elend, Gewalt und Bling-Bling: Die sechsteilige Serie „Luden“, die ab dem 3. März beim Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen ist, hat sich nichts Geringeres vorgenommen, als die 1980er Jahre auf der Reeperbahn wiederaufleben zu lassen – jenes Jahrzehnt, das zumindest für diejenigen ein goldenes war, deren Geschäftsmodell auf der sexuellen Ausbeutung von Frauen beruhte. Und auf allem, was man sonst noch so verkaufen konnte.
Mittendrin in diesem Mikrokosmos steht der anfangs unscheinbare Klaus Barkowsky. Der junge Mann ist es leid, sein Leben hinter der Theke einer schmuddeligen Kneipe auf St. Pauli zu fristen. Klaus träumt von einem Leben à la „erste Klasse Jumbojet“, dazu hat er ein ausgeprägtes Interesse am anderen Geschlecht – sexuell, versteht sich. Die Idee, ins Luden-Business einzusteigen und ein wenig bei den Etablierten mitzumischen, drängt sich daher geradezu auf.
Doch die Granden der Hamburger Zuhälterei geben nur ungern ein Stück ab von ihrem großen Kuchen. Und so muss sich Klaus seinen Weg nach oben boxen – oder besser gesagt: boxen lassen. Denn um ihn herum hat sich eine eingeschworene Crew aus Gleichaltrigen gebildet, die gerne mal die Fäuste schwingen. Auf diese Weise erkämpft sich die junge „Nutella-Bande“ peu à peu einen festen Platz am Ludentisch.
Auch wenn „Luden“ kein Biopic sein will, ist die Serie doch inspiriert von realen Personen, Ereignissen und Umständen. So gab es beispielsweise tatsächlich einen Zuhälter namens Klaus Barkowsky, dem seine langen blonden Haare und sein italienischer Supersportwagen die Spitznamen „der schöne Klaus“ und „Lamborghini-Klaus“ einbrachten. Zu seinen besten Zeiten machte er bis zu 10.000 Mark am Tag. Heute ist Barkowsky, Jahrgang 1953, im Ruhestand, versucht sich in abstrakter Malerei und lebt nach eigenen Angaben von einer Mini-Rente und Grundsicherung. Das jedenfalls gab er im Januar 2022 vor dem Hamburger Amtsgericht zu Protokoll, vor dem er sich verantworten musste, nachdem er auf St. Pauli zweimal den Hitlergruß gezeigt und dabei einmal „Sieg Heil!“ gerufen hatte.
Doch kommen wir zu Erbaulicherem, denn gespielt wird der fiktionale Klaus Barkowsky von Aaron Hilmer. Der 23-jährige, der in Hamburg lebt und aufgewachsen ist, bringt neben fundierten Orts- und einigen Dialektkenntnissen auch eine nicht unerhebliche Berufserfahrung mit. Bereits seit 2011 ist er im Geschäft, zu sehen war er etwa in den Kinofilmen „Einsamkeit und Sex und Mitleid“, „Schrotten!“ und „Das schönste Mädchen der Welt“, außerdem im ZDF-Dreiteiler „Preis der Freiheit“ und in der Netflix-Dramedy-Serie „Das letzte Wort“ mit Anke Engelke.
Und spätestens seit „Im Westen nichts Neues“ von Edward Berger auf Netflix und im Kino läuft, gehört Aarons Gesicht fest zur deutschen Film- und Fernsehlandschaft. In dem vielfach ausgezeichneten Kriegsdrama spielt er an der Seite von Hauptdarsteller Felix Kammerer den jungen Soldaten Albert Kropp: Nach anfänglicher Euphorie erleben die beiden Männer am eigenen Leib die Katastrophe des Ersten Weltkriegs.
Im Studio unseres Fotografen Maximilian König, das nur wenige Meter entfernt von der Justizvollzugsanstalt Moabit liegt, haben wir Aaron Hilmer alias Lude Klaus zum Gespräch und Fotoshooting getroffen.

»Auf der Reeperbahn haben schon immer Menschen eine Zuflucht gesucht, die von der Mehrheitsgesellschaft ausgestoßen wurden.«
MYP Magazine:
„Luden“ ist eine Serie, die die 1980er Jahre auf St. Pauli wiederaufleben lässt und von realen Personen und Ereignissen inspiriert ist. Was macht den Stoff aus Deiner Sicht für die heutige Zeit so erzählenswert?
Aaron Hilmer:
St. Pauli ist ein ganz besonderer Ort, der weitaus mehr Facetten hat als Rotlicht, Sexarbeit und Zuhälterei. Auf der Reeperbahn haben schon immer Menschen eine Zuflucht gesucht, die von der Mehrheitsgesellschaft ausgestoßen wurden. Aber man trifft dort nicht nur Misfits. Auf St. Pauli sind auch mindestens genauso viele Gutbürgerliche unterwegs, die sich einfach nur in der Kneipe einen an die Backe labern wollen. Das macht den Kiez in gewisser Weise klassenlos. Außerdem gibt es auf St. Pauli einen großen Lokalpatriotismus, die Leute unterstützen sich gegenseitig und halten zusammen. Unserer Serie ist es gelungen, dieses ganz besondere Gemisch aus abgedrehten Persönlichkeiten und tragischen Schicksalen authentisch einzufangen und spannend zu erzählen.
MYP Magazine:
Was hat Dich als Schauspieler daran gereizt, in die Haut des Zuhälters Klaus Barkowsky zu schlüpfen – eine Figur, die an den tatsächlichen „schönen Klaus“ angelehnt ist?
Aaron Hilmer:
Klaus Barkowsky sah in den Achtzigern wirklich eindrucksvoll aus, er wurde nicht ohne Grund „der schöne Klaus“ genannt. Dass man da beim Casting gerade auf mich kommen würde, hätte ich nicht erwartet. (lacht) Da dieser Charakter nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich maximal weit von mir entfernt ist, klang das für mich von Anfang an nach einer großen schauspielerischen Aufgabe. Das hat mich enorm gereizt. Davon abgesehen spielt die ganze Story quasi vor meiner Haustür.

»Mir war es wichtig, diesen Charakter so harmlos und verlockend wie möglich darzustellen.«
MYP Magazine:
In „Luden“ stellst Du deinen Klaus als eine Figur dar, der man als Zuschauer:in gerne folgt, weil sie durchaus sympathisch wirkt. Daneben gibt es immer wieder Situationen, in denen man mit diesem Charakter fremdelt und sich von ihm abwenden möchte. Denn im Leben von Zuhälter Klaus ist es völlig legitim, Frauen als Ware zu behandeln und sie für seine eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Das gelingt ihm nicht nur mit blumigen Worten und Geschenken, sondern auch mit Gewalt, wenn es sein muss. Wie bist Du mit dieser Ambivalenz der Figur umgegangen?
Aaron Hilmer:
Mir war es wichtig, diesen Charakter so harmlos und verlockend wie möglich darzustellen – mit all seiner Tollpatschigkeit und dem Charme, den er versprüht. Gleichzeitig hatte ich den Anspruch, in den richtigen Momenten messerscharf zu werden und die Abgründe seiner Persönlichkeit sichtbar zu machen. Hätte ich Klaus von Anfang an nur als bösen Mann verkörpert, könnten es die Zuschauer:innen überhaupt nicht nachvollziehen, warum ihm die Frauen in Scharen verfallen und für ihn anschaffen gehen. Diese Ambivalenz zu zeigen, war in meinem Spiel ein permanenter Seiltanz.

»Klaus ist ein Mann, der seinen eigenen Lügen glaubt.«
MYP Magazine:
In der Serie verhält sich so gut wie keine Figur moralisch vorbildlich. Dennoch ertappt man sich als Zuschauer:in immer wieder dabei, dass man für viele dieser Leute eine gewisse Empathie aufbaut, da sie wie Klaus auch über einige positive Charaktereigenschaften verfügen. Am Ende glaubt man sogar, den fiesen Zuhälter Beetle emotional zu verstehen…
Aaron Hilmer:
Und genau das ist das Gefährliche an diesen Menschen! Im einen Moment klopfen sie noch flotte Sprüche und wickeln die Frauen mit ihrem Charme um den Finger. Und im anderen Moment lassen sie die Maske fallen, zeigen ihre wahren Absichten und treten mit aller Härte und Verrohung auf. Dieses ständige Hin und Her hat es mir auch so schwer gemacht, meine eigene Figur wirklich greifen zu können. Klaus ist ein Mann, der seinen eigenen Lügen glaubt. Das macht ihn so unberechenbar und gefährlich.


»Man darf nichts beschönigen, wenn man eine authentische Geschichte über Zuhälterei erzählen will.«
MYP Magazine:
Einer der Momente, in denen Klaus‘ vordergründiger Charme demaskiert wird, ist eine Szene, in der er einer seiner Prostituierten mit Gewalt die Jacke vom Leib reißt – sie hatte sich erdreistet, das Stück von ihrem eigenen Lohn und ohne seine Erlaubnis zu kaufen. Ohnehin ist die Darstellung von Gewalt, vor allem gegen Frauen, in „Luden“ allgegenwärtig. Welche Gespräche habt Ihr Darsteller:innen dazu im Vorfeld mit Regie, Drehbuch und Produktion geführt? Warum ist es aus Deiner Sicht in der heutigen Zeit filmisch notwendig, die physische Gewalt so explizit darzustellen?
Aaron Hilmer:
Für uns alle – von der Regie bis zum Cast – war es konstant ein Thema, wie wir vor der Kamera mit diesen körperlichen Übergriffen umgehen. Denn selbstverständlich wollen wir die Gewalt gegen Frauen weder verharmlosen noch in irgendeiner Form legitimieren. Gleichzeitig darf man aber auch nichts beschönigen, wenn man eine authentische Geschichte über Zuhälterei erzählen will. Und die war vor allem in den 1980ern auf St. Pauli überaus dreckig, gewalttätig und komplex. Aus diesem Grund gab es im Vorfeld der Produktion ein sogenanntes Intimacy Coaching. Dort haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir am Set für alle Schauspieler:innen einen sicheren Raum herstellen können, der uns ermöglicht, die entsprechenden Szenen verantwortungsvoll darzustellen.

»In den meisten Fällen ist es eine große Lüge, wenn Menschen behaupten, sie würden niemals so einen Ort betreten.«
MYP Magazine:
Rotlichtviertel wie das auf St. Pauli gelten für viele nach wie vor als Schmuddelecken, die man als anständige:r Bürger:in zu meiden hat. Dabei scheinen die zwischenmenschlichen Dynamiken auf dem Kiez keine anderen zu sein wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen.
Aaron Hilmer:
Ach, in den meisten Fällen ist es doch eine große Lüge, wenn Menschen behaupten, sie würden niemals so einen Ort betreten – vor allem die, die immer so anständig tun. Dieses Thema streifen wir inhaltlich auch in unserer Serie. Auf dem Kiez tummeln sich genauso viele Leute aus der Politik, Wirtschaft und feinen Gesellschaft wie die, die dort ihr Geld verdienen oder sogar leben. Beiden Welten bedingen sich gegenseitig und ziehen einen gewissen Nutzen voneinander. Und ich glaube, die Grenzen sind da fließend.

»Wenn man in den Achtzigern auf dem Kiez bestehen wollte, brauchte man viele schräge Sprüche.«
MYP Magazine:
Auch wenn sich Hamburg als Tor zur Welt versteht und die Menschen auf der Reeperbahn nicht diverser sein könnten, wirkt das Milieu, das Ihr in der Serie beschreibt, eher provinziell als international. Das liegt einerseits am teils dilettantischen Auftreten der einzelnen Figuren und dem Mikrokosmos, in dem sich alles abspielt, aber auch an dem breiten Hamburger Dialekt, den fast alle Figuren sprechen. War das für Dich als waschechten Hamburger auch sprachlich ein Heimspiel?
Aaron Hilmer:
Insgesamt hat es mir schon sehr geholfen, Hamburger zu sein. Dadurch war mir zum Beispiel von Anfang an klar, dass ich den Dialekt in der Figur unbedingt sprechen muss. Aus diesem Grund habe ich schon bei meinem allerersten Casting ein wenig Dialekt in mein Spiel einfließen lassen. Während der Dreharbeiten wurde dieser Dialekt dann in meiner Darstellung zum Selbstläufer. Klaus‘ Sprache ist sehr verspielt, dadurch konnte ich in der Rolle alle möglichen Wörter kombinieren und daraus viele schräge Sprüche formen. Die brauchte man nicht nur in den Achtzigern, wenn man auf dem Kiez bestehen wollte, sondern auch heute noch. Das erlebe ich selbst immer wieder, wenn ich mal in einer der urigen Kneipen auf St. Pauli bin.

»Ich hatte schon immer sehr starke Sensoren für Diskriminierungen aller Art.«
MYP Magazine:
Auf St. Pauli geht es immer wieder darum, „sich gerade zu machen“, was für Klaus bedeutet, sich seinen Platz auf dem Kiez zu erkämpfen und diesen zu verteidigen. Was bedeutet dieser Ausdruck für Dich persönlich?
Aaron Hilmer:
Ich hatte schon immer sehr starke Sensoren für Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen aller Art, insbesondere für Rassismus. Wenn ich sehe, dass in meiner Gegenwart ein Mensch falsch behandelt wird, heißt „gerade machen“ für mich, in die Situation einzugreifen und dem Opfer zu helfen.
MYP Magazine:
Auch in „Luden“ werden Themen wie Rassismus, Homophobie, Transfeindlichkeit oder Angst vor Aidskranken angeschnitten. Vieles davon wirkt heutzutage noch seltsam aktuell. Hättest Du dir gewünscht, dass diese Themen in der Serie ausführlicher behandelt werden, auch mit Blick auf die gesellschaftlichen Diskussionen der letzten Jahre in Bezug auf #MeToo oder #ActOut?
Aaron Hilmer:
Zuerst einmal bin ich froh, dass diese Themen überhaupt ihren Weg in eine Serie wie „Luden“ gefunden haben und dort sogar als inhaltliche Grundbausteine fungieren. Klar, rein persönlich freut es mich immer, wenn solchen Themen in einem fiktionalen Format mehr Raum gegeben wird – das beziehe ich nicht nur auf unsere Serie. Allerdings muss man aufpassen, dass man im Erzählstrang über sechs Episoden nicht zu viele Nebenbaustellen aufmacht. Aber so haben wir für eine eventuelle Fortsetzung der Serie noch ein paar inhaltliche Potenziale. (grinst)

»Wenn auf St. Pauli einer regelmäßig mit einem Lamborghini herumgefahren ist, kann man sich vorstellen, wie die Leute so einen Typ wahrgenommen haben müssen.«
MYP Magazine:
Der echte Klaus Barkowsky war mit 15 Jahren zum ersten Mal auf der Reeperbahn. Dort arbeitete er sich sukzessive nach oben, bis er in den 1980er Jahren zu einem der einflussreichsten Zuhälter auf St. Pauli wurde. Wie hat diese reale Persönlichkeit die Anlage Deiner Rolle beeinflusst? Bist Du ihm mal begegnet?
Aaron Hilmer:
Nein, wir haben uns nie persönlich getroffen, sondern nur mal kurz telefoniert. Unsere Serie ist ja auch kein Biopic des realen Klaus Barkowsky, es handelt sich hier um eine rein fiktive Figur. Trotzdem habe ich mich in meinem Spiel ein Stück weit an der realen Person orientiert und viele alte Bilder gesichtet, die das Aufgeblasene der damaligen Zeit wirklich greifbar machen. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Videoausschnitt, in dem zu sehen ist, wie der echte Klaus Barkowsky auf dem Kiez in seinen Lamborghini steigt und einen kurzen Blick in die Kamera wirft. Das sind zwar nur fünf Sekunden, aber an solchen Elementen habe ich mich in der Vorbereitung immer wieder bedient.
Übrigens: St. Pauli war schon immer eine wahnsinnig arme Gegend. Wenn dort einer regelmäßig mit einem Lamborghini herumgefahren ist, kann man sich vorstellen, wie die Leute so einen Typ wahrgenommen haben müssen.


»Das tatsächliche Ausmaß der körperlichen Gewalt auf dem Kiez kannte ich bis dahin aus keiner anderen Quelle.«
MYP Magazine:
Gab es andere Zeitzeug:innen, mit denen Du dich über die damalige Zeit austauschen konntest?
Aaron Hilmer:
Ich habe mich unter anderem mit Waldemar Paulsen getroffen, einem pensionierten Polizist, der als Zivilfahnder „Rotfuchs“ zehn Jahre lang auf St. Pauli im Einsatz war. Herr Paulsen hatte mich im Sommer 2021 eingeladen, mit ihm einen Tag auf St. Pauli zu verbringen. Wie die meisten Menschen, die dort leben und arbeiten, liebt er diesen Kiez. Gleichzeitig hasst er die Gewalt an Sexarbeiter:innen, mit der er zu seiner aktiven Zeit als Polizist täglich konfrontiert war. Trotzdem betont er immer wieder, dass er im Dienst nicht gegen das Konzept der Sexarbeit per se gekämpft habe, sondern gegen die Kriminalität, die in diesem Umfeld stattgefunden habe. Zu unserem Treffen brachte er einen dicken Ordner mit, in dem er unzählige Fotos von physisch missbrauchten Frauen abgeheftet hatte. Zu jedem einzelnen Bild konnte Herr Paulsen eine Geschichte erzählen. Das war einerseits erschreckend, andererseits aber auch wichtig, denn das tatsächliche Ausmaß der körperlichen Gewalt auf dem Kiez, das er über all die Jahre in dem Ordner dokumentiert hatte, kannte ich bis dahin aus keiner anderen Quelle.

»Wer auf dem Kiez den Hitlergruß zeigt, hat wirklich einiges nicht verstanden.«
MYP Magazine:
Kommen wir ein letztes Mal zurück auf den realen Klaus Barkowsky. Im Januar 2022 wurde der „schöne Klaus“ vom Hamburger Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er im Jahr zuvor mehrfach vor Passanten den Hitlergruß gezeigt und einmal sogar „Sieg Heil!“ gerufen hatte. Würdest Du Herrn Barkowsky empfehlen, sich mal „Im Westen nichts Neues“ anzuschauen?
Aaron Hilmer:
Das sollte er dringend. Und überhaupt: Wer auf dem Kiez den Hitlergruß zeigt, hat wirklich einiges nicht verstanden. Diese Ideologie könnte nicht weiter von St. Pauli entfernt sein. In was für einer komischen, verschobenen Welt muss dieser Mensch nur leben?
MYP Magazine:
„Im Westen nichts Neues“ hat gerade bei den BAFTA-Awards sieben Auszeichnungen abgeräumt und geht bei den Oscarverleihungen am 12. März mit neun Nominierungen an den Start. Hat der Film Dein Wertesystem in irgendeiner Weise beeinflusst?
Aaron Hilmer:
„Im Westen nichts Neues“ ist ein wahnsinnig wichtiger Film. Er zeigt mehr als deutlich, dass Krieg nicht die Antwort ist, weder vor hundert Jahren noch heute. Ich bezeichne mich selbst als Pazifist, daher hat der Film mein Wertesystem eher bestärkt als verändert.

»Wenn man mit einer fiktionalen Figur den Schrecken des Krieges durchlebt, ist es erschütternd, wenn die Fiktion plötzlich von der Realität überholt wird.«
MYP Magazine:
Die Dreharbeiten zu „Im Westen nichts Neues“ fanden zwischen März und Mai 2021 statt. Nur neun Monate später wurde mitten in Europa durch den Angriff Russlands auf die Ukraine ein brutaler und sinnloser Angriffskrieg entfesselt, für den unzählige junge Männer rekrutiert und an die Front geschickt werden – Männer wie Deine Figur Albert Kropp. Welche Gefühle haben diese realen Kriegsereignisse des Jahres 2022 in Dir ausgelöst?
Aaron Hilmer:
Die grausamen Ereignisse in der Ukraine haben mich tief getroffen. Im Film stelle ich den jungen Soldaten Albert auf seiner gesamten Reise dar – von der anfänglichen Kriegseuphorie über die Konfrontation mit der Realität im Schützengraben bis zu seinem grausamen Tod durch einem Flammenwerfer. Wenn man eine fiktionale Figur über eine so eine lange Zeit begleitet und mit ihr den Schrecken des Krieges durchlebt, ist es erschütternd, wenn die Fiktion plötzlich von der Realität überholt wird. Dabei ist das bei weitem nicht die einzige Krise, mit der wir konfrontiert sind – ich denke da zum Beispiel an die drohende Klimakatastrophe. Oder die Gefährdung der Demokratien auf der Welt. Ich habe oft das Gefühl, dass das alles ein bisschen viel zu ertragen ist für uns junge Menschen.

»Am Ende war ich nur noch Haut und Knochen, körperlich wie seelisch.«
MYP Magazine:
Im April 2021 – fast zeitgleich zur Produktion von „Im Westen nichts Neues“ – starteten auch die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der ZDF-Katastrophenserie Sløborn, in der Du in der Rolle des Devid zu sehen bist. Nur wenige Monate später ging es mit dem Dreh von „Luden“ los. Wie bist Du in der Zeit mit diesem enormen schauspielerischen Pensum umgegangen?
Aaron Hilmer:
Das Jahr 2021 hat mich ziemlich mitgenommen – nicht nur wegen dieser drei kräftezehrenden Produktionen. Etwa vier Wochen nachdem „Luden“ abgedreht war, habe ich die Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen erhalten. Das hat mir den Rest gegeben, am Ende war ich nur noch Haut und Knochen, körperlich wie seelisch.
Gleichzeitig ist es mir recht gut gelungen, die einzelnen Rollen nach den jeweiligen Drehs wieder abzulegen. Das lag insbesondere daran, dass ich Charaktere gespielt habe, die weit von dem entfernt sind, wie ich persönlich denke und fühle. Mein Klaus in „Luden“ zum Beispiel ist ein Typ, der in seiner Sprache, seiner Körperlichkeit, aber auch in seinen Wertvorstellungen der 1980er Jahre so gar nichts mit meinem eigenen Leben im Hier und Jetzt zu tun hat. Das macht es wesentlich einfacher, da schnell wieder herauszuschlüpfen. Außerdem hatte ich mit Frank Betzelt einen sehr guten Schauspielcoach an meiner Seite, der mir einige Übungen mit auf den Weg gegeben hat, wie ich nach so einem Drehtag als Zuhälter wieder einmal kurz zu mir selbst kommen kann.

»Dieses Pingpong-Spiel darf gerne so weitergehen.«
MYP Magazine:
„Luden“ startet am 3. März auf Amazon Prime Video, „Im Westen nichts Neues“ läuft bereits seit einigen Monaten auf Netflix und im Kino. Was sind Deine nächsten Rollen, in denen Du auf dem Bildschirm oder der Leinwand zu sehen sein wirst?
Aaron Hilmer:
In wenigen Wochen beginnt der Dreh zur dritten Staffel von Sløborn. Was danach kommt, weiß ich noch nicht. Ich hätte große Lust, wieder etwas komplett anderes zu spielen. Mein Albert Kropp in „Im Westen nichts Neues“ und mein Klaus Barkowsky in „Luden“ waren bereits zwei sehr gegensätzliche Figuren, dieses Pingpong-Spiel darf gerne so weitergehen.

»Luden – Könige der Reeperbahn«
Ab Freitag, 3. März 2023, auf Amazon Prime Video
Regie: Laura Lackmann, Stefan Lukacs
Mehr von und über Aaron Hilmer:
Fotografie: Maximilian König
Interview und Text: Jonas Meyer
Saïd Sankofa
Interview — Saïd Sankofa
»Beim Breaken ist es egal, woher man kommt«
Wenn Breakdance bei den Olympischen Spielen 2024 zum ersten Mal überhaupt als sportliche Disziplin geführt wird, könnte Deutschland vom jungen Tänzer Saïd Sankofa vertreten werden. Sollte sich der gebürtige Münchener für die Teilnahme qualifizieren, ginge es ihm aber gar nicht so sehr um eine Medaille. Viel wichtiger ist es ihm, den Menschen ganz allgemein die Kultur des Breakens näherzubringen – und gleichzeitig auf die dramatische Lage der Uiguren in China aufmerksam zu machen. Dieses Anliegen ist ein ganz persönliches, denn Saïds Familie musste bereits in den Neunzigern aus Xinjiang nach Deutschland fliehen.
26. Januar 2023 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

Fernsehen bildet – zumindest gelegentlich. Und manchmal sogar am späten Abend. Wie etwa am 11. Oktober 2022, als das ZDF um 22:15 Uhr in seiner Reportagereihe „37 Grad“ den Beitrag „Mein Tanz, mein Battle“ zeigte. Untertitel: „Mit Breakdance Geschichte schreiben“. In einem sehr persönlichen Portrait wurden dort die 23-jährige Joanna aus Dresden und der 25-jährige Serhat aus München vorgestellt, für die Breakdance nicht weniger bedeutet als ihr Leben.
Für manche mag das vielleicht niedlich klingen, vor allem, wenn sie mit dem Tanzstil, der in den 1970er Jahren in New York erfunden wurde und sich seitdem als Grundelement der Hip-Hop-Kultur begreift, wenig bis gar nichts anfangen können. Doch Breakdance ist für Joanna, Serhat und viele andere weit mehr als ein Hobby: Breaken ist eine Lebenseinstellung, eine Kultur – und ab 2024 auch eine olympische Disziplin. Sollte er sich qualifizieren, könnte Serhat, der bereits vor zwölf Jahren in den Bundeskader aufgenommen wurde, bei den Sommerspielen in Paris offiziell für Deutschland antreten – und im besten Fall um die Goldmedaille kämpfen.
Doch um buntes Edelmetall, das man sich um den Hals hängen kann, geht es dem überaus bescheiden und warmherzig wirkenden jungen Mann gar nicht. Das wird nicht nur in der ZDF-Reportage klar, sondern auch während unseres Interviews vor wenigen Wochen in Berlin. Serhat, den man in der Breakdance-Szene eher unter dem Künstlernamen Saïd Sankofa kennt, wird von der Idee getrieben, den Menschen diese so besondere, diverse, weltoffene und inklusive Kultur näherzubringen, die er bereits als Kind für sich entdecken durfte.
Daneben hat Serhat alias Saïd noch ein weiteres Anliegen – und zwar ein überaus persönliches. Der gebürtige Münchener hat uigurische Wurzeln, seine Familie stammt aus der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas. Da sein Vater als Journalist seit Jahrzehnten über die Kultur und Rechte der Uiguren schreibt und deshalb ins Visier der chinesischen Behörden geriet, floh die Familie im Jahr 1996 über Kasachstan nach Deutschland. Aus diesem Grund nutzt Saïd den Breakdance auch als Bühne, um mehr Sichtbarkeit für die die reichhaltige Kultur seines Volkes herzustellen und die Aufmerksamkeit seines Publikums verstärkt auf die aktuellen Auslöschungsversuche durch die chinesische Regierung zu lenken.

»Lerne aus der Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Und vergiss nie, wo deine Wurzeln liegen.«
MYP Magazine:
Saïd, Du bist Teil der sogenannten Sankofa-Crew. Was steckt hinter diesem Namen?
Saïd:
Die Idee dazu hatte mein bester Freund Michael, der auch eines der Gründungsmitglieder unserer Crew ist. Seine Familie gehört den Ashanti an, einer ethnischen Gruppe in Ghana. In der Kultur der Ashanti gibt es verschiedene Philosophien, denen jeweils ein Begriff und ein Zeichen zugeordnet sind. Sankofa ist eine dieser Philosophien, im Prinzip gibt es in ihr zwei Kernbotschaften. Erstens: Lerne aus der Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Und zweitens: Vergiss nie, mit wem du angefangen hast und wo deine Wurzeln liegen.
Das Zeichen der Sankofa-Philosophie ist ein zurückschauender Vogel, vor dem ein Ei liegt. Dieses Ei symbolisiert den Beginn seiner Reise und steht dafür, dass man im Leben immer wieder in die Vergangenheit schauen sollte, um daraus Erkenntnisse zu entnehmen, mit denen sich die eigene Zukunft besser gestalten lässt.
MYP Magazine:
Wie habt Ihr euch gefunden und formiert?
Saïd:
Eher zufällig – als kleine Knirpse im „Kinderzirkus JoJo“. Das ist ein soziales Projekt, das im Münchener Stadtteil Kieferngarten kostenlose Workshops für Kinder aus einkommensschwachen Familien anbietet, die unterschiedlichste kulturelle Backgrounds haben. Man kann dort etwa Jonglage, Clown Acting oder Breakdance lernen. Am Anfang, im Jahr 2007, waren wir fünf, sechs Jungs. Die restlichen Mitglieder kamen später in unserem Jugendzentrum dazu.

»Der Wechsel zum Namen Saïd war für mich ein Schritt in Richtung Erwachsenwerden.«
MYP Magazine:
Wie und wann ist Dein Künstlername Saïd entstanden?
Saïd:
Diesen Namen habe ich mir selbst vor etwa sechs Jahren gegeben. Davor kannte mich jeder nur unter Halo The Kid, so hatte mich immer ein Älterer aus dem Jugendzentrum genannt. „Halo“ steht für den Move, den ich als Kind und Jugendlicher am besten konnte und der meinem Tanz etwas sehr Markantes gegeben hat. Aber im Laufe der Jahre hatte ich zunehmend das Gefühl, dass mich der Name eher einengt, da er mich immer nur auf diesen einen Move beschränkt. Daher war für mich der Wechsel zu Saïd auch ein Schritt in Richtung Erwachsenwerden.

»Beim Breaken ist es völlig egal, woher man kommt, wie man aussieht, wen man liebt oder wie alt man ist.«
MYP Magazine:
In der ZDF-Reportage erzählst Du unter anderem, dass die ersten zehn Jahre im Breakdance äußerst schwierig für Dich waren, da Du auf Battles nur verloren hast. Was hat Dich all die Jahre motiviert, trotzdem dabeizubleiben?
Saïd:
Breaken ist nicht nur ein Sport, der sich allein auf die körperliche Aktivität beschränkt. Dahinter steckt eine ganze Kultur! Diese Kultur fand ich schon als Kind wahnsinnig aufregend, vielfältig und inspirierend – auch, weil es beim Breaken völlig egal ist, woher man kommt, wie man aussieht, wen man liebt oder wie alt man ist. Ich wurde in dieser Community schon immer ernst genommen, auch wenn ich es als Teenager oft mit wesentlich älteren Breakern zu tun hatte. Dieses Umfeld hat es mir von Anfang an ermöglicht, megaviel aufzuschnappen und zu lernen – nicht nur fürs Breaken, sondern auch fürs Leben. Außerdem habe ich es einfach geliebt zu tanzen. Ab dem ersten Moment im Dance-Workshop des Kinderzirkus war mir klar, dass das etwas ist, wofür ich unendlich viel Energie habe. Etwas, das ich kontinuierlich üben will, um darin immer besser zu werden. So habe ich mich in kürzester Zeit ins Breaken verbissen – das hält bis heute an.

»Endlich gibt es mal ein ansehnliches Video, das die jungen Breaker ihren Eltern zeigen können.«
MYP Magazine:
Wie hat Dein Umfeld auf den TV-Beitrag reagiert?
Saïd:
Die Reaktionen der Menschen waren sehr, sehr positiv. Besonders gerührt hat mich das Feedback vieler Jüngerer aus der Breakdance-Szene – nicht nur aus der Münchener Community, sondern aus ganz Deutschland. Ich habe erfahren, dass sich die Kids durch die Doku sehr inspiriert und motiviert fühlten. So ein Feedback bedeutet mir alles, auch weil es mir wichtig ist, die Szene am Leben zu halten.
Davon abgesehen gibt es mit dieser Doku auch endlich mal ein ansehnliches Video, das die jungen Breaker ihren Eltern zeigen können – vor allem, wenn sie wieder mal gefragt werden, wer eigentlich dieser Saïd ist, mit dem sie so viel Zeit verbringen. Meiner Mutter hat diese Doku ebenfalls viel bedeutet, sie war damit überglücklich. Und die uigurische Community fand es großartig, dass ich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch über deren Anliegen gesprochen habe.

»Das Thema Olympia wird innerhalb der Community sehr kontrovers diskutiert.«
MYP Magazine:
Breakdance wird 2024 zum ersten Mal überhaupt eine olympische Disziplin sein. Was bedeutet das für die Breakdance-Kultur als solche?
Saïd:
Das Thema Olympia wird innerhalb der Community sehr kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite gibt es Leute, die Breakdance als eine Kunstform begreifen, aus der sich im Laufe der Jahrzehnte eine eigene Kultur entwickelt hat. Sie glauben, dass die olympischen Spiele dieser Kultur einen großen Schaden zufügen werden. Ihr Argument ist, dass neue Generationen von Breakern in Zukunft nur noch so trainieren würden, wie es dem Bewertungssystem der olympischen Spiele entspreche – mit dem einzigen Ziel, sportlich erfolgreicher zu sein. Dadurch, so befürchten sie, gingen künstlerische Elemente im Tanz verloren. Und noch schlimmer: Es könne sich in der Öffentlichkeit ein falsches Bild vom Breaken verfestigen, da es im Gegensatz zu den anderen olympischen Disziplinen eben kein Sport sei, sondern eine kulturell gewachsene Kunstform. Daher lehnen sie die Spiele ganz klar ab.

»Für die meisten Breaker war und ist es immer ein Kampf, dem privaten Umfeld zu vermitteln, dass es völlig okay ist, seinen Lebensunterhalt mit dem Tanzen zu verdienen.«
MYP Magazine:
Und was sagen die Befürworter?
Saïd:
Die wiederum sehen eher den athletischen Aspekt, für sie ist Olympia etwas überaus Positives. Sie sagen, die Szene könne durch die große internationale Aufmerksamkeit deutlich profitieren. Es bestehe die Chance, dass mehr Kids mit dem Breaken anfangen. Und deren Eltern würden es in Zukunft wohl viel eher akzeptieren, wenn das eigene Kind den Traum habe, später mal professionell zu breaken und davon leben zu können. Für die meisten Breaker, die ich kenne, war und ist es immer ein Kampf, dem privaten Umfeld zu vermitteln, dass es völlig okay ist, seinen Lebensunterhalt mit dem Tanzen zu verdienen.

»Wir empfinden Olympia nicht nur als eine athletische Herausforderung, sondern auch als eine kreative.«
MYP Magazine:
Welche Haltung hast Du persönlich zu dem Thema?
Generell ist es sehr schwer, Breaken in eine Schublade zu stecken. Für mich zum Beispiel ist es eine Schnittstelle aus allem Positiven, das ich daraus ziehen kann. Es kommt also darauf an, welche Bedeutung man selbst dem Ganzen gibt.
Was die olympischen Spiele angeht, sehen ich und viele andere, die Teil des Ganzen sind und das Thema von innen heraus betrachten, Paris als eine wunderbare Möglichkeit, uns noch mehr mit unserem Körper auseinanderzusetzen. Wir empfinden Olympia aber nicht nur als eine athletische Herausforderung, sondern auch als eine kreative. Und da das öffentliche Interesse an unserer Kultur durch die Spiele wohl deutlich wachsen wird, besteht für uns persönlich mittelfristig auch die Chance, besser bezahlt zu werden, mehr Unterricht zu geben und mehr Anfragen für Auftritte, Interviews oder Shows zu erhalten.

»Ich komme aus einer Familie mit muslimischem Hintergrund. Wenn da ein Sohn die ganze Zeit tanzen will, ist das vielleicht nicht das, was ein Vater gerne hört.«
MYP Magazine:
Wie hast Du selbst damals deinen Eltern erklärt, dass Du deinen Lebensunterhalt mit etwas verdienen willst, das sich Breakdance nennt?
Saïd:
Anfangs war es sehr schwer für meine Eltern, das alles zu verstehen. Ich komme aus einer Familie mit muslimischem Hintergrund. Wenn da ein Sohn die ganze Zeit tanzen will, ist das vielleicht nicht das, was ein Vater gerne hört. (lächelt) Meine Mutter dagegen fand’s immer schon interessant, aber sie hat nicht begriffen, warum mir das Ganze so wichtig ist und ich Breaken zu meinem Lebensmittelpunkt machen will. Als ich mit 13, 14 angefangen habe, an den Wochenenden immer wieder wegen irgendeines Battles durch die Republik zu fahren, hat ihnen das überhaupt nicht gefallen. Und ebenso wenig, dass ich nach der Schule immer zum Training gehen wollte. Sie dachten, dass mich das von den wirklich wichtigen Dingen im Leben ablenken würde. Und noch weniger nice fanden sie, dass ich Ihnen nach dem Abi offenbart habe, dass ich erst mal nicht studieren, sondern mich voll und ganz mit dem Tanzen auseinandersetzen will, um mich darin zu entdecken. Erst seit wenigen Jahren – nachdem ich immer größere Erfolge mit dem Breaken erziele und sie merken, wie viele andere Menschen ich damit inspiriere – verstehen sie mehr und mehr meinen Lebensentwurf.

»Meine Eltern fanden es furchteinflößend, dass ich am Wochenende mit Leuten unterwegs war, die sie nicht zuordnen konnten.«
MYP Magazine:
Die Breakdance-Community ist sehr offen und divers. Hat das in gewisser Weise auch die Wertvorstellungen Deiner Eltern verändert?
Saïd:
Ja, extrem! Dadurch, dass ich Teil dieser Szene bin, hat meine Familie sehr viel dazugelernt. Bei uns Uiguren zum Beispiel gibt es nur wenige Migranten. In der Breakdance-Community aber treffen sich Menschen mit tausend verschiedenen Hintergründen – und auch mit allen sexuellen Orientierungen. Anfangs fanden sie es furchteinflößend, dass ich am Wochenende mit Leuten unterwegs war, die sie nicht zuordnen konnten. Aber als sie gemerkt haben, dass es trotzdem ganz gut funktioniert und ich nach jedem Wochenend-Battle erzähle, dass Breaken das Tollste überhaupt für mich ist, haben sie im Laufe der Zeit ihr Misstrauen abgelegt.

»Das Tanzen hat mir eine Art Grundformel fürs Leben geschenkt, dadurch fühle ich mich in meinen Handlungen maximal frei.«
MYP Magazine:
Welchen Einfluss hat das Tanzen auf Deine Persönlichkeitsentwicklung? Oder anders gefragt: Was für ein Mensch wärst Du heute, wenn Du nicht damit angefangen hättest?
Saïd:
Was ich heute für ein Mensch wäre, kann ich schwer sagen. Ich weiß aber, dass mich das Breaken in meiner Persönlichkeit stark geformt hat. Im Gegensatz zu früher erwische mich viel seltener dabei, Vorurteile gegenüber Menschen zu haben, die ich nicht kenne. Durch das Breaken habe ich gelernt, allen Leuten grundsätzlich freundlich und aufgeschlossen zu begegnen. Darüber hinaus habe ich das Gefühl, ein Leben zu leben, in dem ich alles schaffen kann – auch wenn ich dafür oft Jahre investieren muss. Ich traue mir alles zu und habe keine Angst, irgendein Projekt anzugehen und in die Tat umzusetzen. Das Tanzen hat mir also eine Art Grundformel fürs Leben geschenkt, dadurch fühle ich mich in meinen Handlungen maximal frei.

»Breakdance ist ein Ventil, über das ich alles rauslassen kann: meine Energie, meinen Frust, aber auch mein Glück.«
MYP Magazine:
Wenn man Dir gegenübersitzt und sich mit Dir unterhält, erlebt man Dich als jemanden, der sehr in sich zu ruhen scheint. Ganz im Gegensatz zu Deinem Tanz, der von einer immensen Körperlichkeit und Dynamik geprägt ist. Bedingt das eine das andere?
Saïd:
Ich erinnere mich, dass ich als Kind sehr unruhig und schnell aufgebracht war – also das Gegenteil von heute. Tatsächlich bin ich durch das Tanzen zu einer großen inneren Ruhe gekommen, auch weil es ein Ventil ist, über das ich alles rauslassen kann: meine Energie, meinen Frust, aber auch mein Glück. Das gilt vor allem für die Battles, in denen ich mich vollkommen ausleben kann, und zwar auf eine absolut friedvolle Art und Weise. Das gibt mir eine schöne Grundruhe und macht mich im Alltag viel ausgeglichener.

»Durch Olympia kann ich dem uigurischen Volk auch mal über ein positiv besetztes Thema eine gewisse mediale Aufmerksamkeit zukommen lassen.«
MYP Magazine:
In der ZDF-Reportage erzählt Deine Mutter, wie stolz sie auf Dich ist, weil Du ihrer Meinung nach in Paris nicht nur für Deutschland, sondern auch für das gesamte uigurische Volk antreten würdest. Man merkt in diesem Moment an Deinem Gesichtsausdruck, wie ergreifend ihre Worte für Dich sein müssen. Empfindest Du diese immense Erwartungshaltung als Belastung?
Saïd:
Nein, das würde dem Ganzen eine negative Note geben. Ich sehe Olympia eher als eine große Chance. So kann ich dem uigurischen Volk auch mal über ein positiv besetztes Thema eine gewisse mediale Aufmerksamkeit zukommen lassen. In der Regel bekommt man hier in der westlichen Welt ja nur die negativen Schlagzeilen mit, etwa wenn es um das große Leid der Uiguren in China geht. Daher sehe ich es als eine große, aber dennoch schöne Verantwortung, sollte ich es wirklich schaffen, 2024 als Breaker mit uigurischen Wurzeln nach Paris zu fahren. Davon abgesehen geht es mir darum, jungen Leuten meiner oder anderer Kulturen Mut zu machen. Allein deshalb ist es wichtig, dass ich mich nicht stressen lasse.

»Mein Background war den Menschen völlig fremd, man konnte mich nirgendwo einordnen.«
MYP Magazine:
Dein Vater ist Journalist und wird von der chinesischen Regierung politisch verfolgt, weil er über die Situation der dortigen Uiguren schreibt. Ist es Dir ebenfalls ein Anliegen, dieses Thema sichtbarer zu machen?
Saïd:
Heute sehe ich mich in der Position. Das war aber nicht immer so. Als Teenager mochte ich das überhaupt nicht, ich hatte immer das Gefühl, mich überall erklären zu müssen. Außerdem hatte ich gerade in den ersten Jahren ein echtes Identitätsproblem. Denn hier in Deutschland hatte noch nie jemand etwas von Uiguren gehört, mein Background war den Leuten völlig fremd – man konnte mich nirgendwo einordnen. Mittlerweile sehe ich es aber als meine Verantwortung, die Menschen aufzuklären und ihnen ein umfassenderes Bild zu geben als das, was sie aus irgendwelchen News haben. Das ist auch auf Battles so: Wenn ich Leute aus verschiedensten Ländern treffe und die hören, dass ich Uigure bin, wollen die von mir eine Meinung aus erster Hand. Und manchmal komme ich aus einem Land wie Südkorea zurück und denke mir: Wow, krass, ich habe dort mit einem Koreaner, einem Kanadier und einem Amerikaner über die Situation der Uiguren in China gesprochen – und die gehen jetzt mit einem größeren Verständnis nach Hause, reden vielleicht mit ihren Freunden darüber und haben sogar mal eine Antwort parat, wenn wieder jemand sagt: „Ach, das sind doch eh alles Chinesen.“ Und dann können sie entgegnen: „Nein, sind sie nicht, sie leben nur dort.“ Ich habe das Gefühl, damit tue ich meinem Volk etwas Gutes.

»Diese riesige Wirtschaftsmacht tut ihr Bestes, um die uigurische Bevölkerung zu minimieren und ihren kulturellen Hintergrund auszuradieren.«
MYP Magazine:
Wie erklärst Du Menschen, die noch nie davon gehört haben, die Situation der Uiguren in China?
Saïd:
Ich erzähle ihnen, dass im äußersten Nordwesten Chinas seit Jahrtausenden ein Volk lebt, das eine eigenständige Kultur besitzt. Dieses Volk wird unterdrückt und unterworfen von einer riesigen Wirtschaftsmacht. Und die tut gerade in den letzten Jahren ihr Bestes, um die uigurische Bevölkerung zu minimieren und ihren kulturellen Hintergrund auszuradieren, indem sie ihr die chinesische Kultur aufzwingt.

»Das finde ich überhaupt so schön an meinem Volk: dass es sehr offen ist, obwohl es so viel durchgemacht hat und gerade wieder durchmacht.«
MYP Magazine:
Und wenn Du bei allem Ernst der Lage die positiven und schönen Seiten der uigurischen Kultur beschreiben müsstest, was würdest Du von diesem Volk erzählen?
Saïd:
Ich würde erzählen, wie herzlich und gastfreundlich dieses Volk ist; wie respektvoll es mit anderen Menschen umgeht; und wie vielseitig es ist. Im Allgemeinen kennt man die Uiguren nur als eine muslimische Minderheit in China. Aber Muslime waren die Uiguren nur einen vergleichsweise kleinen Zeitraum in der langen Zeit ihrer Existenz. Davor waren sie auch mal Zoroaster, Buddhisten oder gehörten dem Tengrismus an, einem alten schamanischen Kult der Mongolen und Turkvölker in Zentralasien. Die Uiguren haben im Laufe der Jahrtausende viele Religionen und Glaubenswege ausprobiert, daher sind sie immer aufgeschlossen und tolerant geblieben. Das finde ich überhaupt so schön an meinem Volk: dass es sehr offen ist, obwohl es so viel durchgemacht hat und gerade wieder durchmacht.

»Ich wünsche mir, nicht alles zu sehr zu verkopfen.«
MYP Magazine:
Wenn Du dir etwas wünschen könntest für Dein Leben, was wäre das?
Saïd:
Eigentlich einfach weiterhin das zu tun, was ich tue. Und nicht alles zu sehr zu verkomplizieren und zu verkopfen. Solange ich das machen kann, was mich glücklich und zufrieden macht, und ich dabei niemanden schade, solange werde ich ein gutes Leben führen. Mehr muss ich mir eigentlich gar nicht wünschen.
MYP Magazine:
Auch nicht die Goldmedaille in Paris?
Saïd: (lacht)
Nein, darum geht’s mir nun wirklich nicht.

»37 Grad: Mein Tanz, mein Battle«
Abrufbar in der ZDF-Mediathek bis zum 11. Oktober 2027
Mehr von und über Saïd Sankofa:
Fotografie: Maximilian König
Interview und Text: Jonas Meyer
Kings Elliot
Interview — Kings Elliot
»Meine Lieder erzählen davon, wie ich immer alles kaputt mache«
Die Schweizer Singer-Songwriterin Kings Elliot wirft in ihrer eindrücklichen Musik existenzielle Fragen auf, ihre Songs strotzen nur so vor Seelentiefe und Verletzlichkeit. Ein Gespräch entlang der zehn schönsten Fragen aus den Tagebüchern des Schriftstellers Max Frisch – über den Schmerz der Liebe, ungesunde Selbstkritik und das Weiterleben als ein vegetarisch speisender Adler.
11. Januar 2023 — Interview & Text: Katharina Viktoria Weiß, Fotografie: Frederike van der Straeten

In der Geschichte des Menschseins gibt es immer wieder Momente, die uns daran erinnern, dass das Wesen unserer Gefühle zeitlos ist. Beeinflusst zwar von den Umständen, in denen wir leben. Doch im Grunde sind die menschlichsten aller Emotionen immer gleich. Seit Jahrhunderten. Seit Jahrtausenden.
Als der berühmte Schweizer Schriftsteller Max Frisch in seinen Tagebüchern elf Fragebogen zu Themen wie Liebe, Freundschaft und Tod entwickelte, gab es mal wieder so einen Moment. Doch es braucht nicht unbedingt Weltliteraten, um uns das Wesen unserer Gefühle vor Augen zu führen. Existenziell und eindrücklich geht es beispielsweise auch bei der Schweizer Singer-Songwriterin Kings Elliot zu. Ihre Songs strotzen nur so vor Emotionalität. Sie erzählen vom Überlebenskampf sensibler Seelen und zeichnen mit klarer Stimme ein dichtes Gewebe aus Geschichten, die einem nach wenigen Streams das Gefühl verleihen, diese Frau und ihre Lebensthemen schon beinahe intim zu kennen.
Im November 2020 veröffentlichte Anja Gmür, so ihr bürgerlicher Name, den Song „I’m Getting Tired of Me“. Begleitet wurde dieser von einem Video, bei dessen Dreh sie eine Panikattacke bekam. Doch anstatt dieses Ereignis rauszuschneiden, besteht das Video nun aus drei Minuten und 40 Sekunden Verletzlichkeit.
Die Aufrichtigkeit, mit der Kings Elliot über ihre eigene Unzulänglichkeit singt, begeistert vor allem die junge Generation. Im Spätsommer 2022 begleitete sie über sechs Wochen hinweg die Pomp-Rocker von Imagine Dragons und den Rapper Macklemore auf deren Tour durch 20 US-Stadien und spielte dabei vor Hunderttausenden Fans. Doch immer wieder waren in den Reihen auch Plakate zu sehen, die beispielsweise mit der Aufschrift „Sick Puppies“ versehen waren – so nennt sich die Fangemeinde von Kings Elliot, die zahlreich zu den Konzerten der jungen Schweizerin angereist war.
Die Fans fühlen eine starke Verbindung zu der Art und Weise, wie die Musikerin Disney-Niedlichkeit mit düsteren Visuals vermischt. Aus diesem Grund haben wir Kings Elliot zum Interview in die knallbunte Burlesque-Bar „Wilde Mathilde“ am Berliner Alexanderplatz geladen. Wir lernen die Newcomerin kennen, indem wir ihr zehn der schönsten Fragen aus den Tagebuchbogen von Max Frisch stellen.


»Manchmal frage ich mich: Hätte ich ohne meine vielen Kämpfe überhaupt so früh und intensiv damit begonnen, Musik zu schreiben?«
MYP Magazine:
Frage 1: „Was fehlt Dir zum Glück?“ – zwar hast Du gerade eine Wahnsinnstour hinter Dich gebracht, aber wir hören in Deiner aktuellen EP „Bored of the Circus“ auch deutlich heraus, wie viel du dich aufgrund deiner Borderline-Diagnose mit dem Thema der mentalen Gesundheit beschäftigen musst.
Kings Elliot:
Für diese Herausforderungen bin ich dankbar. Denn nur aufgrund dieser Auseinandersetzungen kann ich genau die Musik schreiben, die mir so viel bedeutet. Die Tiefe des Thema hat mir so viele Türen geöffnet und macht das Leben auf eine bestimmte Art auch viel schöner für mich. Deswegen schließt sich hier ein Kreis – und ich definiere Glück vielleicht auch etwas anders: Aufgrund meiner Krankheit bin ich mal ganz oben und mal ganz unten, aber für mich gehört das dazu, ich habe mich so akzeptiert. Manchmal frage ich mich: Hätte ich ohne meine vielen Kämpfe überhaupt so früh und intensiv damit begonnen, Musik zu schreiben? Oder hätte ich diese große Liebe meines Lebens dann vielleicht nie entdeckt?

»Meine Lieder erzählen davon, wie ich immer alles kaputt mache.«
MYP Magazine:
Frage 2: „Lernst Du von einer Liebesbeziehung für die nächste?“
Kings Elliot:
Ja, ganz bestimmt. Es ist zwar schwierig, die eigenen Fehler nicht zu wiederholen, denn es kostet viel Arbeit, eingefahrene Muster zu durchbrechen. Verglichen mit jemandem, der etwas ausgeglichener ist, sind meine Reaktionen in Beziehungen sehr stark. Für den anderen kann das schnell anstrengend werden. Meine Liebe kann manchmal sehr schwer sein. Ich habe viel Gepäck und manchmal konnten meine Partner das nicht mehr mittragen. Diese Trennungen waren für mich immer unglaublich schwer. Aber auch schon innerhalb der Beziehungen spüre ich extreme Verlassensängste, die tief in mir verankert sind. Davon singe ich in den Liedern, sie erzählen, wie ich immer alles kaputt mache. Ich kann nicht ohne Schmerz lieben.
MYP Magazine:
Frage 3: „Wie viele Freunde hast Du zurzeit?“
Kings Elliot:
Ich habe nicht viele Freunde – aber die wenigen, die ich habe, sind sehr gute. Ich brauche lange, bis ich jemandem vertrauen kann, und habe Schwierigkeiten damit, diese Bindung und dieses Vertrauen zu neuen Personen aufzubauen.


»Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man gerade mit seinen Dämonen ringt.«
MYP Magazine:
Frage 4: „Hältst Du dich für einen guten Freund?“ – auch vor dem Hintergrund Deiner teilweise monatelangen Abwesenheit wegen Deiner beruflichen Reisen.
Kings Elliot:
Ich bin oft überwältigt von den Eindrücken, die die Welt um mich herum abstrahlt. Vielleicht bin ich übersensibel. Deshalb fällt es mir schwer, mit Menschen in regelmäßigem Kontakt zu bleiben. Ich melde mich nicht oft, obwohl ich die jeweilige Person ganz fest lieb habe. Ich habe oft verpasste Anrufe, komme aber aufgrund der fehlenden Routine in meinem Arbeitsleben kaum dazu, diese abzuarbeiten. Aber wenn mir ein Freund signalisiert, dass er mich wirklich braucht, dann bin ich natürlich sofort zur Stelle. Auch wenn mir jemand aus der „Sick Puppy“-Community schreibt und einen schweren Tag hat, dann versuche ich sofort zurückzuschreiben. Denn ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man gerade mit seinen Dämonen ringt. Und ich habe das Gefühl, mit meinem Zuspruch manchmal einen kleinen Unterschied für diese Menschen machen zu können, mit denen ich durch meine Lieder verbunden bin.

»Wenn man sich in seinen Träumen immer moralisch verhält, ist es langweilig.«
MYP Magazine:
Frage 5: „Träumst Du moralisch?“
Kings Elliot:
Ich glaube, wenn man sich in seinen Träumen immer moralisch verhält, ist es langweilig. Ich habe definitiv eine blühende Fantasie und träume generell sehr viel und sehr detailliert – und oft ganz gruselige Dinge. Doch auch am Tag suchen mich manchmal düstere Gedanken heim. Diese versuche ich dann allerdings in schöne Musik zu verpacken. Deshalb habe ich zwar einen Künstlernamen, aber ich habe mir dafür nicht extra eine eigene Künstlerpersona ausgedacht. Kings Elliott ist die wahrste Version meiner Persönlichkeit.


»Gerade Kritik im Internet ist oft so ungefiltert, dass es einen ganz unmittelbar verletzen kann.«
MYP Magazine:
Frage 6: „Was fürchtest Du mehr: das Urteil von einem Freund oder das Urteil von Feinden?“
Kings Elliot:
Das Urteil meiner Freunde ist mir wichtiger, aber ich weiß, dass die mich eigentlich so nehmen, wie ich bin. Deshalb fürchte ich mehr das Urteil von Fremden. Gerade Kritik im Internet ist oft so ungefiltert, dass es einen ganz unmittelbar verletzen kann.
MYP Magazine:
Frage 7: „Überzeugt Dich deine Selbstkritik?“
Kings Elliot:
Ja. Das ist aber nicht unbedingt immer gesund. Es gibt phasenweise viel, dass ich an mir selbst nicht mag. Teilweise treibt mein Perfektionismus auch alle anderen zur Weißglut. Zum Glück habe ich ein gutes Umfeld, dass mich dann wachrüttelt und dazu auffordert, aus den Unreifen meines Kopfes wieder aufzutauchen.


»Ich wäre gerne ein Adler, würde dann aber eine vegetarische Ernährung bevorzugen.«
MYP Magazine:
Frage 8: „Was tust Du für Geld nicht?“
Kings Elliot:
Alles, was sich für mich nicht richtig anfühlt. Ein Beispiel: Ich würde nie mit Tieren arbeiten, wenn es den Verdacht gäbe, dass sie nicht artgerecht behandelt würden. Wenn ich hier den Platz mal nutzen darf, das passt ja auch irgendwie zur Frage: Adoptiert Tiere – nicht kaufen!
MYP Magazine:
Frage 9: „Möchten Sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als ein gesundes Tier? Und als welches?“
Kings Elliot:
Ich liebe Hasen, aber generell werden sie von Menschen oft unterschätzt und nicht besonders gut behandelt. Deshalb würde ich kein Hase sein wollen, es sei denn ich könnte bei mir selbst wohnen. Generell wäre ich eher ein großer Vogel. Einer, der nicht gegessen wird und weite Strecken fliegen kann. Wie zum Beispiel ein Adler, allerdings würde ich dann keine Mäuse jagen, sondern eine vegetarische Ernährung bevorzugen.

»Ich war die Einzige im Dorf, die Musik gemacht hat.«
MYP Magazine:
Frage 10: „Hätten Sie lieber einer anderen Nation (Kultur) angehört und welcher?“
Kings Elliot:
Ich habe mir immer gewünscht, in New York oder London geboren worden zu sein. Denn es schien mir so, als ob es Menschen, die in einer so vielfältigen Metropole aufgewachsen sind, von Anfang an leichter in der Kreativbranche hätten. Meine Lebensrealität sah anders aus: Ich war die Einzige im Dorf, die Musik gemacht hat. Andererseits hat dieser Lebensweg natürlich einen prägenden Einfluss auf meine Lieder. Daher bin ich mittlerweile ganz froh, dass ich gelernt habe, mich durchzubeißen.


Mit besonderem Dank
an die Burlesque-Cocktailbar Wilde Matilde am Berliner Alexanderplatz.
Mehr von und über Kings Elliot:
Interview & Text: Katharina Viktoria Weiß
Fotografie: Frederike van der Straeten
Joshua Seelenbinder
Interview — Joshua Seelenbinder
»Das Feuer flackert im Kamin – und dann passiert ein Mord«
Was wäre Weihnachten ohne einen schönen Mord, zumindest im TV? Mit »Mord unter Misteln« beschenkt uns der Tatort am 26. Dezember mit einer ganz besonderen Festtagsfolge. Aufzuklären ist das Ableben eines Butlers, der am Heiligen Abend des Jahres 1922 plötzlich tot in einem englischen Herrenhaus liegt. Unter den Verdächtigen: ein junger, nicht ganz so frommer Geistlicher, gespielt von Joshua Seelenbinder. An seiner alten Schauspielschule haben wir den Film- und Theaterschauspieler zum Interview getroffen. Ein Gespräch über das Kulturgut Tatort, zwei Jahre #ActOut sowie den Aufholbedarf der deutschen Fernseh- und Theaterlandschaft in Sachen Diversität und Gleichbehandlung. Und natürlich über das Giftige an Weihnachten.
22. Dezember 2022 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

Heiligabend in einem englischen Herrenhaus, wir schreiben das Jahr 1922. Im vornehmen Beckford Hall hat die resolute Lady Bantam zum weihnachtlichen Dinner geladen und eine Handvoll Gäste um sich geschart. Doch wirklich genießen kann die illustre Runde den Abend nicht, denn auf einmal liegt Butler Arthur mausetot auf dem Orientteppich.
Der Weihnachts-Tatort „Mord unter Misteln“ ist ein ganz besonderer Fall. Nicht nur, weil es der 90. Einsatz von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl ist, die seit 1991 als Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr im Münchener Tatort ermitteln. Sondern auch, weil diese Episode, die am zweiten Weihnachtstag in der ARD ausgestrahlt wird, eine Geschichte innerhalb der Geschichte erzählt.
Batic und Leitmayr sind in der Wohnung ihres Kollegen Kalli zum Krimidinner eingeladen. Nach kurzem Gemurre lassen sich die beiden auf das Spiel ein. Und so kommt es, dass sie schließlich als Constable Ivor Partridge und als Chief Inspector Francis Lightmyer am 24. Dezember 1922 nach Beckford Hall beordert werden, um das verdächtige Ableben von Butler Arthur aufzuklären. Dort stoßen sie auf eine Runde merkwürdiger Gäste, von denen jede und jeder einen guten Grund gehabt hätte, den Butler zu ermorden.
Mittendrin in diesem Ensemble von Verdächtigen ist der auf den ersten Blick prüde Reverend Edgar Teal, der von Joshua Seelenbinder dargestellt wird. Für den 32-jährigen Schauspieler ist sein Tatort-Debüt der krönende Abschluss eines sehr erfolgreichen Jahres. Bei den Streamern Sky und Netflix ist er seit Mai respektive November in den Serien „Das Boot“ und „1899“ zu sehen, bei den Wormser Nibelungen-Festspielen stand er im Juli in der Rolle des Giselher auf der Bühne, und aktuell dreht er für die ARD-Miniserie „Herrhausen“ sowie die Paramount-Serie „Phantom Jäger“. Darüber hinaus wird er im nächsten Jahr als Passfälscher Cioma Schönhaus im Kinofilm „Last Song for Stella“ zu erleben sein sowie als Polizist Malte Niebecker in der norddeutschen ARD-Komödie „Der Lux“.
In Joshuas Leben läuft es also, könnte man sagen. Doch der Weg hierhin war für den feinsinnigen und eher zurückhaltenden jungen Mann alles andere als gut befahrbar. Aufgewachsen ist er in einem kleinen Ort im Norden Niedersachsens, um ihn herum war nichts als plattes Land. Für einen Jugendlichen, in dem nicht nur ein künstlerisches, sondern auch ein queeres Herz schlägt, kann das eine doppelte Enge bedeuten, auch heute noch.
Nach ersten Gehversuchen am Hamburger Monsun-Theater studierte er von 2013 bis 2017 an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Danach war er festes Ensemblemitglied am Staatstheater Braunschweig, seitdem arbeitet er als freier Schauspieler.

Frei, das ist ein Wort, das für Joshua spätestens seit dem 5. Februar 2021 eine ganz besondere Bedeutung hat. Damals outete er sich gemeinsam mit 184 weiteren Schauspieler:innen in der Süddeutschen Zeitung, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intergeschlechtlich oder nichtbinär bezeichnen. Unter dem Titel #ActOut haben sie sich zum Ziel gesetzt, mehr Akzeptanz und Anerkennung von queeren Menschen zu erreichen – sowohl in der Gesellschaft sowie innerhalb der deutschsprachigen Film-, Fernseh- und Theaterbranche.
Auf dem 2018 neu eröffneten Campus der HfS Ernst Busch unweit des Berliner Nordbahnhofs haben wir Joshua Seelenbinder Anfang Dezember zum Interview und Photoshoot getroffen.

»Der Reverend spielt ständig mit dem Feuer, immerhin hat er sich dem Zölibat verschrieben.«
MYP Magazine:
In „Mord unter Misteln“ bist Du als Reverend Edgar Teal aus dem Jahr 1922 zu sehen. Wie würdest Du diesen Charakter beschreiben? Was treibt ihn an?
Joshua Seelenbinder:
Der Reverend brennt für seine Sache – und damit meine ich nicht das Geistliche, denn er ist weder fromm noch makellos. Ganz im Gegenteil: Für seine heimliche Liebe, das Hausmädchen Heather, tut er alles. So spielt er ständig mit dem Feuer, immerhin hat er sich dem Zölibat verschrieben. Doch seine Leidenschaft ist stärker und treibt ihn immer wieder aufs Neue an. Das macht den Charakter für mich so spannend und liebenswert.

»Cluedo ist hier auch meine inhaltliche Schnittstelle.«
MYP Magazine:
Euer Tatort erinnert mit seinem Setting und den Figuren ein bisschen an den Brettspiel-Klassiker Cluedo sowie an alte Maigret- oder Poirot-Krimis. Das wird bei vielen Zuschauer:innen die eine oder andere Kindheitserinnerung auslösen. Bei Dir auch?
Joshua Seelenbinder:
Total! Cluedo ist hier auch meine inhaltliche Schnittstelle – und natürlich diese extreme Weihnachtsstimmung, die über der gesamten Szenerie liegt. Es ist Heiligabend, alle kommen in einem urgemütlichen und festlich geschmückten Herrenhaus zusammen, das Feuer flackert im Kamin – und dann passiert ein Mord…
MYP Magazine:
… der allerdings kein echter Mord ist, sondern im Tatort im Rahmen eines Krimidinners aufgedeckt werden muss. Hast Du selbst auch schon mal bei so einem Spiel mitgemacht?
Joshua Seelenbinder:
Ja, allerdings erst nach den Dreharbeiten. Vorher hatte ich darauf nie so Lust. Aber da mir unser Dreh so viel Spaß gemacht hat, habe ich mich im Privaten auch darauf eingelassen. Da ging es um den Mord an einer Schauspielerin in der Silvesternacht.

»Der Tatort ist das deutsche Kulturgut in der Fernsehlandschaft.«
MYP Magazine:
Der Tatort prägt seit über 50 Jahren die deutsche Fernsehlandschaft, für viele Menschen hat das Format eine ganz besondere Bedeutung: Sie sind mit dem Tatort aufgewachsen und beschließen damit regelmäßig ihr Wochenende. Wie bist Du im Vorfeld mit dieser Strahlkraft umgegangen?
Joshua Seelenbinder:
Diese Bedeutung kann man tatsächlich nicht so leicht in den Hintergrund schieben. Der Tatort ist das deutsche Kulturgut in der Fernsehlandschaft, eine echte TV-Institution. Allein deshalb war es für mich ein großes Ding, da mitwirken zu dürfen. Allerdings bin ich privat nicht so stark Tatort-geprägt wie andere – vielleicht auch, weil es in meiner Familie immer schon zwei Lager gab: Für meinen Opa zum Beispiel ist der Tatort ein fester Bestandteil seines Sonntagabends, meine Mutter dagegen interessiert sich kaum dafür. Ich selbst schaue immer wieder mal rein, vor allem, wenn Kolleg:innen mitspielen, die ich kenne. Oder wenn es um Teams geht, die ich mag.
MYP Magazine:
Welche sind das?
Joshua Seelenbinder:
Das neue, junge Team aus Bremen finde ich echt gut. Dresden auch. Und spätestens jetzt auch München. (lächelt)

»Bei dieser speziellen Weihnachtsfolge spalten sich die Meinungen schon jetzt.«
MYP Magazine:
Kann es für so ein TV-Format nicht auch zum Problem werden, wenn es von seinem Publikum permanent mit Erwartungen und Emotionen überladen wird?
Joshua Seelenbinder:
Das kann durchaus ein Nachteil sein, klar. Auch, was unseren Tatort betrifft, haben wir noch überhaupt keine Ahnung, wie er am Ende bei den Leuten ankommen wird. Schließlich ist er kein klassischer München-Fall, sondern eine spezielle Weihnachtsfolge, die vor hundert Jahren spielt und einen fiktiven Mord behandelt. Da spalten sich die Meinungen schon jetzt: Die einen sagen, die Geschichte passe total gut zu Weihnachten, die anderen sind enttäuscht, weil sie sich auch für die Feiertage einen normalen Batic-Leitmayr-Fall gewünscht hätten. Und das ist unser Tatort natürlich nicht, sondern eher eine Art Gimmick.
MYP Magazine:
Und dann gibt es sicher eine dritte Gruppe, die lediglich Angst davor hat, dass Hauptkommissar Ivo Batic in Rente geht.
Joshua Seelenbinder: (lacht)
Oh ja, die darf man nicht vergessen!

»So kammerspielartig, wie die Geschichte aufgezogen ist, haben wir auch gedreht.«
MYP Magazine:
Wie hast Du die Produktion erlebt?
Joshua Seelenbinder:
So kammerspielartig, wie die Geschichte aufgezogen ist, haben wir auch gedreht. Das war eine echte Ensemble-Arbeit – wie bei einem Theaterstück. Wir alle haben fast drei Wochen am Stück an diesem Ort in der Bayerischen Provinz aufeinander gehockt und viele tolle Tage miteinander erlebt. Das war wirklich schön und besonders, denn normalerweise reist man nur für ein paar Tage an, spielt seine Rolle und geht dann wieder.
MYP Magazine:
Wie war die Zusammenarbeit mit den beiden alten Ermittlerhasen Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl alias Ivo Batic und Franz Leitmayr?
Joshua Seelenbinder:
Ich muss zugeben, dass ich am Anfang etwas skeptisch war, weil die beiden das schon wirklich, wirklich lange machen und es gewohnt sind, dass bei jeder neuen Folge immer wieder neue Gesichter rein- und rausgespült werden. Daher war ich mir nicht sicher, ob ich in der kurzen Zeit eine Verbindung mit Miro und Udo herstellen kann. Aber die beiden hatten total Lust auf diesen besonderen Tatort. Sie hatten Lust, etwas Neues auszuprobieren, und hingen mit uns auch sehr viel an diesem Ort ab. Wir hatten am Ende sehr viel Spaß zusammen, das hat mich positiv überrascht.

»Im Film wie am Theater überwiegt immer noch die Vorstellung, dass Frauenrollen jung, schön und begehrenswert zu besetzen sind.«
MYP Magazine:
An einer Stelle sagt Inspector Lightmyer zu Lady Bantam: „Ich bin ein alter Mann, Milady.“ Und diese antwortet: „Für Ihr Geschlecht gelten andere Regeln.“ Dieser Satz ist aktueller denn je, noch immer werden Frauen in vielen Berufen systematisch benachteiligt. Wie ist die Situation diesbezüglich in der Schauspielbranche?
Joshua Seelenbinder:
Ich kann dazu nur aus Gesprächen mit Kolleginnen berichten, für die etwa die ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen immer noch ein großes Thema ist – obwohl sich zumindest an dieser Front gerade einiges zu tun scheint.
Was aber eine noch viel größere Benachteiligung ist, ist die Tatsache, dass es nach wie vor nur sehr beschränkte Frauenrollen gibt. Klar, das wird hier und da mal aufgeweicht. Aber im Film wie am Theater überwiegt immer noch die Vorstellung, dass Frauenrollen jung, schön und begehrenswert zu besetzen sind. Danach, etwa ab einem Alter von 30 Jahren, kommt lange nichts. Und irgendwann dürfen die Frauen dann wieder – vereinfacht gesagt – die schrulligen Mütter oder Großmütter spielen.
Bei Männern ist das ganz anders. Da gibt es nicht nur viel mehr Rollen, sondern vor allem auch in diversen Formen und Altersklassen. Und diese männlichen Rollen werden auch heute noch viel häufiger geschrieben als vergleichbare weibliche. Das ist auf jeden Fall ein Ungleichgewicht.

»Der männliche Körper ist auf der Bühne wie im Film viel weniger Beurteilungen ausgesetzt als der weibliche.«
MYP Magazine:
Welche Privilegien nimmst Du für Dich als männlicher Schauspieler wahr?
Joshua Seelenbinder:
Für Männer ist es viel leichter, Rollen in einem jüngeren Spielalter zu übernehmen – einfach, weil das Publikum da mehr Abweichung vom eigenen Alter verzeiht. Da bin ich keine Ausnahme. Bei Frauen wird viel kritischer hingeschaut. Der männliche Körper ist auf der Bühne wie im Film viel weniger Beurteilungen ausgesetzt als der weibliche. Ich zum Beispiel bin recht schmal. Das bringt zwar auch die eine oder andere schauspielerische Einschränkung mit sich, weil nach wie vor gerne nach Klischee besetzt wird. Trotzdem werde ich als Mann lange nicht so auf das Körperliche reduziert wie weibliche Personen, und das gilt nicht nur für den Schauspielbetrieb.

»#ActOut hat dazu geführt, dass ich in meiner Arbeit offener und selbstbewusster auftreten kann.«
MYP Magazine:
Vor knapp zwei Jahren bist Du im Rahmen der #ActOut-Initiative gemeinsam mit 184 anderen Schauspieler:innen an die Öffentlichkeit gegangen. Euer Ziel ist es unter anderem, mehr Akzeptanz und Anerkennung von queeren Menschen sowohl in der Gesellschaft sowie innerhalb der deutschsprachigen Film-, Fernseh- und Theaterbranche zu erreichen. Welche Bedeutung hat es für Dich persönlich, Teil dieser Initiative zu sein?
Joshua Seelenbinder:
Für mich ist #ActOut immer noch eine riesige Befreiung. Und die Tatsache, Teil einer so großen, ausdrucksstarken Gruppe zu sein, gibt mir nach wie vor ein beflügelndes und beruhigendes Gefühl von Sicherheit. Das hat in meinem Leben unter anderem dazu geführt, dass ich in meiner Arbeit offener und selbstbewusster auftreten kann. Etwa, wenn am Set über Familie oder Partner:innen gesprochen wird, rede ich inzwischen – ohne groß darüber nachzudenken – auch über meinen Freund.
Trotzdem kamen mir damals auch einige Zweifel, nachdem ich meine Zusage für #ActOut gegeben hatte. Nicht wegen der Initiative an sich, sondern weil in mir plötzlich Fragen aufkamen wie: Ändert sich dadurch der Blick auf mich als Schauspieler? Was bedeutet das für meine Karriere? Was macht das mit zukünftigen Rollen? Ich hatte ja gerade erst angefangen, frei zu arbeiten, und war daher ziemlich verunsichert. Letztendlich bin ich aber sehr dankbar und froh, bei dieser großartigen Initiative mitgemacht zu haben. Und wenn sich aus diesem Grund tatsächlich jemand entscheiden sollte, mich nicht mehr zu besetzen, muss ich sagen: Mit solchen Leuten möchte ich auch nicht mehr zusammenarbeiten.
MYP Magazine:
Welche Reaktionen sind Dir in besonderer Erinnerung geblieben?
Joshua Seelenbinder:
Es gab einige Intellektuelle, die #ActOut hart angegriffen haben – etwa die Feuilletonistin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch wenn sich diese Angriffe nicht auf Einzelpersonen bezogen, fühlten sie sich doch sehr persönlich und verletzend an, daran erinnere ich mich noch. Insgesamt überwiegen aber bis heute die vielen positiven Nachrichten und Reaktionen. Außerdem sind in meinem Leben viele neue Bekanntschaften und sogar Freundschaften entstanden, die es ohne #ActOut nicht geben würde.

»Bildet das, was man im Kino oder im TV sieht, nur die weiße Mittelschicht ab? Oder entspricht das dem tatsächlichen Straßenbild in Deutschland?«
MYP Magazine:
Was habt Ihr mit #ActOut in den knapp zwei Jahren bewegt und erreicht?
Joshua Seelenbinder:
Ich finde, es gibt eine neue Leichtigkeit in der Branche. Nicht nur, weil viele Schauspieler:innen nicht mehr das Gefühl haben, sich verstecken zu müssen. Sondern auch, weil queere Rollen in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft langsam präsenter werden – in sehr kleinen Schritten zwar, aber es tut sich etwas. Außerdem hat es Aktionen von anderen Berufsgruppen gegeben, die von #ActOut inspiriert wurden, etwa die Initiativen #TeachOut oder #ChurchOut.
MYP Magazine:
Im #ActOut-Manifest heißt es: „Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass sich die bestehenden Film- und Serien-Sehgewohnheiten erweitern und verändern. Es gibt weitaus mehr Geschichten und Perspektiven als nur die des heterosexuellen weißen Mittelstands, die angeschaut und gefeiert werden. Diversität ist in Deutschland längst gesellschaftlich gelebte Realität. Dieser Fakt spiegelt sich aber noch zu wenig in unseren kulturellen Narrativen wider.“ Wie blickst Du heute auf die deutsche Film- und Fernsehlandschaft?
Joshua Seelenbinder:
Ich bemerke zwar, dass es Veränderungen gibt, etwa was die Diversität von Casts angeht. Aber diese Veränderungen reichen noch lange nicht aus und passieren auch nicht schnell genug. Die Frage ist doch: Bildet das, was man im Kino oder im TV sieht, nur die weiße Mittelschicht ab? Oder entspricht das dem tatsächlichen Straßenbild in Deutschland? Da nehme ich das Theater übrigens in keiner Weise aus. Es heißt ja, das Theater sei wie ein alter Dampfer, bei dem es eine Ewigkeit dauere, ihn in eine andere Richtung zu steuern. Aus eigener Erfahrung kann ich das zu hundert Prozent unterschreiben.

»In meinem Leben gab es immer ein ein unterbewusstes Wahrnehmen von Enge in einer überaus heterosexuell geprägten Gesellschaft.«
MYP Magazine:
Du selbst bist im ländlichen Niedersachsen der 1990er und 2000er Jahre aufgewachsen, einem eher wenig diversen Umfeld. Welche Erinnerungen hast Du an Dein jüngeres Ich, an den queeren Teenager, der Schauspieler werden wollte?
Joshua Seelenbinder:
Es ist nicht so, dass ich schon immer das feste Ziel hatte, Schauspieler zu werden, und aus diesem Grund vom platten Land wegwollte. Das war eher die Entwicklung einiger Jahre. Dennoch gab es in meinem Leben immer ein leises, unterschwelliges Brummen, ein unterbewusstes Wahrnehmen von Enge in einer überaus heterosexuell geprägten Gesellschaft, das mich da mehr und mehr herauszog. Und auch wenn der Umgang meiner Familie und Freund:innen mit meiner Sexualität immer sehr unkompliziert und offen war, reden wir hier dennoch über das provinzielle Niedersachsen – und da passiert einfach nicht so viel.

»Wir bekommen es in Deutschland nach wie vor nicht hin, woke Themen humorvoll, intelligent, aber auch ästhetisch sexy zu erzählen.«
MYP Magazine:
Welche Formate, die Du heute kennst, hätten Dir damals gutgetan?
Joshua Seelenbinder:
Da würde ich fast alle queeren Serien nennen, die mir im Laufe der letzten Jahre begegnet sind. Etwa „Queer Eye“, „Pose“ oder auch „Queer As Folk“, was aber zu meinen Teenager-Zeiten eher noch ein Nischending war, davon hatte ich damals kaum was mitbekommen. Irgendwann kam „Brokeback Mountain“ ins Kino, das war für mich ein Meilenstein.
MYP Magazine:
Auffallend wenige deutsche Produktionen, die Du da aufzählst.
Joshua Seelenbinder:
Ich weiß nicht, warum wir es in Deutschland nach wie vor nicht hinbekommen, woke Themen humorvoll, intelligent, aber auch ästhetisch sexy zu erzählen. Das wird einem immer wieder deutlich, wenn man sich beispielsweise Formate wie die Netflix-Serien „Sex Education“ oder „Heartstopper” anschaut. Da wird einerseits leicht und unverkrampft erzählt und gleichzeitig ist der Stoff dramaturgisch wie inhaltlich wirklich gut. So etwas fehlt mir hier. Vielleicht liegt es daran, dass die deutsche Fernsehlandschaft von so unendlich vielen Krimis besetzt ist, das scheint die Zuschauer:innen wirklich anzuziehen.

»Über die Busch gab es damals viele Geschichten und Gerüchte.«
MYP Magazine:
Von 2013 bis 2017 hast Du an der HfS Ernst Busch studiert. Wie blickst Du auf diese Zeit zurück?
Joshua Seelenbinder:
Über die Busch gab es damals viele Geschichten und Gerüchte. Die Schule wurde immer angepriesen als Kaderschmiede und war für uns junge Schauspiel-Anwärter:innen eine absolute Legende. Dementsprechend konnte ich es auch zuerst nicht glauben, als ich angenommen wurde.
Meine Erinnerungen an die Zeit dort sind sehr gemischt. Das Studium war sehr intensiv, ich habe viel gelernt und wurde gut ausgebildet. In diesen Jahren gab es aber auch wenig Privatleben – ich war jeden Tag gefühlt von früh morgens bis spät abends in der Schauspielschule. Das war einerseits schön, andererseits aber auch schade, denn ich bekam kaum etwas von Berlin mit.
Darüber hinaus fehlte mir ein gewisser Grad an künstlerischer Freiheit. Der Stundenplan war so vollgepackt, dass man sich abseits davon kaum ausprobieren konnte. Inzwischen hat sich das aber geändert, in den Jahrgängen unter uns gibt es einen Zyklus, in dem sie eine freie Arbeit gemeinsam machen können.

»Dadurch, dass alles im Studium so festgezurrt war, war anschließend das Bedürfnis nach Freiheit und Loslassen umso präsenter.«
MYP Magazine:
Wie hat Dich das Studium auf Dein späteres Berufsleben vorbereitet?
Joshua Seelenbinder:
Durch diese vier Jahre habe ich gelernt, viel auszuhalten im Theateralltag. Ich wurde gestählt für vieles in der Branche – für lange Tage, parallele Proben und kräftezehrende Vorstellungen. Und mit der Zeit habe ich gelernt herauszufinden, was ich in Bezug auf künstlerisches Arbeiten möchte – und was nicht. Dadurch, dass alles im Studium so festgezurrt war, war anschließend das Bedürfnis nach Freiheit und Loslassen umso präsenter, auch während meiner ersten Engagements an Theatern. Der Dampfer muss schließlich fahren, jeden Abend geht der Vorhang hoch. Aber auch das hat sich irgendwann sein Ventil gesucht. Und ich habe das Gefühl, dass mein Beruf jetzt endlich anfängt zu atmen.
MYP Magazine:
Von Charlie Hübner, der ebenfalls an der HfS studiert hat, stammt der Satz: „Schauspielerei war für mich eher eine Identitätshilfe, weil ich nicht wusste, was ich will und wer ich bin.“ Ist das bei Dir ähnlich?
Joshua Seelenbinder: (lächelt)
Charlie Hübner, ein toller Schauspieler! Ich würde den Satz für mich zwar nicht unbedingt unterschreiben, aber ich glaube zu wissen, was er meint. Denn natürlich helfen einem bestimmte Rollen oder Stoffe, sich anders auszudrücken – in einer Form, in der man es als Privatperson vielleicht nicht tun würde, etwa weil man privat eher Schwierigkeiten hätte, in eine bestimmte Emotion zu kommen oder eine andere Seite von sich zu zeigen. Für diese Situationen bietet die Schauspielerei eine spannende Alternativwelt, in der man sich ausprobieren kann. Auf der Bühne ist grundsätzlich sehr viel möglich.

»Die Achtziger waren alles andere als eine gute Zeit für queere Personen.«
MYP Magazine:
In Deinem Beruf musst Du dich nicht nur immer wieder in neue Charaktere hineinversetzen, sondern auch in unterschiedlichsten Zeiten und Epochen zurechtfinden. Welche Rolle aus Deiner bisherigen Karriere hat Dich am meisten geprägt?
Joshua Seelenbinder:
Am spannendsten fand ich bisher meine Rolle im Film „Last Song for Stella“, der 2023 ins Kino kommt. Da spiele ich den Passfälscher Cioma Schönhaus, der in der NS-Zeit für Jüdinnen und Juden Dokumente gefälscht hat, mit denen sie ins Ausland fliehen konnten. Eine mutige und außergewöhnlich hoffnungsvolle Rolle, die im dunkelsten Teil deutscher Geschichte spielt.
MYP Magazine:
Gibt es eine Epoche, die Du gerne persönlich erlebt hättest – vom Jahr 1899 bis heute?
Joshua Seelenbinder:
Ich hätte wahnsinnig gerne die Zeit der ballroom culture in New York erlebt, die in den 1960er Jahren in Harlem aus der afro- und lateinamerikanischen Community heraus entstand und in den Siebzigern und Achtzigern immer populärer wurde. Diese nicht-weiß geprägten ballrooms gelten heute als die ersten safe spaces für junge People of Color, das finde ich persönlich sehr spannend und faszinierend. Gleichzeitig frage mich, ob ich da ohne Weiteres hätte eindringen wollen. Schließlich will ich als privilegierte weiße Person nicht einfach einen Raum besetzen, den nicht-weiße Menschen für sich geschaffen haben.
Darüber hinaus waren die Achtziger mit der aufkommenden Aids-Krise auch alles andere als eine gute Zeit für queere Personen – nicht nur, weil fast eine ganze Generation innerhalb der LGBTQIA+-Community wegstarb, sondern die Leute auch von der Gesellschaft wie Aussätzige behandelt und damit zusätzlich stigmatisiert wurden.

»An Weihnachten kommen alle mit der Familie zusammen – die einen freiwillig, die anderen widerwillig.«
MYP Magazine:
Kommen wir zum Schluss nochmal auf Euren Tatort zurück. Dort fällt mehrmals der Satz: „Alles an Weihnachten ist giftig.“ Würdest Du das privat auch unterschreiben? Was bedeutet Dir Weihnachten?
Joshua Seelenbinder:
Weihnachten ist einer der emotional am stärksten aufgeladenen Termine im Jahr. Alle kommen mit der Familie zusammen – die einen freiwillig, die anderen widerwillig. Und dann passiert da etwas, das gleichzeitig wahnsinnig schön und wahnsinnig anstrengend sein kann. Giftig daran ist vielleicht am ehesten der Druck, sich gegenseitig beschenken zu müssen. Dazu kommen die unverrückbaren Erwartungen unserer Gesellschaft, wie Weihnachten zu sein hat: perfekt, besinnlich und harmonisch. Und gerade das ist vielleicht am giftigsten.
Mehr von und über Joshua Seelenbinder:
Fotografie: Maximilian König
Interview und Text: Jonas Meyer
Mit besonderem Dank
an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin
aa-legrand
Interview — aa–legrand
»Musik ist für mich eine Form von Selbstermächtigung«
Mit seiner gefühlvollen Debüt-EP »Pacific« liefert Simeon Loth alias aa–legrand das beste Mittel gegen schmuddelige Wintertage, in seine Songs kann man sich einwickeln wie in eine flauschige Indiefolk-Decke. Doch es droht auch Fernweh-Gefahr, denn die Platte ist inspiriert von einem sommerlichen Roadtrip entlang der nordamerikanischen Westküste. Ein Interview über das Verständnis von Kunst, Musik als eine Form von Selbstermächtigung und die ewige Magie von Radiohead.
14. Dezember 2022 — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Nis Alps

Die Versuchung, an einem kaltfeuchten Dezembertag nicht übers Wetter zu schreiben und es bis aufs Äußerste zu verfluchen, ist groß. Vor allem, wenn die Musik, um die sich der Text eigentlich drehen sollte, inspiriert ist von einem weit entfernten Sommer an der Westküste Nordamerikas. Wer schon mal da war, weiß, wovon die Rede ist: das Licht, die Luft, die Landschaft – was für ein magisches Fleckchen Erde!
Das findet auch Simeon Loth alias aa–legrand. Der 32-jährige Singer-Songwriter war Mitte 2015 sechs Wochen lang mit dem Auto zwischen Vancouver und San Francisco unterwegs und verliebte sich jeden Tag aufs Neue in die atemberaubenden Küsten, Wälder und Gebirgszüge entlang des berühmten Pacific Coast Highway (Trigger-Warnung: Etwaige Bildersuchen können zu akutem Fernweh führen).
Was Simeon in diesen sechs Wochen erlebte, berührte ihn so tief, dass er der nordamerikanischen Pazifikküste zuerst einen Song („Shade Of A Giant“) und dann seine Debüt-EP widmete. Der Titel: „Pacific“. Was auch sonst.
„Pacific“ besteht mit „All You Love“, „Slow, Sleep, Fall“ und dem besagten „Shade Of A Giant“ zwar nur aus drei Titeln. Doch erstens zeigt Simeon mit dem feinsinnigen Arrangement, der eingängigen Melodik und dem prägnant-atmosphärischen Indiefolk-Sound mit leichten elektronischen Einflüssen bereits jetzt, wo er musikalisch steht und wohin er will.
Und zweitens – vielleicht noch wichtiger – gelingt es ihm, mit diesen drei Titeln eine ihm ganz eigene Emotionalität herzustellen. Wie ein Pendel bewegt sie sich zwischen Melancholie und Zuversicht hin und her, wandert von Nachdenklichkeit zu Zerstreuung, immer ganz sanft und ohne wahrnehmbare Übergänge. Und ehe man sich versieht, schießen einem Assoziationen an das Jahr 2008 in den Kopf, als Bon Iver sich mit seinem legendären Debütalbum „For Emma, Forever Ago“ aufmachte, die Welt zu erobern. Fürwahr ein großer Vergleich, doch wir reden ja nur über Assoziationen. Time will tell.
Eines allerdings hat Simeon Loth dem Bon-Iver-Gründer Justin Vernon voraus: Der gebürtige Pforzheimer ist nicht nur Musiker, sondern auch Gitarrenbauer. In seiner „Backyard Guitars“ genannten Werkstatt in einem Neuköllner Hinterhof hatte er bereits etliche Gitarren berühmter Bands auf seiner Werkbank (das Namedropping überlassen wir seiner Website).
Im Körnerpark wenige Gehminuten entfernt haben wir ihn zum ausführlichen Interview getroffen – an einem Samstagnachmittag, als das Wetter noch nicht so war, dass man es verfluchen wollte. Aber dafür das Fernweh nach einem Roadtrip auf dem Pacific Road Highway schon genauso groß.


»Bei einem Roadtrip geht es nicht darum, irgendwo anzukommen, sondern unterwegs zu sein.«
MYP Magazine:
Simeon, uns ist es trotz intensiven Googelns nicht gelungen, Dein Alias aa–legrand zu entschlüsseln. Was steckt hinter diesem Künstlernamen?
Simeon:
Der Begriff aa–legrand ist weniger ein Name, sondern vielmehr ein Motto, das die Absicht meiner Musik verbildlichen soll: Das a steht als erster Buchstabe des Alphabets für einen Anfang, der Bindestrich symbolisiert einen Weg und legrand steht für das Ziel, von dem ich selbst noch nicht weiß, was es ist. Hoffentlich etwas Großes. Auf jeden Fall aber etwas Unbekanntes.
MYP Magazine:
Zu diesem Weg passt auch folgender Satz, der uns immer wieder auf Deinen Social-Media-Kanälen begegnet: „aa–legrand is creating music for a road trip.“ Welche Kriterien muss Musik für Dich erfüllen, damit sie eines Roadtrips würdig ist?
Simeon:
Bei einem Roadtrip geht es nicht darum, irgendwo anzukommen, sondern unterwegs zu sein. Wichtig ist das, was auf der Reise passiert. Die Musik, die mich persönlich dabei begleitet, muss meine Gedanken und Gefühle auf einem bestimmten Punkt des Weges repräsentieren können. Außerdem muss sie eine Art Sehnsucht wecken. Und sie muss eine Klangwelt konstruieren, die mich sofort mitnimmt und neugierig macht auf das, was da akustisch passiert.

»Künstler sein war für mich immer etwas, das sehr weit entfernt von mir war.«
MYP Magazine:
2015 hast Du dich auf einen ausgedehnten Roadtrip entlang der nordamerikanischen Westküste begeben. Was hat Dich an diesem Fleckchen Erde so fasziniert, dass Du ihm mit „Shade Of A Giant“ gleich einen ganzen Song gewidmet hast?
Simeon:
Natur hatte immer schon eine große Anziehungskraft auf mich und ist seit meiner Kindheit ein Sehnsuchtsort. Aus diesem Grund habe ich mich damals auch auf den Weg nach Kanada und in die USA gemacht, wo ich drei Monate lang diverse Nationalparks abgefahren bin, im Auto geschlafen habe und das alles einfach auf mich wirken lassen wollte. Die Natur dort ist wirklich beeindruckend und hat mich regelrecht umgehauen. Ich vermute mal, dass ich nicht der Einzige bin, der sich dort vollkommen überwältigt gefühlt hat. In „Shade Of A Giant“ geht es konkret um die Magie des Redwood National Park in Nordkalifornien – außerdem beschreibt der Song für mich eine Art Wendepunkt.
MYP Magazine:
Inwiefern?
Simeon:
Ich habe mich auf dieser Reise zum ersten Mal mit der Geschichte der indigenen Völker Nordamerikas befasst, die in Kanada First Nations genannt werden. Ich weiß noch, wie ich ein paar Wochen nach meiner Ankunft im Museum für Anthropologie in Vancouver stand und mir eine Ausstellung über die Kwakwaka’wakw, Haida und Coast Salish angesehen habe. Das, was wir heute als Kunst und auch als deren Kunst wahrnehmen, wirkte auf mich eher wie ein Handwerk an Alltagsgegenständen, etwa wenn die Menschen beispielsweise ihre Schalen und Truhen, aber auch rituelle Gegenstände verzierten – also etwas sehr Praktisches und Nahes.
Das hat meine Sicht auf Kunst sehr verändert. Ich habe gemerkt: Kunst ist nichts, was man nur machen kann, wem man in einem entrückten Zustand ist. Kunst ist vielmehr etwas Alltägliches, was man einfach so tut, weil es ganz natürlich aus einem herauskommt.
Das klingt für andere vielleicht selbstverständlich. Aber da ich nicht aus einem superkreativen Elternhaus komme, war Künstler sein für mich immer etwas, das sehr weit entfernt von mir war. Zu checken, dass das gar nicht weit weg sein muss, sondern dass ich das aus mir heraus machen kann, nur mit dem, was ich habe, hat meine Sicht auch auf mich selbst total verändert. Plötzlich hatte ich das Gefühl, ganz neue Möglichkeiten zu haben. Das habe ich als eine große Wendung in meinem Leben empfunden.


»In Nordamerika war alles groß und weit und hell – ganz im Gegensatz zu Berlin.«
MYP Magazine:
Wie ist der Song dann konkret entstanden?
Simeon:
Als ich von meinem Roadtrip nach Berlin zurückkam, wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich hatte diesen typischen Berlin-Struggle mit Zwischenmiete und so weiter und saß dann vorübergehend in einem fremden, gammligen WG-Zimmer fest. Draußen baute sich gerade der Berliner Winter auf. Und so kauerte ich mit meiner Gitarre in der Hand unter schummrigen Licht auf meinem Bett und probierte ein bisschen herum. Plötzlich hatte ich dieses Riff, dieses Fingerpicking Pattern! In meinem Leben gibt es eigentlich selten diese Momente, in denen ich mich wirklich inspiriert fühle, aber in diesem Augenblick war mir irgendwie total klar, was da musikalisch passieren sollte.
Dieses Picking Pattern gab mir ein Gefühl, das mich nach vorne pushte. Ein Gefühl, das ich unbedingt auffangen wollte, weil es mich an meine Zeit im Sommer in Nordamerika erinnerte. Dort war alles groß und weit und hell – ganz im Gegensatz zu Berlin: Da war alles klein und eng und dunkel. So habe ich den Song geschrieben als ein Andenken – um dieser Erinnerung ein Denkmal zu setzen und sie für mich als Fixpunkt zu verankern.

»Es gibt im Musikgeschäft den Hype, dass man damit anfangen muss, solange man jung ist.«
MYP Magazine:
Fertiggestellt und veröffentlicht hast Du „Shade Of A Giant“ erst etliche Jahre später, im Juli 2022. Welche Bedeutung hat Zeit für Dich – privat wie auch in Deiner Musik?
Simeon:
Ja, tatsächlich liegen ein paar Jahre zwischen den ersten Songskizzen und der Veröffentlichung. Das hängt vor allem daran, dass ich meiner Musik lange nicht so viel Zeit und Aufmerksamkeit widmen konnte, wie ich wollte – und ich auch nie das Geld hatte, um mein Zeug von anderen Leuten produzieren zu lassen.
Durch das Recording von „Shade Of A Giant“ habe ich mich zum ersten Mal mit Musikproduktion auseinandergesetzt. Ich habe angefangen, mit Logic zu experimentieren, hatte mehrere Versionen des Songs auf meinem Computer, und ich weiß noch genau, dass es der 1. Mai 2019 war, als ich endlich eine Version aufgenommen hatte, bei der es klick machte. Am Tag der Arbeit!
Es gibt ja im Musikgeschäft den Hype, dass man damit anfangen muss, solange man jung ist. Diese Zeit ist aber bei mir schon vorbei, daher muss ich mein eigenes Tempo gehen. Und wenn zwischen dem ersten Schreiben und der Veröffentlichung so viel Zeit vergeht, dann ist mein Ziel jetzt, dass diese Zeit kürzer wird.
MYP Magazine:
Und, gelingt Dir das?
Simeon: (lächelt)
„Slow, Sleep, Fall“ zum Beispiel ist innerhalb einer halben Stunde entstanden. Ich war irgendwo in Berlin auf dem Rad unterwegs, hatte plötzlich einen Text im Kopf und wusste, wie das Ganze klingen soll. Dann bin ich schnell nach Hause geradelt und habe versucht, das auf der Gitarre nachzuspielen. Und 30 Minuten später war der Song da.

»In der Musik kann man sich die Welt nach seinen Ideen konstruieren.«
MYP Magazine:
Apropos Zeit. In einem Interview mit Soundbetter sagst Du: „It took me quite a long time to gather enough courage to work in music. And ever since I made that decision I feel like I am becoming a better version of myself.“ Was hat Dich so lange zurückgehalten?
Simeon:
Dafür gibt es sehr, sehr viele Gründe. Man hat im Leben immer Stimmen um einen herum, die einem einreden, dass das nicht funktionieren würde. Die Menschen, die einem so etwas sagen, haben für sich eine klare Vorstellung davon, wie es auszusehen hat, wenn man in der Musik arbeitet. Aber letztendlich ist dieses Feld so groß und weit, dass man dort wirklich alles machen kann, was man möchte. Es gibt ja keine wirkliche Vorgabe, man kann sich die Welt nach seinen Ideen konstruieren. Ich habe lange gebraucht, mich von diesen Stimmen zu emanzipieren. Ich hasse diesen Ausdruck eigentlich, aber seit ich die Entscheidung getroffen habe, merke ich, dass ich endlich ich bin und mich nicht mehr verbiegen muss. Natürlich gehen mit dieser Entscheidung auch eine Reihe neuer Probleme einher, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass sich die Dinge seither entwickeln, in Bewegung sind und ich das alles irgendwie in eine Richtung lenken kann, die ich für richtig halte. Für mich ist das eine Form von Selbstermächtigung.

»In der Rockmusik ging es erst mal nicht darum, wie es am Ende klingt, sondern was es mit den Menschen macht.«
MYP Magazine:
Als Teenager hast Du fast ausschließlich 60s Blues und Rock gehört. Ist es für Dich ein Widerspruch, heute selbst eine ganz andere Art von Musik zu machen als die, die Dich sozialisiert hat?
Simeon:
Ich weiß, genremäßig ist meine Musik eine ganz andere Baustelle. Und dazu ist sie auch noch sehr mellow. Aber ich sehe das gar nicht so als Widerspruch. Denn erstens versuche ich mehr und mehr, auch die Energie von Rock in meine Musik einfließen zu lassen. Und zweitens war es der Anspruch von Rockmusik in ihren Ursprüngen, abseits von ausgetretenen Pfaden neue Wege zu gehen und etwas Neues zu kreieren. Da ging es erst mal nicht darum, wie es am Ende klingt, sondern was es mit den Menschen macht. Genau dieses Ziel habe ich auch mit meiner Musik: am Ende etwas vollkommen Neues zu schaffen – mit einem Sound, der mein ganz eigener ist.

»Ich hatte das dringende Bedürfnis, jede einzelne Schraube erst raus- und dann wieder reinzudrehen.«
MYP Magazine:
Bevor Du angefangen hast, mit Deiner eigenen Gitarre Songs zu schreiben, hast Du lange Zeit die Gitarren anderer Musiker:innen repariert, und zwar im professionellen Stil. Wie bist Du zu diesem Job gekommen?
Simeon:
Gitarrenbau hat mich schon immer interessiert, auch weil ich aus einer Handwerkerfamilie stamme. Mein Großvater zum Beispiel war Uhrmacher. Als ich meine erste E-Gitarre hatte, saß ich bei ihm in der Werkstatt und wir fingen an, an meiner Gitarre rumzulöten. Ich hatte das dringende Bedürfnis, jede einzelne Schraube erst raus- und dann wieder reinzudrehen. Irgendwann mal, als ich als Student einen neuen Nebenjob brauchte, bin ich hier in Berlin auf einen Gitarrenladen gestoßen, wo Leute für das Reparaturgeschäft gesucht wurden. Ich habe mich beworben, wurde genommen und so fing es an.
Ein paar Jahre später habe ich mir dann eine eigene Werkstatt für Gitarrenreparatur und Service aufgebaut. Auch da konnte ich glücklicherweise auf meine Familie zurückgreifen. Meine Eltern hatten auf dem Dachboden noch eine hundert Jahre alte Werkbank rumstehen, die ich nur abholen musste.

»In anderen Bands und Konstellationen sehe ich mich eher als Handwerker.«
MYP Magazine:
Beeinflusst Deine handwerkliche Arbeit an dem Instrument auch Deine künstlerische?
Simeon:
Ich würde eher sagen, dass es in den Prozessen gewisse Parallelen gibt. Etwa den Grundsatz, dass man von grob zu fein arbeitet. Oder den Prozess in verschiedene Kapitel unterteilt, um eine gewisse Klarheit sowie einen Flow zu erreichen. Das kann ich eher vom Handwerk in die Musik übertragen als andersherum.
Daneben ist es so, dass ich auch in anderen Bands und Konstellationen Musik mache. Dort sehe ich mich selbst eher als Handwerker, der eine Fähigkeit anbietet und mit einem ganz klaren Rezept durchzieht – ganz im Gegensatz zu meiner eigenen Musik, wo ich versuche, meinen eigenen Weg zu finden.


»Radiohead ist der Spiegel, in dem ich mich anders sehe.«
MYP Magazine:
Du bist ein riesiger Radiohead-Fan. Was genau packt Dich so an der Musik?
Simeon:
Radiohead steht für mich für etwas grundlegend Neues, das es vorher in der Form nicht gab. Das meine ich nicht nur in Bezug auf die vielen neuen Technologien, mit denen die Band immer schon experimentiert hat. Ihre Musik löst etwas in mir aus, das ich vorher noch nicht kannte. Radiohead ist der Spiegel, in dem ich mich anders sehe. Ich fange an, mich mit anderen Themen auseinanderzusetzen oder Dinge neu zu denken. Und abgesehen davon haben sie natürlich richtig geile Songs.
MYP Magazine:
Wir haben ganz am Anfang über den Roadtrip-Gedanken Deiner Musik gesprochen, mit dem wir das Interview auch beenden möchten: Wie müsste für Dich die perfekte Strecke zu Deinen Songs aussehen?
Simeon:
Ich hoffe, dass meine Musik so offen gestaltet ist, dass sie zu vielen verschiedenen Landschaften passt. Und ich hoffe, dass die äußere Reise auch eine innere Reise auslöst. Dass die Songs etwas mit den Leuten machen. Aber überhaupt im Auto zu sitzen und zu rollen, ist schon mal eine gute Sache.

Mehr von und über aa–legrand:
Interview und Text: Jonas Meyer
Fotografie: Nis Alps






















