Interview — Ancient Methods
Im Bann der Achtsamkeit
Seit Mitte der 90er steht Michael Wollenhaupt mit seinem Sound für die rohe und durchtriebene Seite des Techno. Wir wollten mit dem Berliner ein wenig in der Vergangenheit schwelgen, doch am Ende wurde es ein Gespräch über die Gegenwart – inklusive der Erkenntnis, dass Schranz nicht nur ein fürchterlicher Name ist und die Band „Dead Can Dance“ gottgleich über allem steht.
30. Dezember 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Franz Grünewald
Als im Mai 2005 das Gebäude des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses in Berlin-Mitte abgerissen wurde, war das für viele Menschen nicht nur ein Schock, sondern auch das Ende einer Ära. Denn das, was von außen so grau und unscheinbar aussah, beherbergte in seinem tiefsten Innern – genauer gesagt im ehemaligen Tresorraum des Hauses – den damals wohl berühmtesten Techno-Club der Welt: den Tresor.
Als er im März 1991 eröffnet wurde, war der Tresor der allererste Techno-Club Berlins und setzte mit seinem harten, maschinellen Sound Maßstäbe in der Welt des Techno. 14 Jahre lang galt der Club an der Leipziger Straße 126 als eine musikalische Institution und war die erste Anlaufstelle für Techno-Liebhaber aus aller Welt. Bis die Abrissbirne kam.
Nun ist es nicht jedermanns Geschmack, allzu lange in der Vergangenheit zu schwelgen und dem nachzutrauern, was mal war. Manche Menschen haben einfach viel mehr Spaß daran, die Gegenwart zu greifen und sich auf das zu freuen, was noch kommt. Zu diesen Menschen gehört Michael Wollenhaupt. Seit Mitte der 90er Jahre bereichert er als Techno-Künstler die Welt mit seinem rauen, schlagenden Sound und gilt als feste Größe in der Berliner Techno-Szene. Daneben arbeitet er als Rechtsanwalt.
Bis zum April 2005 gehörte Micha auch zum musikalischen Stammpersonal des Tresor und prägte so – gemeinsam mit den anderen Residents – den Sound einer ganzen Generation. Als der Club im Jahr 2007 an anderer Adresse wieder öffnete, entschloss sich Micha, seine Residency nicht fortzuführen, und gründete zusammen mit Conrad Protzmann das Label und Musikprojekt Ancient Methods. Heute ist Michael Wollenhaupt alleine unter diesem Namen unterwegs und steht mit seiner Musik nach wie vor für die resoluteste und durchdringendste Facette, die Techno zu bieten hat. In einem Park in Berlin-Pankow haben wir ihn zum Gespräch getroffen.
Jonas:
Ich würde mit Dir gerne einen Blick zurück ins Jahr 2007 werfen. In diesem Jahr hat nicht nur der Tresor wiedereröffnet, du hast auch dein Referendariat abgeschlossen, dich als Rechtsanwalt selbständig gemacht und nebenbei Ancient Methods aus der Taufe gehoben. Welches dieser Ereignisse berührt dich heute, zehn Jahre später, noch am stärksten?
Micha:
Die Ereignisse, die du aufzählst, sind für mich mehr oder weniger gleichbedeutend. Alle sind natürlich wichtig für mein Leben. Aber dass mir ein einzelnes besonders stark in Erinnerung geblieben wäre oder mich in besonderer Weise berühren würde, kann ich nicht behaupten. Dennoch war 2007 natürlich ein Jahr, in dem wirklich viel passiert ist. Aber mindestens genauso viel hat sich seitdem auch verändert, alleine musikalisch: etwa dieser Buzz oder dieser Hype, den man heute bei so Vielem wahrnehmen kann, was neu entsteht. Das gab es 2007 einfach nicht.
Was speziell die Entstehung von Ancient Methods angeht, war das auch vielmehr ein Prozess als ein singuläres Ereignis. Im Jahr 2007 haben wir ganz langsam damit angefangen und im Laufe der Zeit einfach geschaut, wohin es sich entwickelt. Bis das Label dann überhaupt mal auf eine gewisse Wahrnehmung gestoßen ist, hat es eine ganze Weile gedauert.
Jonas:
Im Jahr 1991, als der Tresor in der Leipziger Straße in Mitte eröffnet hat, war Techno-Musik noch Teil einer kleinen Subkultur und im Gegensatz zu heute alles andere als Massenware – im Tresor fanden die Partys im wahrsten Sinne des Wortes im Untergrund statt. Auch wenn du 1991 noch nicht ganz im ausgehfähigen Alter warst, hast du dich dennoch bereits mit Techno beschäftigt. Wie und wo bist du dieser Musik zum ersten Mal begegnet?
Micha:
Im Radio – damals hat man ja noch Radio gehört. Anfang der 90er gab es zwei Sendungen, die man fleißig auf Tape mitgeschnitten hat. Als ich dann zwei, drei Jahre später im – wie du sagst – ausgehfähigen, aber immer noch minderjährigen Alter war, bin ich mit Freunden öfter mal nach Potsdam ins „Waschhaus“ gefahren. Die Partys dort waren so ein bisschen jugendclubmäßig: Wirklich jeder wurde reingelassen und das Bier hat nur ne Mark gekostet. Zum ersten Mal im Tresor gefeiert habe ich dann irgendwann Mitte der 90er.
Jonas:
Aktuelle Bücher wie Berlin Wonderland oder Der Klang der Familie beschreiben sehr detailliert, wie sich die ersten Jahre nach dem Mauerfall in Ost- und West-Berlin angefühlt haben müssen. Vor allem was die Entstehung der Techno-Szene angeht, scheint es eine regelrechte Aufbruchsstimmung und Euphorie gegeben zu haben. Welche Erinnerungen hast du selbst an diese Zeit? Wie hat sich Berlin damals für dich angefühlt?
Auch wenn man als Teenager in der Regel noch nicht so reflektiert ist, hatte ich in dieser Zeit das Gefühl, bei etwas komplett Neuem dabei zu sein. Das war alles sehr, sehr punkig. Und wirklich besonders.
Micha:
Damals kam alles zusammen: der gesellschaftliche Wandel und gleichzeitig Techno als musikalische Revolution. Das war Techno übrigens tatsächlich: eine Revolution.
Auch wenn man als Teenager in der Regel noch nicht so reflektiert ist, hatte ich in dieser Zeit das Gefühl, bei etwas komplett Neuem dabei zu sein. Zwar bin ich in der Berliner Vorstadt aufgewachsen, wo alles nochmal anders ist als im Zentrum, aber gerade wenn man von der Vorstadt nach Berlin reingefahren ist, hat sich alles sehr frei und wild angefühlt. Damals ist man einfach in irgendwelche Keller reingeklettert, in denen dann Techno-Partys veranstaltet wurden. Das war alles sehr, sehr punkig. Und wirklich besonders.
Allerdings weiß ich nicht, ob dieses Gefühl des Besonderen allein durch die damalige Situation in Berlin entstanden ist oder doch eher durch die generelle Faszination der Jugend: In diesem Alter geht man zum ersten Mal weg, man hört zum ersten Mal seine Musik, man ist einfach nur jung – das ist schon besonders genug. Und sehr intensiv. Im Nachhinein fällt es mir wirklich schwer, das auseinanderzuhalten. Möglicherweise würde ich eine ähnliche Faszination auch heute verspüren, wenn ich zum ersten Mal ausgehen würde. Aber klar, die Freiräume, die man damals kurz nach der Wende hatte, waren natürlich ganz andere.
Jonas:
Gab es für dich einen Schlüsselmoment, in dem du gewusst hast: Techno ist etwas, das du nicht nur hören und dazu tanzen willst – du willst diese Musik auch machen?
Anfang der 90er war es viel schwieriger, sich bestimmte Dinge zu erschließen: An das Know-how eines DJs und insbesondere eines Produzenten kam man nicht so ohne Weiteres heran. Heute macht man zwei Klicks und weiß, wie’s geht.
Micha:
Naja, ich habe schon immer selbst Musik gemacht, auch vor Techno. Ich habe eine klassische Musikausbildung, Musik war für mich auch immer mehr als nur Konsum. Daher gab es nicht diese eine Entscheidung, dass ich unbedingt Produzent werden wollte. Das war einfach ein natürlicher Flow. Ich habe Platten gekauft und mich dafür interessiert, was die DJs da an ihren Geräten machten – und wie sie es machten.
Ich glaube, irgendwann habe ich in den Clubs mehr herumgestanden als getanzt, weil ich die Arbeit der DJs genau beobachten wollte. Und dann habe ich mir nach und nach eigene Geräte angeschafft, weil ich dachte, damit könnte ich jetzt auch diese Art von Musik machen. Aber ich habe ganz schnell gemerkt: Damit alleine geht’s halt doch nicht.
Man muss sich auch vorstellen, dass das alles lange vor dem Internet-Zeitalter war. Anfang der 90er war es viel schwieriger, sich bestimmte Dinge zu erschließen. Heute macht man zwei Klicks und weiß, wie’s geht. Aber zu jener Zeit kam man an das Know-how eines DJs und insbesondere eines Produzenten nicht so ohne Weiteres heran. Wenn man wie ich niemanden kannte, der das irgendwie auch machte und von dem man das lernen konnte, musste man sich alles im Try-and-error-Prinzip selbst beibringen.
Genauso schwierig war es übrigens auch, eine ganz bestimmte Platte zu finden, wenn man den entsprechenden Track nur als Radiomitschnitt auf Tape hatte und weder wusste, wie dieser Song heißt, noch wer der Interpret ist. Es gab ja kein Shazam oder so etwas ¬– man musste den Sachen manchmal jahrelang nachjagen. Wenn man dann durch Zufall in einem Plattenladen genau die Platte gefunden hatte, nach der man seit Jahren gesucht hatte, war das wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Dieses Glücksgefühl kann man gar nicht beschreiben – es existiert in dieser Form auch heute nicht mehr: Mit Shazam braucht man zwei Klicks, danach verrottet der Song auf der Festplatte.
Jonas:
Irgendwann hast du es geschafft, von der Tanzfläche zu dem Platz hinter dem DJ-Pult zu wechseln. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal im Tresor aufgelegt hast?
Micha:
Ja, das weiß ich sogar ziemlich genau. Das war 1998, also vor knapp 20 Jahren.
Jonas:
Interessanterweise war das auch das Jahr, in dem du angefangen hast, Jura zu studieren.
Micha:
Ja, der erste Auftritt im Tresor war knapp vor Semesterbeginn.
Jonas:
Rechtswissenschaft gehört zu den Studiengängen, für die man besonders viel Zeit und Energie braucht. War es für dich jemals ein Problem, Musik und Studium unter einen Hut zu bringen?
Micha:
Nein, so richtig problematisch wurde das für mich nie. Ich habe mir einfach Prioritäten gesetzt und das Studium irgendwie durchgezogen. Mein großes Glück war es, dass ich als Student bei Hard Wax jobben konnte. Dadurch hatte ich eine permanente Verbindung zu Musik. In diesen Jahren habe ich mir selbst immer mehr Platten zugelegt und hier und da ein bisschen aufgelegt…
Jonas:
… und wurdest im Tresor einer der Residents, bis der Club im April 2005 geschlossen wurde – eine Zäsur für die Berliner Techno-Szene. Zum Abschied gab es ein zweiwöchiges Event namens „Leaving Home“, du selbst warst damals einer der Letzten, die im alten Tresor spielen durften. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dich an die letzten Tage und Stunden dort erinnerst? Was war das für eine Stimmung?
Micha:
Der alte Tresor war sehr intensiv und diese letzten Nächte waren nochmal intensiver. Der Laden war gefühlt wesentlich kleiner als der neue Tresor und dementsprechend immer sehr voll. Es gab dort eine unglaubliche Energie, die über die letzten zwei Wochen nochmal gesteigert wurde.
Ich selbst habe in diesen zwei Wochen aber nicht alles mitgemacht. Ich neige übrigens auch nicht so zum Pathetischen, dass ich jetzt unbedingt sagen würde: Das war das Ende einer Ära. Dennoch gab es in Berlin – und anderen Gegenden – in der Zeit nach dem alten Tresor ein großes Loch, nicht nur in Bezug auf die Clublandschaft, sondern auch musikalisch: Was bis zum Schluss im April 2005 im Tresor lief, gab es danach in Berlin so gut wie nicht mehr.
Jonas:
Dort, wo früher der Tresor war, findet man heute die Garageneinfahrt zu einem Bürokomplex. Wie geht es dir, wenn du an der Leipziger Straße 126 vorbeifährst?
Micha:
Es gibt so viele Plätze in Berlin, die überhaupt nicht wiederzuerkennen sind. Zeitlich kann man sogar noch weiter zurückgehen, beispielsweise in die 1990er Jahre. Da gab es etwa am Kollwitzplatz irgendwelche Keller von irgendwelchen zerschossenen Gebäuden, in denen man Techno-Partys feierte. Alles weg.
Jonas:
Und heute wird sich am Kollwitzplatz beschwert, wenn nach 22 Uhr noch laute Musik zu hören ist.
Ich bin nicht allzu sentimental – ich glaube auch, dass jede neue Zeit nicht nur ihre Nachteile, sondern auch ihre Vorteile hat.
Micha:
Ach, laute Musik läuft dort schon lange nicht mehr. Aber ich bin da auch nicht allzu sentimental. Ich erinnere mich zwar gerne an die Dinge, die ich an den jeweiligen Orten gemacht habe. Aber ich glaube auch, dass jede neue Zeit nicht nur ihre Nachteile, sondern auch ihre Vorteile hat. Es ist natürlich immer schade, wenn so eine kulturelle Institution wie der Tresor einem Bürogebäude weichen muss. Aber irgendwie geht’s auch immer weiter und an anderen Stellen entstehen neue Sachen.
Jonas:
Als 2005 der Tresor geschlossen wurde, hattest du gerade dein erstes Staatsexamen in der Tasche und bist ins Referendariat gestartet. Danach – zwei Jahre später – hast du zusammen mit Conrad Protzmann Ancient Methods gegründet, und zwar kurze Zeit nachdem der neue Tresor im Kraftwerk Mitte eröffnet hatte. Wie kam es dazu?
Micha:
Der neue Tresor ist mit fast allen DJs gestartet, die auch im alten Club als Residents vertreten waren. Für uns alle war das eine unglaublich schwierige Zeit, denn Techno war absolut tot. Oder besser gesagt: Die Form von Techno, die man gut fand, gab es so nicht mehr in Berlin, in den Clubs wurde nun ein anderer Sound gespielt. Man hörte hauptsächlich House und Minimal, auch in den vielen alternativen Läden, die zu dieser Zeit gegründet wurden. Die Musik, die ich selbst so mochte, konnte ich nirgendwo mehr finden. So ist Ancient Methods aus einer Krise heraus entstanden.
Jonas:
Was genau hast du vermisst?
Micha:
Das, wofür der alte Tresor stand: diesen roughen Birmingham-Sound, den wir dort gespielt haben. Aber 2007 war all das Physikalische, Raue, Punkige plötzlich einem biederen Lounge-Techno gewichen, der meiner Meinung nach nichts mehr mit Techno zu tun hat. Die Musik, die man nun überall in den Clubs hören konnte, war eher so im House-Bereich angesiedelt – das ist zwar nett, aber für mich persönlich eine ganz andere Welt. Dieses Minimal-Housige wurde zu einer große Strömung, in der immer mehr Künstler mitgeschwommen sind. Dementsprechend haben sich auch die Bookings der Berliner Clubs angepasst. Für mich war das letztendlich ein wesentlicher Grund, warum ich im neuen Tresor die Residency nicht fortgeführt habe.
Zwar haben Freunde von mir damals noch versucht, eigene Partys auf die Beine zu stellen, um diesen alten Tresor-Sound am Leben zu halten. Aber das Ganze war mittlerweile so nischenartig geworden, dass man kaum noch Leute finden konnte, die das hören wollten.
Jonas:
Hast du die Gründung des Berghain im Jahr 2004 als eine Bereicherung empfunden? Oder ist man dort musikalisch ebenfalls in Richtungen gelaufen, mit denen du nichts anfangen kannst?
Micha:
Egal wo ich zu der damaligen Zeit hingegangen bin: Diese Form von Techno, die ich gesucht habe, gab es einfach nicht mehr. Viele DJs, die für diese Musik standen, haben ihren Sound plötzlich verändert. Ob sie sich nicht mehr getraut haben oder das Interesse an diesem Sound verloren haben – ich weiß es nicht. Ich selbst jedenfalls habe mich dann fast nur noch auf EBM- und Industrial-Partys herumgetrieben. Das kam dem noch am nächsten, was ich unter Techno verstehe – und was heute, zehn Jahre später, wieder populär geworden ist und in vielen Läden wieder gespielt wird.
Jonas:
Glaubst du, dass das, was in den Clubs aufgelegt wird, auch in irgendeiner Art und Weise von der jeweils aktuellen gesellschaftlichen Stimmung beeinflusst wird?
Der etwas härtere Techno verlor von Jahr zu Jahr an Strahl- und Innovationskraft und wurde zunehmend in andere Richtungen entwickelt. Am Ende kam dabei so etwas wie Schranz heraus – ein fürchterlicher Name für fürchterliche Musik.
Micha:
Dazu gibt es ja viele Theorien – zum Beispiel die, dass man in dunkleren Zeiten auch dunklere Musik spielt. Ich finde, man kann viel über solche eventuellen Zusammenhänge theoretisieren. Woran macht man überhaupt fest, ob die Zeiten gerade besser oder schlechter sind? An der ökonomischen Situation? An der gesellschaftlichen? An der politischen? Wenn man schaut, was gerade so in der Welt los ist, kann man nicht unbedingt sagen, dass wir in besseren Zeiten leben. Aber ist die Musik in den Clubs daher gerade dunkler oder härter? Ich weiß es nicht. Diese Theorien sind für mich immer etwas vage und abstrakt, man kann da schnell vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ich persönlich sehe solche Entwicklungen eher rein musikalisch: In mehr oder weniger regelmäßigen Zyklen entstehen immer wieder bestimmte Strömungen, die stärker und stärker werden, bis sie irgendwann ihren Sättigungspunkt erreichen. Danach geht mit einem anderen Trend alles wieder von vorne los.
Was die Situation Ende der 1990er, Anfang der 2000er angeht, als dieser roughe Sound immer mehr aus den Berliner Clubs verschwand, sind die Gründe viel trivialer und in der Musik selbst zu suchen. Damals verlor der etwas härtere Techno von Jahr zu Jahr an Strahl- und Innovationskraft und wurde zunehmend in andere Richtungen entwickelt. Am Ende kam dabei zum Beispiel so etwas wie Schranz heraus – ein fürchterlicher Name für fürchterliche Musik.
Dieses brachiale, aber blutleere Loop-Gebrettere hat all die Leute, die sich nicht dauerbetrogt haben, relativ schnell abgetörnt. Also haben sie nach etwas anderem gesucht und sind wieder in die komplett andere Richtung gedriftet – wie das eben so ist mit Trends und Strömungen, die vom einen Pol zum anderen schwanken. Letztendlich hat dieser Overkill damals die härtere Form von Techno total ausgelöscht.
Jonas:
Hattest du nicht die Sorge, dass du gerade in dieser Situation mit deiner Musik und der Rückbesinnung auf den roughen Birmingham-Sound niemanden erreichen kannst?
Micha:
Mir war am Anfang des Projekts natürlich klar, dass diese Musik zu dieser Zeit keiner hören wollte. An dieser Stelle hat das für mich aber überhaupt keine Rolle gespielt. Mein Gedanke war eher: Wenn es gerade niemanden gibt, der ernsthaft solche Musik macht, machen wir’s halt selbst. Eine große Hilfe dabei war uns übrigens Torsten aus dem Hard Wax, der sich das Ganze angehört und uns von Anfang an unterstützt hat. Ohne seinen Support wäre es uns zu der damaligen Zeit nicht möglich gewesen, das Label Ancient Methods überhaupt zu vertreiben. Es hat auch ganze zwei Jahre gedauert, bis die wirklich kleine Auflage unserer ersten Platte verkauft war.
Jonas:
Wann hast du gespürt, dass sich das Ganze dennoch irgendwie entwickelt und die Leute so langsam auf den Trichter kommen?
Micha:
Wenn ich sage, dass niemand diese Musik hören wollte, ist das nicht ganz richtig. Es gab eine klitzekleine Community, die von Anfang an sehr wohlwollend wahrgenommen hat, was wir da getan haben. Das war natürlich ein kleiner Hoffnungsschimmer, der mich in meinem Gefühl bestätigt hat, dass es da draußen auch Menschen geben muss, die sich nach dieser Musik sehnen und sie vermissen. Und die hoffen, dass aus dieser Richtung wieder irgendetwas kommt. So konnte sich das Projekt über die Jahre allmählich entwickeln.
Ungefähr ab dem Jahr 2009, 2010 war zu bemerken, dass sich in diesem musikalischen Bereich auch andere Projekte und Labels gründeten, deren Sound in eine ähnliche Richtung ging. Diese Szene hat dann immer mehr Fahrt aufgenommen und Musik hervorgebracht, die man selbst wieder kaufen und hören wollte. Und heute sind wir meiner Wahrnehmung nach in einer Situation, in der diese Form von Techno-Musik zwar noch keinen Hype ausgelöst hat, aber zumindest wieder auf eine breitere Akzeptanz und auch auf Assimilation stößt.
Jonas:
Die Kollegen der Wiener Festwochen beschreiben dich als einen Künstler, der „seit gut zehn Jahren als einer der absoluten Erneuerer der lokalen Technoschule gesehen werden“ kann. In diesem Zusammenhang wirkt der Name Ancient Methods, den man etwa mit „altertümliche Praktiken“ übersetzen könnte, wie ein absoluter Gegensatz – der durch deine mit Kupferstichen gestalteten Platten-Artworks noch verstärkt wird. Wo verortest du dich selbst? Bist du Erneuerer oder Konservator?
Jeder, der denkt, seine Musik sei irgendwie objektiv neu, hat vermutlich noch nicht genug andere Musik gehört in seinem Leben.
Micha:
Das ist eine reine Geschmacksfrage – der eine sieht das so und der andere ganz anders. Ich selbst denke darüber aber gar nicht nach. Ich mache einfach das, was ich gut finde. Ob das dann wirklich neu ist – so eine Selbstwahrnehmung wäre mir zu narzisstisch. Musik macht man ja nicht, um etwas absolut Neues zu erschaffen. Das ist kein wirklich naheliegender Ansatz.
Ohnehin hat jeder, der denkt, seine Musik sei irgendwie objektiv neu, vermutlich noch nicht genug andere Musik gehört in seinem Leben. Egal worauf man zurückgreift: Spätestens wenn man im Internet recherchiert, erfährt man, dass alles schon mal da war und es alles bereits in ähnlicher oder sehr ähnlicher Weise gegeben hat. Zwar entstehen immer wieder mal neue musikalische Kombinationen, die einen gewissen neuheitlichen Charakter haben, letztendlich wirkt das alles aber nur subjektiv neu. In der Musik ist seit Jahren, seit Jahrzehnten nichts tatsächlich Neues mehr erschaffen worden. Daher wäre es auch verrückt oder müsste in Ernüchterung enden, sich mit dem Anspruch eines Erneuerers an seine Geräte zu setzen.
Jonas:
Im Hintergrund läuft gerade Elvis Presley – diese Musik wurde mal als eine Revolution empfunden, weil sie etwas absolut Neues war.
Micha:
Ja, wie Techno im Jahr 1991. Aber Techno war auch die letzte große musikalische Revolution – oder besser gesagt elektronische Musik allgemein, ich will das gar nicht auf Techno herunterbrechen. Ich denke, danach war alles, was an Musik geschaffen wurde, nur noch eine Melange, ein Crossover. Das bedeutet nicht, dass es nicht ständig neue, absolut großartige Musik geben würde. Dieses Attribut der Neuheit, das gerade im Bereich von elektronischer Musik inflationär gebraucht wird, ist ja auch keinesfalls ein Garant für musikalische Qualität – vielmehr finde ich, dass dies im Bereich der Musik schlicht irrelevant ist.
Jonas:
Ist die Art und Weise, wie heute die Menschen im Club auf Techno reagieren, eine andere als Anfang der 90er, als diese Musik noch etwas absolut Neues war?
Die Mechanismen, wie Techno-Musik auf Menschen wirkt, sind immer noch dieselben wie vor 25 Jahren: Erst gibt’s den Break, dann setzt wieder die gerade Bassdrum mit der offenen Hi-Hat ein und alle drehen plötzlich durch.
Micha:
Ganz allgemein hat sich für meine Begriffe kaum verändert, wie die Leute zu Techno feiern. Die Mechanismen, wie diese Musik auf Menschen wirkt, sind auch immer noch dieselben wie vor 25 Jahren: Erst gibt’s den Break, dann setzt wieder die gerade Bassdrum mit der offenen Hi-Hat ein und alle drehen plötzlich durch.
Auch wenn sich das gerade so negativ anhört, will ich das gar nicht schlecht machen: Diese supersimple Formel scheint immer noch genauso zu funktionieren wie Anfang der 90er: Bass raus, Bass rein – das ist eines der Kernelemente. Techno funktioniert schlicht und einfach über die Physis.
Zu meiner eigenen Musik kann ich sagen: Als ich mit Ancient Methods gestartet bin, habe ich immer vor einem sehr speziellen, kleinen Publikum gespielt. Die Leute wussten genau, was sie erwartet – Irritationen gab’s da relativ selten. Glücklicherweise ist es auch heute noch so, dass ich so gut wie nie auf Partys spiele, wo die Leute mit dem Sound absolut gar nichts anzufangen wissen. Meistens schauen sich die Promoter der Party vorher auch ganz genau an, was der betreffende Künstler macht und ob das passt. Gerade habe ich beispielsweise auf einem Festival in Saint-Étienne bei Lyon gespielt, das war ziemlich crossover-mäßig. Es gab viele Post Punk-Bands, EBM-Artists und Techno-Leute – also genau der Querschnitt, den ich auch persönlich sehr mag. Wer eine solche Veranstaltung besucht, trifft eine sehr bewusste Entscheidung und weiß ziemlich genau, was er bekommt. Dass dort jemand eher zufällig landet, passiert wirklich selten.
Jonas:
Wie entsteht bei dir ein Track? Wie fängst du an?
Micha:
Meistens wächst in meinem Kopf eine sehr konkrete Idee heran, die ich dann – mit meinen begrenzten musikalischen und technischen Fähigkeiten – versuche umzusetzen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht der Allerschnellste im Produzieren bin. Bis ein Track bei mir fertig ist, dauert es wirklich lange. Aber wenn ich einmal eine konkrete Idee vor Augen habe, will ich absolut nichts anderes machen und daher experimentiere ich auch nicht sehr viel herum.
In der Techno-Welt gibt es sicher auch viele Künstler, die einen anderen Ansatz wählen und sich mehr von den Maschinen inspirieren lassen. Sie lassen ihre Geräte so lange laufen, bis sie etwas haben, das ihnen gefällt. Bei mir ist das eher nicht so. Ich will mich nicht von den Maschinen treiben lassen, sondern von meinen Ideen. Aber um diese Ideen umzusetzen, habe ich mit diesen Maschinen einen musikalischen Werkzeugkasten, auf den ich immer wieder zurückgreifen kann.
Jonas:
Hast du für dich einen Kompass, wo du mit deiner Musik hinwillst? Oder gibt es diese eine, große Idee gar nicht?
Micha:
Außerhalb des rein Musikalischen habe ich überhaupt kein Konzept, in dem ich festgelegt habe, wann ich was erreicht haben will. Dafür habe ich aber immer sehr viele musikalische Bilder im Kopf, die alle schon recht greifbar sind. Diese Bilder verlassen mich nicht, auch nicht, wenn ich eine Nacht darüber schlafe. Nur leider ist es manchmal für mich sehr schwierig, meine Bilder in Musik zu transformieren. Klar, einzelne Ideen oder Melodien hat man natürlich schnell mal niedergeschrieben. Aber in meinem Kopf gibt es mehr oder weniger komplette, relativ konkrete Song-Ideen, die ich seit gut zwei Jahren mit mir herumtrage und die meinen Kopf noch nie verlassen haben.
Es gibt da sogar Ideen, die musikalisch ganz anders sind als das, was ich zur Zeit mache – ich würde damit das Feld des klassischen Techno komplett verlassen. Ich habe den großen Wunsch, auch diese Ideen mal umzusetzen, allerdings weiß ich einfach nicht wann – die größte Restriktion, mit der ich zu kämpfen habe, ist die fehlende Zeit.
Jonas:
Aber du hast ja noch ein ganzes Leben vor dir.
Micha: (lächelt)
Hm, naja. Der Countdown tickt zwar schon, aber ja – ein bisschen Zeit ist noch.
Jonas:
Du hast eben den Moment im Club angesprochen, in dem alle Leute durchdrehen und in Ekstase verfallen. Derartige Reaktionen des Publikums gab es in der Geschichte der Musik immer wieder, insbesondere wenn es plötzlich etwas zu hören und zu sehen gab, das die Welt vorher nicht kannte – beispielsweise bei Elvis Presley, über den wir bereits gesprochen haben, oder den Beatles. Gibt es für dich selbst außerhalb des Techno bestimmte Genres oder Bands, die bei dir ähnlich starke Emotionen auslösen?
Ekstase beschreibt einen Zustand, in dem man über eine vollkommen ungeteilte Achtsamkeit verfügt. In unserer heutigen Zeit, in der man am laufenden Band Links um die Ohren gehauen bekommt, ist es sehr schwierig, Musik mit ungeteilter Achtsamkeit zu hören.
Micha:
Das kommt darauf an, was man genau unter Ekstase versteht. Ekstase ist für mich in erster Linie etwas Körperliches. Bei mir ist das allerdings weniger stark ausgeprägt – zumindest was die Musik angeht. Oder um es einfacher zu sagen: Ich bin nicht so der Tänzer. (Micha lächelt)
Daneben hat Ekstase für mich aber auch einen sehr starken aktiv-meditativen Aspekt und beschreibt einen Zustand, in dem man über eine vollkommen ungeteilte Achtsamkeit verfügt. In unserer heutigen Zeit, in der man am laufenden Band Links um die Ohren gehauen bekommt, ist es sehr schwierig, Musik mit ungeteilter Achtsamkeit zu hören. Es gibt auch relativ wenig Musik, die die Sogkraft hat, einen aus seinem täglichen Information Overload herauszuziehen. Aber es gibt diese Musik! Auch für mich persönlich – und auch außerhalb des Techno. Es gibt Stücke, die ich schon hundertmal oder tausendmal gehört habe und bei denen ich immer noch Gänsehaut bekomme, wenn ich sie höre.
Die dafür absolut prädestinierteste Band ist meiner Meinung nach Dead Can Dance. Diese Band ist für mich eine Institution, die gottgleich über allem anderen steht, was man als Musik bezeichnen kann. Dead Can Dance spielt mit vielen traditionellen Elementen und kombiniert sie auf völlig neue Art und Weise. Daraus entsteht eine unglaubliche Musikalität, die an der einen Stelle auf sehr simplen Formeln basieren kann und an der anderen Stelle äußerst anspruchsvolle Kompositionen und raffinierte Arrangements beinhaltet. Auch wenn es abgedroschen klingt: Immer wenn ich diese Band höre, erlebe ich aufs Neue, wie ich alles um mich herum vergesse und in den Bann der Achtsamkeit hineingezogen werde.
Jonas:
Auf deiner Website findet sich nur ein einziger Satz: „Music will tear down walls.“ Das ist ein wunderschöner, aber auch hoch gesteckter Anspruch an sich selbst. Wie lange begleitet dich dieser Satz schon?
Micha:
In Deutschland gab es leider ein sehr ausgeprägtes Genre- und Szenendenken, das die musikalischen Stile stark voneinander separiert haben. Vor allem in der Techno-Welt fand man immer schon Leute, die nichts voneinander wussten oder wissen wollten, weil sie sich teilweise auch nicht mochten. Das fand ich immer ein bisschen schade. So ist Ancient Methods damals auch mit der Idee entstanden, Brücken zu schlagen, Grenzen von Subkulturen zu überwinden und bestimmte musikalische Welten miteinander zu verbinden, die stark voneinander separiert waren – und in manchen Köpfen immer noch separiert sind. So wie ich das wahrnehme, ist diese Entwicklung gerade in vollem Gange, nicht nur bei meiner Musik.
Jonas:
Jetzt könnte man scherzhaft sagen, dass auch David Hasselhoff fest davon ausgeht, dass er mit seiner Musik die Mauer niedergesungen hat. Aber Spaß beiseite: Glaubst du, dass Musik – und insbesondere Techno – irgendeinen Anteil daran hat, dass es den 9. November 1989 geben konnte?
Ich kann ich sehr gut nachempfinden, wie es sich anfühlt, wenn man sich nach Musik sehnt, die einfach nicht verfügbar ist. Aus dieser Sehnsucht heraus kann ein enormer Antrieb entstehen, der auch in der Lage ist, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen.
Micha:
Ich bin zu nüchtern eingestellt, um dieser Annahme zu folgen, zumal die Techno-Bewegung in Deutschland und speziell in Berlin erst nach dem Mauerfall ins Rollen kam. Damals war es einfach eine glückliche Fügung, dass dieses Stück Anarchie, das in Ost-Berlin und der Noch-DDR für ein, zwei Jahre existierte, einen optimalen Nährboden bereitet hat, auf dem sich die Techno-Musik entwickeln konnte.
Generell glaube ich aber schon, dass Musik immer ein gewisser Antrieb für Veränderung sein kann. Mit Blick auf die Wendezeit kann ich mir auch gut vorstellen, dass es bestimmte Leute gab, für die es die größte Motivation war, mit ihrer Musik etwas anderes anzustoßen. Wenn ich mich in deren damalige Lage versetze, kann ich sehr gut nachempfinden, wie es sich anfühlt, wenn man sich nach Musik sehnt, die einfach nicht verfügbar ist – egal ob man sie selbst machen oder nur konsumieren will. Aus dieser Sehnsucht heraus kann ein enormer Antrieb entstehen, der auch in der Lage ist, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Musik ist einfach eine unglaublich starke Kraft.
Heutzutage ist Musik viel einfacher verfügbar. Aber gerade in Situationen des Mangels oder der Verwehrung erwächst eine besondere Motivation, etwas zu verändern. Das ist durchaus auch materialistisch gemeint, da Musikkonsum am Ende auch Konsum, also etwas Materialistisches ist. Nur dass diese Konsumart neben allen anderen vielleicht die schönste ist – und die, die am meisten motivieren kann.
Jonas:
Man hat das Gefühl, dass im zurückliegenden Jahr 2017 vielmehr darüber nachgedacht wurde, neue Mauern und Zäune zu errichten, als darüber, wie man bestehende Grenzen und Barrieren entfernen kann – siehe beispielweise die USA oder Ungarn. Die einen versuchen sich abschotten, die anderen versuchen andere auszusperren. Wie behältst du in diesen Zeiten deinen Optimismus?
Micha:
Mein Optimismus bezieht sich hauptsächlich auf den musikalischen Mikrokosmos, in dem ich mich bewege, und lässt sich leider nicht so einfach auf den Rest der Welt übertragen. Wenn man sich beispielweise die humanitäre Situation in vielen Gegenden der Welt anschaut, gibt es eher keinen Grund zum Optimismus. Und gerade die Leute, die vor Elend und Krieg fliehen und die Mauern Europas überwinden wollen, haben sicherlich andere Sorgen, als sich um Musik zu kümmern. Da geht es um viel existenziellere Fragen. An dieser Stelle ist Musik sicherlich nicht der treibende Faktor oder hat keine so starke Wirkung, wie es zur Zeit der Wende in Berlin der Fall war.
Jonas:
In Deutschland wurde in den letzten Jahren Musikern aus den unterschiedlichsten Genres immer wieder vorgeworfen, keine Position zu beziehen. Findest du, dass Musik den Anspruch haben muss, politisch zu sein? Ich muss in dem Zusammenhang an deinen Track „A German Love“ denken, der für mich durchaus eine politische Komponente hat.
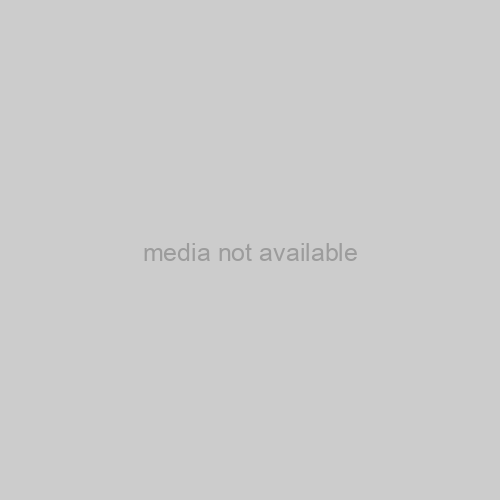
Je mehr ich sehe, was in der Welt passiert, und je mehr ich feststellen muss, dass Humanismus und Zwischenmenschlichkeit sukzessive von politischer Dogmatik ersetzt werden, desto mehr bin ich von Politik angewidert.
Micha:
Mit dem Politischen wäre ich sehr vorsichtig. „A German Love“ ist ja das Cut-up eines ursprünglich zusammenhängenden Textes, der durch die Schnitt-Technik rekontextualisiert wurde. Natürlich findet man dadurch bestimmte geschichtsbezogene Referenzen. Aber wie man das interpretieren möchte, liegt immer in der individuellen Wahrnehmung der Person, die den Track hört – als Musiker hat man es auch nur bedingt in der Hand, das zu steuern. Ich selbst hatte jedenfalls nicht die Intention, mit diesem Stück irgendwie politisch zu sein oder eine politische Message zu verbreiten.
Ob man seiner Musik diese zusätzliche Komponente geben will, muss jeder Künstler für sich selbst entscheiden. Ich selbst habe diese Absicht jedenfalls definitiv nicht und muss es für meine Musik ablehnen, irgendeine Art von politischer Aussage treffen zu wollen. Ich verstehe mich als einen politisch sehr interessierten Menschen – allerdings mit einer antipolitischen Haltung, soweit das praktisch möglich ist: Je mehr ich sehe, was in der Welt passiert, und je mehr ich feststellen muss, dass Humanismus und Zwischenmenschlichkeit sukzessive von politischer Dogmatik, gleich welcher Färbung, ersetzt werden, desto mehr bin ich von Politik angewidert.
Jonas:
Ist es nicht grundsätzlich schwieriger, sich mit seiner Musik inhaltlich zu positionieren, wenn man sich – wie bei Techno – in einem Genre bewegt, das größtenteils auf Sprache verzichtet?
Micha:
Sich zu positionieren ist ein Ausdruck der Persönlichkeit – dafür gibt es auch plakative Ansätze, wie man immer häufiger beobachten kann. Wenn man politisch ist und das in seiner Musik äußern will, findet man ganz sicher Wege, diese persönliche Komponente zu transportieren, auch im Techno.
Wir haben bereits darüber gesprochen, dass Musik eine unglaubliche Kraft entfalten kann. Und diese Kraft kann wiederum eine unglaubliche Wirkung auf andere erzeugen. Mit der Kreation geht also eine gewisse Verantwortung einher. Wie man mit dieser Verantwortung umgeht, muss jeder Künstler für sich selbst entscheiden. Am Ende des Tages hat man es aber vermutlich nur bedingt in der Hand, wie Musik wahrgenommen wird. Das liegt ganz alleine an den Menschen, die sie hören.
Music will tear down walls.
ancientmethods.com
soundcloud.com/ancient-methods
facebook.com/ancientmethods1



































